Alle Artikel der Rubrik "C 5 Internet-Revolution"

Lügenpresse? So schickte eine Leserin der Ruhr-Nachrichten eine Seite zurück, auf denen Fakten zu Flüchtlingen aufgelistet wurden
Viele Journalisten irritiert, wie der Volksunmut mit den Argumenten spielt: Er wirft den Journalisten Populismus vor und betreibt ihn selber in einer neuen Variante. Der neue Populismus behauptet selbstgewiss, er spreche für das Volk, für das ganze Volk; wer das bestreite, der höre nicht hin, wie das Volk wirklich denke. So sprachen einst die Journalisten, es war die Gewissheit der Medien.
Das Argument ist nicht neu, fand und findet sich immer wieder in Leserbriefen: Wer sich mit seinen Argumenten kein Gehör verschaffen kann, auch Beleidigungen und üble Nachreden nicht scheut, der schreibt, er wisse viele, wenn nicht die meisten hinter sich und wolle deshalb veröffentlicht werden.
„Populismus“ ist das Medienwort des Jahres: Ein unscharfer Begriff, aber ein geläufiger, der die Phantasie bewegt; er wurde früher für Politiker benutzt, die dem Volk nach dem Mund redeten und keine eigene Meinung hatte. Der neue Populismus ist ein Kampfbegriff der Pegida-Nachfolger. Sie schreiben keine Leserbriefe mehr, die im Papierkorb landen, sie sind allgegenwärtig und präsentabel für die alle Medien und Leitartikler.
Die neuen Populisten verraten das Heiligste der Aufklärung: das Gespräch. Die meisten von ihnen wollen nicht sprechen, wollen nicht diskutieren, wollen nicht streiten, sie wollen nur Recht behalten ohne Einspruch, ohne Wenn und Aber.
Das Bizarre an dieser Gesprächsverweigerung: Sie spiegelt die Haltung vieler Journalisten in der Vergangenheit wieder, als sie sich im Besitz der Wahrheit wähnten. Plötzlich ist nichts mehr gewiss, die Demokratie nicht, die Gewaltenteilung nicht, die Pressefreiheit nicht.
Wer es sich einfach machen will, gibt dem Internet die Schuld, jenem technischen Wunderwerk, das so schuldig oder unschuldig ist wie ein Bienenkorb: Als ob Hassprediger und Mitläufer den Hass erst mit dem Internet gelernt hätten! Der Rückgang der Auflagen und der Verlust des Vertrauens zu den Journalisten setzte vor dem Internet ein, wie ein Blick in die Statistiken belegt.
„Den Dialog suchen“, das Mantra von Journalisten, Politikern und Pädagogen, bezog sich meist nur auf einen Teil der Bürger: Man stritt unter sich, ließ die anderen zuhören und war sicher, dass sie andächtig staunten. Als die anderen nicht mehr staunten, hatten sich die meisten Journalisten in ihrem Elfenbeinturm, hoch über der Masse, schon so kommod gemacht, dass sie den Unmut nicht mehr wahrnahmen.
Viele lokale Zeitungen, die ihre Leser schon immer ernst nahmen, verlieren auch heute kaum Abonnenten und Leser: Wer seiner Zeitung und den Journalisten vertraut, für den ist seine Zeitung eine Heimat; nur wer sich heimatlos fühlt, gewinnt Sympathien für die Demagogen, die scheinbar dem Volk eine Stimme geben.
Das ist auch das Rezept gegen die neuen Populisten: Alle und alles ernst nehmen, aber alle und alles auch moderieren – ohne Zeigefinger und mit Respekt. Wer so seinen Journalismus versteht, der kann nicht nur, der muss Demagogen auch entlarven – und ausrufen wie das Kind im Andersens Märchen: „Der Kaiser ist nackt!“ Und keiner sieht’s.
Wer so als Journalist arbeitet, braucht keine Gremien, um Falschmeldungen auf Facebook zu entlarven, wie es Politikern gerade verlangen. Das schaffen gute Redaktionen besser – und es ist auch ihre Aufgabe, wenn wir den Artikel 5 unserer Verfassung ernst nehmen.
Die Angst der Politiker vor Fälschungen im Wahlkampf ist ein Vorgeschmack auf kommende Zeiten, wenn zwar noch Journalisten über Wahrheit und Fälschung recherchieren, aber zu wenige Bürger es mitbekommen. Es wird dann keine Öffentlichkeit mehr geben, die aus seriösen Medien in ausreichend großer Zahl ihre Informationen bezieht: Die Öffentlichkeit wird diffus und unberechenbar, gesteuert von Netzwerken voller Fälschungen und Gerüchten. Die Gewissheit, wie die Welt wirklich ist, wird schwinden – selbst wenn der Staat Wahrheits-Kommissionen einsetzen wird.
Wer als Journalist erst heute damit beginnt, seine Leser ernst zu nehmen, wird Geduld brauchen: Er muss den Respekt und das Vertrauen seiner Leser erst gewinnen. Ob Chefredakteure, Manager und Verlage dies wirklich wollen, steht noch dahin. Auch dies sind Entwicklungen des Jahres 2016:
- Einige investieren Millionen in Vielklick-und Blaulicht-Portale, die nie gutes Geld verdienen werden; sie verstecken den seriösen Journalismus hinter Barrieren – wohl wissend, dass man so weder ausreichend junge Leser gewinnen wird noch die Nicht-Leser der Zeitung.
- Man investiert nicht in die Qualität des Journalismus, man stärkt nicht das Lokale und Regionale, sondern spart dort, wo sich die Leser zu Hause fühlen, um in Zentralredaktionen „Synergien“ – auch ein Medienwort des Jahres – zu erwirtschaften, die kaum realisiert werden können.
Vieles wirkt panisch, auch im vergangenen Jahr: Die Werbe-Einnahmen sinken trotz einer außerordentlich guten Konjunktur – zum Teil sogar dramatisch; die Auflagen sinken, wenn auch nicht so dramatisch, und die Zahl der Redakteure wird immer kleiner. Ob der Höhepunkt der Krise erreicht ist? Das steht noch dahin.

Jürgen Habermas bei einer Diskussion in der Hochschule für Philosophie München, 2008 (Foto: Wolfram Huke / Wikipedia)
„Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten“, sagte vor fünfzig Jahren Paul Sethe, der als Herausgeber die FAZ gründete. Wer Verleger sein wollte und die Massen mit seinen Zeitungen erreichen, brauchte teure Druckmaschinen. Das änderte sich mit dem Internet. Endlich wird der Traum der Achtundsechziger wahr: Jeder kann von vielen gelesen werden. Die Demokratie ist bei sich angekommen, Öffentlichkeit endlich verwirklicht.
Und nun? Jürgen Habermas, Philosoph der Achtundsechziger, beklagt in einem Interview, die Bürger bedienten sich der neuen Freiheit nicht im Sinne der Aufklärung, sondern kehrten sie gegen die Freiheit und würden zum „Saatboden für einen neuen Faschismus“.
Im Jubiläums-Heft der Blätter für deutsche und internationale Politik, vor sechzig Jahren gegründet, verdächtigt er etablierte Politiker wie Journalisten, „von Anfang an die falsche Richtung eingeschlagen“ zu haben:
Der Fehler besteht darin, die Front anzuerkennen, die der Rechtspopulismus definiert: „Wir“ gegen das System.
Wer mit Rechtspopulisten öffentlich debattiere, nehme sie ernst, verschaffe ihnen Aufmerksamkeit und mache den Gegner stärker – wie Justizminister Heiko Maas, der sich im Oktober mit Alexander Gauland von der AfD in einer ZDF-Talkshow duellierte.
Es sei Schuld der Medien, dass „nach einem Jahr nun jeder das gewollt ironische Grinsen von Frauke Petry kennt und das Gebaren des übrigen Führungspersonals dieser unsägliche Truppe“. Rechtspopulismus verdiene Verachtung statt Aufmerksamkeit. Im Juli hatte Habermas schon in einem Interview mit der Zeit aus der „Perspektive eines teilnehmenden Zeitungslesers“ die Anpassungsbereitschaft der Journalisten gegenüber Merkel und der Politik beklagt: „Der gedankliche Horizont schrumpft, wenn nicht mehr in Alternativen gedacht wird.“
Medien wie Parteien informierten die Bürger nicht mehr „über relevante Fragen und elementare Tatsachen, also über die Grundlagen einer vernünftigen Urteilsbildung“. Das Argument ist nicht weit entfernt von der Kritik bei den Pegida-Spaziergängen in Dresden.
Habermas bringt als weiteres Indiz für den Zerfall der Öffentlichkeit die Wahlmüdigkeit der jungen Leute. „Das klingt so, als sei wieder die Presse schuld“, wirft der „Zeit“-Redakteur Thomas Assheuer ein. „Nein“, zieht sich Habermas zurück, „aber das Verhalten dieser Altersgruppe wirft ein Schlaglicht auf die Mediennutzung jüngerer Leute im digitalen Zeitalter und auf den Wandel der Einstellung zu Politik überhaupt. Nach der Ideologie des Silicon Valley werden ja Markt und Technologie die Gesellschaft retten und so etwas Altmodisches wie Demokratie überflüssig machen.“
Die Forderung nach „Dethematisierung“ verbindet Habermas mit der Forderung an Journalisten und Politiker:
Die Bürger müssen erkennen können, dass jene sozialen und wirtschaftlichen Probleme angepackt werden, die die Verunsicherung, die Angst vor sozialem Abstieg und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, verursachen.
** Mehr in meiner JOURNALISMUS!-Kolumne auf kress.de: Gebt Rechtspopulisten keine Bühne
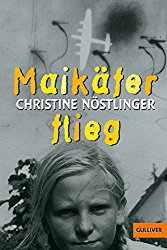
Christine Nöstlingers beeindruckendster Roman: Die letzten Weltkriegstage aus der Sicht eines Mädchens.
Die österreichische Kinderbuch-Autorin Christine Nöstlinger, die gestern 80 wurde, traut sich nicht mehr zu, für 13- und 14-Jährige zu schreiben. Im Interview mit Tilman Spreckelsen von der FAZ sagt sie:
Menschen, die ihre Freizeit hauptsächlich damit verbringen, auf einem Smartphone herumzuwischen – ich kann mir nicht vorstellen, was in so einem Kopf vorgeht.
Verzweifelt ist sie ob der Bundespräsidenten-Wahl in Österreich:
Das Schreckliche ist ja: Jahrzehntelang haben wir geschimpft auf die Boulevardpresse, dass die Leute blöd macht. Aber jetzt haben wir ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, das sich nicht mehr an der Boulevardpresse orientiert, sondern an den sozialen Medien.
Diese Leute bekämen immer nur das, was in ihr Weltbild passe. Resigniert endet die 80-Jährige: „Ich wüsste nicht, wie man auf diese Leute Einfluss nehmen kann.“
**
Quelle: FAZ 13. Oktober 2016 „Politisch immer mehr so links gewesen“

Kai Gniffke leitet ARD-aktuell (Foto: ARD)
Die Funktion von Journalisten in Abgrenzung zu den sozialen Medien: Zu verifizieren, zu recherchieren, einzuordnen und auszuwählen.
Kai Gniffke, Chef von ARD-aktuell, im Interview mit Ursula Scheer (FAZ) gegen den Vorwurf, dass Live-Videos im Netz – bei dem Attentat in Nizza beispielsweise – einfach schneller seien und ARD und ZDF den Rang ablaufen. Müssen die Sender und Journalisten überhaupt ihre ethischen Standards brechen? Ein Problem, antwortet Gniffke:
Wir zeigen keine sterbenden Menschen, wir zeigen keine rohe Gewalt. Aber was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.
Kai Gniffke bleibt dennoch optimistisch:
Menschen suchen weiterhin Einordnung durch Institutionen, die sie kennen… Ich denke, dass das normale lineare Fernsehen stärker bleiben wird, als ich selbst das vor zehn Jahren geglaubt habe.
**
Quelle: FAZ 19. Juli 2016 „Wir dürfen nicht einfach draufhalten“
Aus Scheiße wird nicht Gold, nur weil es gedruckt steht – und andersherum genauso wenig. Ich dachte eigentlich, dass dieser Kulturpessimismus endlich abgehakt wäre.
Andreas Weck im Blog „Aufgeweckt“ zur Umfrage „Soziale Netzwerke überholen Zeitungen als Nachrichtenquelle“.

Laszlo Trankovits war für dpa in USA, Afrika und Nahem Osten
Es ist schade, dass Journalisten oft defensiv und kleinlaut auf die wirren Stimmen der Wut im Netz, auf die irrealen Visionen überheblicher Internet-Gurus oder die wichtigtuerischen Belanglosigkeiten klickreicher Youtube-Stars reagieren. Journalisten – auch wenn die meisten ,digital immagrants‘ im ,Neuland‘ sein mögen – können (und sollten!) mit Recht darauf verweisen, dass es in einer demokratischen Gesellschaft ohne sie nicht geht.
Laszlo Trankovits, ehemals Korrespondent der dpa in Washington, Afrika und im Nahen Osten in: „Journalismus 2020 – die Macht der Medien von morgen“, herausgegeben von „Deutsche Gesellschaft Qualitätsjournalismus“
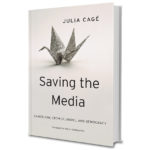
Das Buch der französischen Wirtschafts-Professorin zum Konzept der Non-Profit-Medien
Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?
Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.
Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.
Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.
Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.
Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.
Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.
Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.
Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:
-
Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.
-
Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.
Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:
-
Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)
-
und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).
In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.
Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?
Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“
Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.
Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:
-
Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?
-
Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?
-
Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?
**
Quellen:

Die Tatort-App (Foto: ARD)
Die Münsteraner Tatort-Protagonisten Axel Prahl (spielt Kommissar Thiel) und Jan Josef Liefers (spielt Professor Boerne) werben für die neue Tatort-App, zur Zeit nahezu jeden Abend im Ersten. Weniger positiv sehen das die Münchner Kommissare:
Während der Film läuft, mach ich nichts anderes als zuschauen.
So Miroslav Nemec auf die Frage von Jörg Seewald in der Süddeutschen Zeitung, ob er beim Tatort-Chat mitmache; Nemec spielt seit 25 Jahren im Münchner „Tatort“ den Kommissar Ivo Bativ. Udo Wachtveitl, der an Nemec‘ Seite den Kommissar Franz Leitmayr spielt, ist noch skeptischer und macht klar, wie sich analoge Medienbürger wie er und digitale Ureinwohner unterscheiden:
Ich verstehe die Idee eines Parallelchats nicht. Auf welchen Bildschirm soll man denn nun schauen? Da kannibalisieren sich doch zwei Angebote, zwei Aufmerksamkeiten.
Multitasking nennen das die Digitalen. Allerdings lesen auch die Analogen Zeitung, während nebenbei der Fernseher läuft (aber wohl kaum bei einem spannenden „Tatort“). Vielleicht ist alles auch nur eine Frage des Alters – und die Digitalen, wenn sie Ende 50 sind, werden auch wieder eins nach dem anderen machen.
**
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 30. März 2016: „Du kriegst einen Krimi, und wir kriegen den Mörder“

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Foto: bpb/Ulf Dahl
In einem Interview mit kress.de spricht Thomas Krüger (56), Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, über „Dunkeldeutschland“, Journalisten und das Misstrauen der Bürger gegenüber den Medien, Medien-Manipulation und den Fehlern, die Journalisten verschweigen oder zugeben.Thomas Krüger (56) studierte Theologie in der DDR, war nach der Revolution Jugend-Senator in Berlin und ab 1994 einige Jahre Abgeordneter im Bundestag.
Gerade im Westen sagen viele: 25 Jahre Einheit müssten doch ausreichen, um die Diktatur aus den Köpfen zu vertreiben.
Thomas Krüger: Diktatur-Aufarbeitung dauert lange, das ist ein Generationen-Projekt. So etwas braucht seine Zeit. Nehmen Sie mal die Zeit des Nationalsozialismus. Sie dauerte 12 Jahre. Der zeitliche Abstand zur DDR ist heute 26 Jahre, also wären wir, was die NS-Aufarbeitung angeht, heute gerade mal im Jahr 1971 angelangt, also: vor der TV-Serie „Holocaust“, dem Gedenkstättenboom, dem kritischen Nachfragen einer neuen Generation. Die DDR dauerte 40 Jahre, also fast zwei Generationen. Warum sollte die „Aufarbeitung“ und Bewältigung schneller gehen als bei der des Nationalsozialismus?
Ist der Osten also wirklich noch Dunkeldeutschland?
Thomas Krüger: Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich sehe – wie der Bundespräsident – in ganz Deutschland und auch in Ostdeutschland eine engagierte und organisierte zivilgesellschaftliche Willkommenskultur, viele Ostdeutsche verurteilen die Fremdenfeindlichkeit und die Übergriffe aufs Schärfste. Aber gerade in den letzten Monaten, wo sich Menschen, die aus größter Not zu uns gekommen sind, gewalttätigen rechtsextremen Demonstranten aussetzen, gibt es eine Notwendigkeit, diese Schattenseiten klar und deutlich anzusprechen.
Haben Journalisten diese Schattenseiten nicht deutlich genug angesprochen. Kurzum: Haben die Medien, haben die Journalisten versagt?
Thomas Krüger: Nein, ich bin Anhänger der These, dass der Journalismus heute nicht schlechter, die Leser aber sehr viel kritischer sind. Als publizistisches Rückgrat der demokratischen Öffentlichkeit bleiben Journalisten unersetzlich und natürliche Verbündete der politischen Bildung. Beiden geht es darum, Sachverhalte zu erklären, Kontroversen aufzuzeigen und letztendlich das demokratische Bewusstsein und die aktive Mitarbeit zu stärken.
Offenbar haben auch Journalisten einiges falsch gemacht. Umfragen deuten an: Das Vertrauen ist bei vielen Bürgern erschüttert. Haben Journalisten vielleicht wie Oberlehrer aufs Volk hinabgeschaut – was die Bürger eben nicht mögen?
Thomas Krüger: Wenn Journalisten etwas falsch gemacht haben, dann höchstens zwei Dinge: Erstens, dass sie sich zu spät in die Debatten im Netz, in den sozialen Medien eingeschaltet haben. Hier haben viele Journalisten die Möglichkeiten unterschätzt, sich frühzeitig Gehör zu verschaffen. Und zweitens haben Sie ihr Licht unter den Scheffel gestellt. Guter Journalismus setzt sich schon durch, dachte man, dass dazu aber heute eine transparente Kommunikation gehört, haben viele noch nicht begriffen.
Journalisten wie der ehemalige FAZ-Redakteur Udo Ulfkotte schreiben: Medien manipulieren, lassen sich korrumpieren und von Amerika und der Nato einspannen. Stimmt unsere Politik-Berichterstattung nicht mehr?
Thomas Krüger: Natürlich kann man manches kritisieren. Wenn zum Beispiel der Eindruck entsteht, im politischen Berlin würde eine Art „Hofberichterstattung“ stattfindet, und zum Beispiel Pressekonferenzen nur dazu genutzt werden, um O-Töne einzuholen, statt Dinge kritisch zu hinterfragen – dann werden Journalisten ihrer Rolle als „vierte Gewalt“ nicht mehr gerecht. Aber es gibt sie ja noch, die investigativen und meinungsstarken Formate und Reporter und die genannten Vorwürfe von Herrn Ulfkotte sind doch sehr verschwörungstheoretisch. Da macht es auch keinen Unterschied, dass er mal für die FAZ geschrieben hat.
Wenn Redaktionen Fehler öffentlich zugeben, laufen sie Gefahr, dass andere wie beispielsweise der Ministerpräsident Seehofer sagen: Seht Ihr, jetzt geben sie schon selber zu, dass sie Fehler machen! Wäre es da nicht besser zu schweigen und die Fehler auszusitzen?
Thomas Krüger: Auf keinen Fall! Fehler müssen benannt und analysiert werden – auch öffentlich. Die Taktik, solche Dinge totzuschweigen, ist nicht mehr zeitgemäß und führt keinesfalls dazu, Vertrauen, das durch einen Fehler möglicherweise verloren gegangen ist, wieder zurückzugewinnen. Gerade in den lokalen und regionalen Tageszeitungen konnten wir aktuell feststellen, dass sich besonders die Lokalredaktionen herausgefordert sehen, sie aktiv auf ihre Leser zugehen – durch Bürgerdialog-Veranstaltungen und andere Events. Hinzu kommt eine neue Ombuds-Bewegung, die sich den Fragen und der Kritik der Leserschaft annimmt.
Teil 2 folgt.
Das komplette Interview, geführt von Paul-Josef Raue:
http://kress.de/news/detail/beitrag/134670-interview-mit-bpb-praesident-thomas-krueger-stimmt-unsere-politik-berichterstattung-nicht-mehr.html
Der Mensch ist nicht ein sanftes liebebedürftiges Wesen… Infolgedessen ist ihm der Nächste auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen… ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten.
Was Sigmund Freud 1930 in „Das Unbehagen in der Kultur“ schrieb, ist täglich in Internet-Foren zu beobachten. Jeder, so Freud, benimmt sich „in irgendeinem Punkte ähnlich wie der Paranoiker“ und trägt diesen Wahn in die Realität ein. Heißt dieser Wahn: Internet?

Roland Panter ist Kommunikationsvorstand des Bundesverbands der Community Manager (Foto: Bundesverband)
Wie ein aktueller Kommentar zu Freuds Unbehagen liest sich ein Interview, dass Andreas Weck vom t3n-Magazin mit Roland Panter geführt hat, Kommunikationsvorstand des Bundesverbands der Community Manager. Der Profi erzählt, wie man mit dem Hass im Netz umgeht und mit den Trollen, in die wir uns alle mal verwandeln können. Hier Auszüge aus dem Interview:
Emotionen statt Reflektion: Abschied vom kühlen Kopf
Hass breitet sich über digitale Kanäle genau so schnell und dynamisch aus wie Liebe oder der Glaube an die positive Kraft der Kommunikation. Und das sogar so sehr, dass wir zwischenzeitlich das Gefühl hatten, uns würde eine Welle des Hasses überrollen.
Hier treten vor allem Mechanismen auf, die sich in der Unvollständigkeit der Kommunikation begründen – wir können viele Dinge schlichtweg nicht richtig lesen. Ist mein Gegenüber freudig oder verärgert, macht er oder sie vielleicht gerade einen ironischen Kommentar?
Je höher die Emotionalität, desto weniger reflektiert gehen wir als Mensch manchmal vor, und lassen uns ab und an zu Äußerungen verführen, die wir mit kühlem Kopf vielleicht nie getroffen hätten.
Wer verliert den kühlen Kopf? Der Wettbewerb der Zermürbung
Das betrifft wohl uns alle, nicht nur die vermeintlich Bösen. Dazu kommt die ganz klassische Gruppendynamik mit ihrer fatalen Wirkung. Menschen fangen an, sich zu verbünden oder wollen Aussagen gezielt in eine gewisse Richtung stoßen. Das wird in so einem Fall schnell zu einem Zermürbungswettbewerb, in dem die Lager immer mal wieder den Pfad des Anstands verlassen – übrigens bis hin zu Repressalien im realen Leben. Alles schon vorgekommen.
Der internationale Siegeszug der Gerüchte
Wir konnten wir in den vergangenen Monaten beobachten, das Gerüchte auch das Zeug zur internationalen Verschwörung haben. Es ist nicht immer so einfach, den wirklichen Treiber einer gewissen Themenpolitik auf Anhieb zu erkennen – hier sei beispielhaft auch Putins sogenannte „Troll Armee“ genannt.
Wie sollen wir mit Gerüchten umgehen?
Die alte These, dass Trolle nicht gefüttert werden sollen, gilt heute nur noch bedingt. Wir haben von der Facebook-Fanpage der Bundesregierung gelernt, dass mit geschickter Gegenrede oftmals mehr erreicht werden kann. Manche Beiträge sind allerdings so krude, dass sie für sich selbst sprechen und keine weiteren Kommentare benötigen. Viel lässt sich auch mit feinem Humor erreichen.
Hass-Prediger einfach rauswerfen, ganz oder teilweise
Früher befürchtet man noch eine Welle der Empörung nach Löschungen. Heute haben Nutzer hingegen akzeptiert, dass es diese Maßnahme gibt und sie ab und zu auch ein notwendiges Werkzeug ist. Ganz oft reicht auch eine temporäre Sperre, um dem Nutzer eine Möglichkeit zum Abkühlen zu geben.
Kommentar-Spalten einfach schließen? Nein, semantische Software einsetzen
Hier sieht man häufig, dass eine Unterscheidung zwischen Fakten und Überzeugungen durch die jeweiligen Nutzer scheinbar nicht mehr möglich ist. Das bedeutet in der Folge, dass man denen mit guten Worten nicht mehr beikommen kann. Da geht es um Verschwörungstheorien, arge Beleidigungen, völlig unreflektierte Behauptungen und dies in unglaublich großer Anzahl.
Ich würde mir eher wünschen, dass diese Medien mehr Ressourcen für ein besseres Community-Management zur Verfügung stellen. Das geht aufgrund der Masse an Kommentaren aber oft schon nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Hier gibt es erste erfolgreiche Ansätze mit semantischer Software, die automatisierte Moderation ermöglicht und zumindest die ganz schlimmen Fälle aussiebt – mit erstaunlich geringer Fehlerquote übrigens. Als gutes Beispiel sei an dieser Stelle das Community-Management von „Die Welt“ genannt, die ihre Kommentare auch dadurch gut in den Griff bekommen.
**
Quelle:
http://t3n.de/news/community-management-trolle-hass-interview-699024/?utm_source=t3n-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=So+machen%27s+die+anderen!







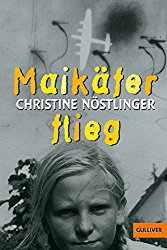


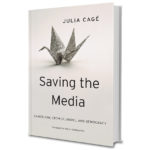





 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von