Robert Domes: Ich vergleiche journalistische Kreativität mit der Goldsuche

Robert Domes war Lokalchef im Allgäu und ist Autor des Bestsellers „Nebel im August“, der verfilmt wurde. Foto: Simone Schatz
In einem Interview für die Journalismus-Kolumne von Kress spricht der Journalist Robert Domes über Lokaljournalisten, Recherche und Wahrheit, über arrogante Redakteure, die Demokratie, über Claas Relotius und über seinen mehrfach preisgekrönten Film „Nebel im August“.
Dies sind die stärksten Zitate:
Echte Kreativität ist fast immer eine Antwort auf eine möglichst exakte Frage. Ich vergleiche das mit der Goldsuche: Ich grabe mich durch das Sediment und wasche den Sand, bis ich die Goldkörner finde. Das erfordert ein offenes Auge, vor allem aber Fleiß und Geduld.
Ein gutes Beispiel ist die Sendung mit der Maus. Sie bedient sich eines Konzepts, das auch Journalisten nutzen sollten. Man versetze sich in die Sichtweise eines Kindes, das die banalsten Dinge hinterfragt und das immer wieder die „Königsfrage“ stellt: Warum? Schnell erkennen wir auf diese Weise, wie schwierig viele Sachverhalte tatsächlich zu erklären sind. Nicht nur Kinder stellen solche Fragen, auch viele Leser. Dazu dürfen Journalisten nichts für selbstverständlich nehmen.
Das ist die größte Herausforderung im Redaktionsalltag: Muße finden, sich Freiraum schaffen für unkonventionelle Ideen. Das ist auch Aufgabe der Redaktionsleitung, ihrer Mannschaft die Möglichkeit zum Spielen zu geben.
Ich bin ein Verfechter der guten alten Grundsätze: berichten, nicht richten; verdichten, nicht erdichten; beschreiben, nicht vorschreiben.
Der finanzielle und zeitliche Druck (in Lokalredaktionen) hat eher zugenommen. Viele aufwändige Recherchen gelingen nur, weil Kollegen ihre Freizeit dafür opfern und/oder weil die Redaktion Mehrarbeit übernimmt. Allerdings hat inzwischen eine Reihe von regionalen Medienhäusern eigene Reportage-Ressorts eingeführt. Dass sich diese Investition lohnt, zeigen die zahlreichen ausgezeichneten Geschichten.
Ich erlebe Kollegen, die mit Sachverstand glänzen, und andere durch Ignoranz, anbiedernde und arrogante, kluge und dumme, gut und schlecht vorbereitete. Aber das finden wir ja überall in unserer Gesellschaft. Warum sollten Journalisten bessere Menschen sein?
Das Argument „Ich will Vorbild sein und die Demokratie voranbringen“ habe ich noch nie in den Profilanforderungen einer Stellenausschreibung gelesen. Wenn wir solche vorbildliche Journalisten wollen, müssen wir sie entsprechend ausbilden. Dann gehört das Fach „Demokratisches Bewusstsein“ in jeden Voloplan und jeden Studiengang.
Vielleicht ist Claas Relotius ein Beispiel dafür, wie eng Genie und Wahnsinn beieinander liegen. Relotius sagt von sich selbst, er sei krank. Aber: Ebenso krank ist das journalistische System, das einen solchen Betrug gefördert und möglich gemacht hat. Es sind Redaktionen, in denen nicht zuvorderst über Fakten diskutiert wird, sondern über die „Deutungshoheit“. In denen eine Kultur der journalistischen Arroganz gepflegt wird. Das ist eine Einladung zum Hochstapeln.

Der Film „Nebel im August“ ist nach dem Roman von Robert Domes entstanden. Die Hauptrollen spielen Sebastian Koch als „Euthanasie“-Arzt Veithausen und der junge Ivo Pietzcker als Ernst, der das mörderische Treiben in der „Euthanasie“-Klinik durchschaut und selber zum Opfer wird. Foto: Anjeza Cikopano, ZDF
Berthold Flöper und die Zeitung der Zukunft: Lokal durchkomponiert

Berthold Flöper leitete das Lokaljournalisten-Programm der „Bundeszentrale für politische Bildung“ bis Ende des Jahres 2018. Foto: Hans Blossey/BpB
Die „Drehscheibe“-Redaktion hat für Berthold Flöper, der Ende 2018 in den Ruhestand gegangen ist, eine Sonder-Drehscheibe herausgegeben, in der Weggefährten auf Begegnungen und Projekte mit ihm zurückblicken. Berthold L. Flöper war seit Mitte der 90er Jahre Leiter des Lokaljournalistenprogramms der „bpb“.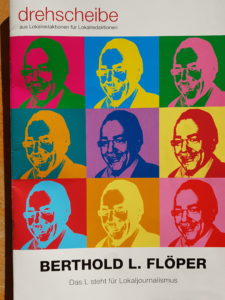
Paul-Josef Raue erinnerte sich in der Extra-„Drehscheibe“ an einen Kongress und ein Buch über die Zukunft der Zeitung, zusammen mit Flöper 1994 organisiert:
„Wir brauchen die Tageszeitung mehr denn je – um zu verstehen, was die Mächtigen vorhaben; um mitwirken zu können in der Demokratie, die ja Sache aller Bürger ist.“ So leiteten wir vor knapp einem Vierteljahrhundert einen Kongress ein, zu dem hundert Chefredakteure, Verleger, Journalisten, Wissenschaftler und „Datenverarbeitungs-Experten“ gekommen waren; Berthold Flöper und Paul-Josef Raue organisierten und moderierten in Königswinter: „Zeitung der Zukunft – Zukunft der Zeitung“.
Wir standen am Beginn der digitalen Medienära, schauten erstaunlich klar und selbstbewusst in die Zukunft und wussten schon: „Die Zeitung wird sich in vielem ändern müssen. Das jedenfalls werden Publikumserwartungen und neue Medien gleichermaßen provozieren.“ Das E-Paper, die Hoffnung der Branche, hieß noch „Bildschirmzeitung“: „Sie scheint trotz aller Skepsis eine aussichtsreiche Zukunft zu haben – vor allem wegen ihrer handwerklichen Benutzbarkeit.“ Erinnern wir uns überhaupt noch an die klobigen Rechner im Jahr 1994?
Schwergewichte aus der Branche sprachen – und einige prophetisch:
- „Journalistisch mitreißend sollten sie sein, innovativ und leidenschaftlich engagiert“, forderte Gerd Schulte-Hillen, der Gruner+Jahr-Chef – und meinte die Verleger, die sich ändern müssten. Erst zwei Jahrzehnte später hat Julia Jäckel bei G+J die Forderung eingelöst.
- „Journalisten sollen Ordnung in die Welt bringen. Wir brauchen keine Missionare“, ermahnte Dieter Jepsen-Föge, Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“, als keiner „Lügenpresse“, AfD und Pegida auch nur ahnen konnte.
- „Das Problem sind nicht die Leser, sondern die Schreiber“, analysierte Art Nauman, Ombudsmann der Hauptstadt-Zeitung aus Kalifornien. Erst vor wenigen Wochen ist die deutsche Ombudsleute-Vereinigung in Deutschland gegründet worden.
- „Journalisten sind weder Politiker noch Pädagogen. Sie haben die Leser nicht an die Hand zu nehmen“, mahnte Dieter Golombek, Chef des Lokaljournalisten-Programms der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihm folgte Berthold Flöper nach.
- „In meiner Zeitung werden die Machenschaften der Politik zu wenig aufgedeckt“, war einer der heftigsten Vorwürfe der Leser in der „Opus“-Forschungsmethode, die Cornelia Tomaschko, Redakteurin aus Karlsruhe, vorstellte. „Opus“, wie ein Spiel aufgezogen, war ein analoger Vorläufer des digitalen „Lesewert“ aus Dresden, mit dem Lesequoten in Zeitungen ermittelt werden und Redakteure erstmals erfahren, was überhaupt gelesen wird.
Berthold Flöper schloss mit der Forderung nach einer „nach dem lokalen Prinzip durchkomponierten Zeitung“. Was wir bekommen haben sind Synergien und Zentralredaktionen.
Paul-Josef Raue führte in seiner Kress-Journalismus-Kolumne ein Interview: „Flöpers Plädoyer für einen öffentlich-rechtlichen Lokaljournalismus“, ebenso das Medium-Magazin in Heft 7/2018: „Die Totgesagten leben noch heute“.
Leyendecker: Alltag eines Lokalredakteurs ist schwieriger als der eines Spiegel-Reporters
Hans Leyendecker war einer der großen Investigativ-Reporter in Deutschland, erst beim Spiegel, dann bis zum Ruhestand bei der Süddeutschen Zeitung. Foto: Wjournalist 2014
Im Journalismus gibt es unterschiedlichste Formen von Leistungsdruck. Wenn ein Redakteur in der Lokalredaktion täglich drei Seiten füllen muss, dann ist das für mich echter Druck. Ein Lokalredakteur muss ja nicht nur die Beiträge von nicht einmal freien Mitarbeitern völlig umbauen, sondern am Ende des Tages müssen drei Lokalseiten mit möglichst interessanten News gefüllt sein. Welchen Druck hat im Vergleich dazu derjenige, der beim Spiegel fünf Wochen lang an einem Ort verweilen kann, um eine anständige Geschichte zu liefern?
Hans Leyendecker im Interview mit dem journalist auf die Frage: „Relotius soll nach seiner Enttarnung gesagt haben: ,Es ging nicht um das nächste große Ding. Es war die Angst vor dem Scheitern.‘ Spricht so ein Statement für einen extremen Leistungsdruck im Journalismus?“
Journalisten wie Relotius, so Leyendecker, seien „verdammt privilegiert“:
Der Alltag eines Lokalredakteurs ist dagegen viel schwieriger, viel komplizierter, aber genügend Leute meistern den tagtäglichen Parforceritt mit Bravour. Ein Relotius hat in meinen Augen keine Ahnung davon, was Druck wirklich bedeutet.
„In der Provinz stumpfen die Menschen in ihrer Seele ab“
Wer Verbündete gegen den Lokaljournalismus und den vermeintlichen Mief des Provinziellen sucht, findet ihn bei Erika und Klaus Mann. Sie reisten Ende der zwanziger Jahre durch die USA und berichteten darüber in ihrem Buch „Rundherum“:
„Was für ein abgestorbenes Idyll! Wenn irgendwo die Leidenschaft des zukunftswilligen Gedankens machtlos ist, so hier. Denn hier begegnet sie keinem Widerstand, sondern der tödlichen Ruhe der Menschen, die es am Leibe gut haben und verfaulen, abstumpfen in ihrer Seele.“
Im Arche-Literaturkalender 2018 gefunden
Lokalredakteure, Karnickel-Fotos und der Blick von außen
Ein bisschen Häme ist schon dabei, oder nennen wir es einfach Ironie, wenn „turi“ in seinem Newsletter Lokaljournalismus auf „Karnickel fotografieren“ reduziert. Es geht um die Idee, Lokalredakteure vom 14. bis 20. Mai im Austausch in einen anderen Verlag zu schicken. Die Aktion sollte gelobt werden, denn erfahrungsgemäß sind gerade viele Lokalredakteure recht sesshaft und stehen Veränderungen reserviert gegenüber. Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff vom Zeitungsverleger-Verband, der die Aktion organisiert, drückt es netter aus: „Ohne die Experten, die sich vor Ort bestens auskennen und vernetzt sind, geht Qualitätsjournalismus nicht“, um dann das Ruder schnell herumzureißen: „Der Blick von außen aber kann neue Perspektiven eröffnen. Davon profitieren nicht nur die Journalisten, sondern vor allem auch die Leserinnen und Leser.“
Wolff verweist auf sechs Chefredakteure, die Stefan Kläsener vor zwei Jahren auf die Insel Föhr eingeladen hatte. Dort entstand die Austausch-Idee, die allerdings zwei der sechs Chefs nicht gut bekommen ist: sie sind mittlerweile entlassen.
Quelle / Die Turi-Meldung vom 9. Mai 2018:
Mal andere Karnickel fotografieren: Der BDZV, quasi der Elternbeirat der deutschen Lokalredakteure, veranstaltet für 50 seiner Schützlinge ein Austauschprogramm. Für die komplette nächste Woche geht es aber nur in eine neue Lokalredaktion – statt wie einst als Neuntklässler nach Neuseeland.
Den Leser wie ein Spaziergänger erleben
Johann Gottfried Seume, der Spaziergänger nach Syrakus, könnte ein Vorbild sein für Journalisten:
„Er ging bewusst zu Fuß, statt die Kutsche zu benutzen, weil er nicht auf die Leute herabblicken, sondern die Länder auf Augenhöhe mit den einfachen Menschen erleben wollte.“
(Dirk Sangmeister, Herausgeber der Werke Seumes (1763-1810), in der Braunschweiger Zeitung, 8.2.2018)
Der neue Verleger der „New York Times“ begann als Lokalreporter in einem Fischerdorf
Eigentlich wollte Arthur Gregg Sulzberger, der neue Verleger der New York Times, kein Journalist werden – bevor ihn seine Professorin überredete, für zwei Jahre in der Lokalzeitung eines Fischerdorfs an der Küste zu arbeiten. Sulzberger stand kurz vor seinem Abschluss in Politikwissenschaft, als er in seiner Klasse auf die Professorin Tracy Breton traf, die gleichzeitig eine investigative Reporterin beim Providence Journal war (was in USA nicht ungewöhnlich ist). Tracy Breton, die schon einen Pulitzer-Preis gewonnen hatte, war eine großartige Reporterin, erzählt Sulzberger in einem Interview mit dem New Yorker. Sie weckte die Leidenschaft für den Journalismus – „ich liebte einfach ihre Art zu schreiben.“
Den Moment, in dem er den Journalismus für sich entdeckte, beschreibt Sulzberger so: „Am Ende eines zweistündigen Gesprächs sagte Tracy: ‚ Arthur, ich habe einen Job für dich im Providence Journal. Es ist ein zweijähriges Praktikum, und ich möchte, dass du es machst: Narragansett ist eine kleine Stadt im Süden von Rhode Island.’“
Doch Sulzberger wehrte sich: „Ich werde meine Karriere mit anderen Dingen beginnen.“ Tracy überredete ihn: „Wenn du es nicht versuchst, wirst du dich immer wundern.“ Er versucht es, wird Stadtreporter, berichtet über Stadtrats-und Schulrats-Ssitzungen, ruft jeden Morgen den Polizeichef an und fragt, was über Nacht passiert sei.
„Die ersten drei Monate waren hart“, erzählt Sulzberger, „denn die Aufgabe des Reporters ist es, allen anderen etwas zu erklären. Aber wann immer Sie einen neuen Job beginnen, wissen Sie genau, wie viel Sie nicht wissen.“ Aber er bekam Lust darauf, einen halben Tag mit den Leuten zu reden, herauszufinden, was in der Welt vor sich geht, und den anderen halben Tag alleine eine Geschichte zu schreiben. „Ich liebte einfach den Rhythmus der Tage.“
Es folgten weitere Stationen beim Oregonian und in den Great Plains als Chef der Times Kansas-Stadt-Redaktion, wo er Aufsehen erregt mit der Reportage eines Vegetarier im „Mekka des Fleisches“. David Remnick erinnert sich im New Yorker: „An Arthur Bryants berühmtem Grillplatz lehnte er die Rinderbrust und die mit Schmalz gefüllten Pommes Frites ab und trank ein Budweiser (Bud) zum Mittagessen. Trotz der Größe der Schlagzeile konnten fleischfressende Leser nicht umhin, Sympathie für ihren selbstverleugnenden Korrespondenten zu empfinden.“
Neujahr wurde A.G. Sulzberger Verleger der New York Times als sechstes Mitglied der Familien-Dynastie Ochs-Sulzberger, die 1896 die Zeitung gekauft hatte.
Mehr in meiner Kolumne JOURNALISMUS! bei kress.de.
Journalisten müssen mehr moderieren – Interview mit Medien-Professor Hans-Jürgen Bucher (Teil 1)
Hans-Jürgen Bucher war der erste Professor, als vor zwanzig Jahren die „Medienwissenschaft“ in Trier gegründet wurde. Zum Jubiläum, das am Samstag (27. Januar 2018) gefeiert wird, sprach ich mit Professor Bucher über das Verhältnis von Medienwissenschaft und Journalisten, die Ausbildung von Journalisten in den USA und in Deutschland sowie den Unwillen von Journalisten an der Weiterbildung.
Herr Professor Bucher, Medienwissenschaftler und Journalisten in Deutschland scheinen in verschiedenen Welten zu leben. Was läuft da schief?
Nichts, ich sehe darin kein Problem, sondern eine Chance: Journalisten und Medienwissenschaftler müssen in zwei verschiedenen Welten leben. Täten sie das nicht, würden sich die wechselseitige Kritik und Befruchtung aufheben. Journalismus unterliegt z.B. der Aktualitätsmaxime, was für die Wissenschaft nicht gelten kann, die an langfristigen Erkenntnissen – genannt Grundlagenforschung – interessiert sein muss. Journalismusforschung ohne Distanz zum Journalismus ist rein logisch gar nicht möglich – wenn sie nicht zur Reportage über Journalisten verkommen möchte (was es natürlich auch manchmal gibt).
Das hört sich nett an: Wechselseitige Befruchtung. Die setzt aber Begegnung voraus: Wie kommen nun Medienwissenschaftler und Journalisten in einen Dialog?
Zum Beispiel dadurch, dass man sich gegenseitig zu Tagungen einlädt, wie wir das in der Trierer Medienwissenschaft bei einer Tagung zur journalistischen Qualität getan haben. Auch anwendungsorientierte Forschungsprojekte in Kooperation mit Redaktionen sind ein guter Weg, in einen Dialog zu kommen. Wir haben das bei verschiedenen Relaunch-Projekten von Zeitungen ebenso praktiziert wie bei der Evaluierung von Online-Angeboten.
Sie lehrten als Gastprofessor in den USA, wo die Kommunikation zwischen Redaktionen und Wissenschaft alltäglich ist. Dort werden alle Redakteure an Universitäten ausgebildet. Wäre das ein Vorbild für uns?
Diese Frage wird für die Journalistenausbildung in Deutschland gestellt, seit sich Karl Jäger und Emil Dovifat in den 1920er-Jahren mit den viel älteren US-amerikanischen Universitäts-Curricula für Journalisten befasst haben. Beide haben darauf hingewiesen, dass bei einem Vergleich der Ausbildungswege auch die Unterschiede zwischen den Journalismus-Kulturen in den beiden Ländern zu berücksichtigen sind.
Beide beurteilen demzufolge die universitäre Journalisten-Ausbildung in den USA als „Drill“ und „Berufsausbildung“, während in Deutschland, damals wie heute, der Ansatz einer „Berufsbildung“ oder „Berufsvorbildung“ – wie es bei Jäger heißt – verfolgt wird.
Also doch unser „Learning by doing“ mit ein bisschen Journalistenschule zwischendrin?
Man kann lange darüber streiten, welches der bessere Weg ist. Im Grund haben wir in Deutschland ja beide Modelle: Auf der einen Seite die stark am Beruf ausgerichteten Studiengänge, beispielsweise in Dortmund und Leipzig oder an den Hochschulen Darmstadt und Bremen; auf der anderen Seite die stärker wissenschaftlich ausgerichteten Studiengänge, die wissenschaftliches Wissen über Medien und Journalismus im Sinne eines Orientierungswissens für den späteren Beruf vermitteln.
Ich persönlich halte den zweiten Weg angesichts der hohen Dynamik der Medienentwicklung derzeit für nicht verzichtbar: Universitäten können nicht ein Volontariat ersetzen, und sie sind auch keine Fachhochschulen für die Berufsausbildung.
Hat das zur Folge, dass ein angehender Medienwissenschaftler dem Journalismus fern bleibt, nie in eine Redaktion schaut?
Es spricht überhaupt nichts dagegen, in das zu vermittelnde Orientierungswissen auch die Perspektive der aktuellen Medienpraxis einzubeziehen, sei es durch Lehrbeauftragte aus dem Journalismus, verpflichtende Praktika und medienpraktische Lehrveranstaltungen oder – wie wir das in Trier praktizieren – durch eine Honorarprofessur, die von einem Medienpraktiker und Medienberater besetzt ist.
Gehört die Journalistenausbildung also, wenn überhaupt, an die Fachhochschule? Oder in die großen Akademien der Konzerne wie bei Springer oder RTL?
Viele Wege führen in Deutschland in den Journalismus, und das halte ich für einen Vorteil und keinen Nachteil. Die Anforderungen in den verschiedenen Redaktionen sind auch so unterschiedlich, dass es falsch wäre, den Berufszugang auf ein Modell zu beschränken. Der Redakteur bei der ZEIT braucht andere Qualifikationen als ein Lokaljournalist oder der Video-Reporter für ein Online-Magazin.
Entscheidend ist, dass die Weiterbildungsangebote auch nach dem Abschluss der ersten Phase einer hochschulgebundenen Ausbildung vorhanden sind. Hier würde meine Kritik ansetzen – auch aus der eigenen Erfahrung an einer Journalistenschule: Kaum ein Berufsstand ist so weiterbildungsresistent wie Journalisten. Würde sich das ändern, hätte das gravierende Auswirkungen auf die Qualität der verschiedenen Medienangebote.
Steckt die Journalismus-Forschung bei uns, im Vergleich zu den USA, noch in den Kinderschuhen?
Nein, das Gegenteil erleben Sie immer wieder in Forschungs-Kooperationen und auf internationalen Tagungen: Die Journalismusforschung hat in Deutschland in den letzten 40 Jahren eine eigenständige Entwicklung genommen, mit einer gründlichen theoretischen Fundierung, die es so in den USA nicht gegeben hat. Diese Entwicklung spiegelt sich auch darin, dass für den Journalismus und die Journalismusforschung eine vorbildliche deutschsprachige Einführung- und Fundierungs-Literatur vorliegt.
Wolf Schneider, einer der Großen des Journalismus, rät dringend ab, Germanistik, Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Ein junger Mensch verplempere dafür Jahre seines Lebens. Woher kommt diese weit verbreitete Verachtung des Akademischen im Journalismus?
Ich halte das für keine Mehrheitsmeinung. In ihrer Pauschalität leisten sie auch populistischen, anti-intellektuellen Strömungen Vorschub. Dahinter scheint mir die Auffassung zu stecken, dass Journalismus ein Begabungsberuf ist, den man nicht erlernen kann. Je komplexer die Medienlandschaft wird, umso weniger ist es ausreichend, nur gute Texte schreiben zu können. Im Übrigen hätten Wolf Schneiders Bücher zum journalistischen Schreiben eine bisschen mehr akademisch-linguistisches Basiswissen gut getan.
Sie sind einer der wenigen Professoren, der aus dem Journalismus kommt. Zwar wollten Sie eigentlich Sportlehrer werden, aber gingen nach dem Referendariat in die Wissenschaft, promovierten und lehrten als Dozent am Haus Busch, einer der bedeutenden Ausbildungs-Stätten in den achtziger und neunziger Jahren. Warum volontierten Sie dann noch beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen?
Ich wollte – neben meiner Neugier – wissen, ob meine Ideen für einen guten Journalismus auch praxistauglich sind. Wir hatten an der Journalistenschule das Konzept „Textdesign“ entwickelt – also die Idee, dass Form und Inhalt auch im Journalismus zusammengehören und deshalb Design nicht Verpackungskunst ist, sondern Teil des Journalismus.
Ich hatte bereits während meiner Promotion zu einem Pressethema verschiedene Praktika bei der Lokalzeitung in Tübingen, dem Schwäbischen Tagblatt, absolviert und dabei ein Volontariats-Angebot erhalten, das der damalige Chefredakteur mir für einige Zeit offen gehalten hat. Ich habe das Angebot dann aufgegriffen, da das Schwäbische Tagblatt damals als eine der innovativsten und besten Lokalzeitungen in Deutschland galt.
Die „taz“ beschrieb es 2004 als „eine journalistische Blüte im Sumpf einer von kleinmütigen und buchhalterischen Verlegern beherrschten Zeitungslandschaft“. Die erschien mir als gute Lehrstelle mit den entsprechenden Freiräumen zum Ausprobieren unkonventioneller Ideen – was sich auch bestätigt hat.
„Der Kontrast zum langatmigen wissenschaftlichen Arbeiten kam mir damals sehr entgegen“, zitiert sie die Süddeutsche Zeitung. Haben Sie in den zwei Jahrzehnten als Hochschul-Lehrer die Brücke schlagen können: Weniger langatmig, mehr knapp und hilfreich?
Zumindest kam mir beim Aufbau des Studienganges „Medienwissenschaft“ an der Universität meine journalistische Praxiserfahrung sehr zu Hilfe. Ich hatte ja nach der Zeitung noch als Hörfunkjournalist im Tübinger Landestudio des SWR – der damals noch SWF hieß – gearbeitet und auch journalistische Weiterbildungsseminare an verschiedenen Universitäten und Einrichtungen angeboten.
Sehr früh gelangte dann – dank produktiver Kontakte zu früheren Kollegen an der Journalistenschule – der Online-Journalismus in mein Weiterbildungs-Portfolio, an dem die Relevanz des Konzeptes „Textdesign“ noch offensichtlicher geworden ist: Im Internet ist Design der Schlüssel zum Inhalt. Die Denomination der Trierer Professur als Printprofessur habe ich dann von Beginn auf „Print- und Online-Professur“ ausgeweitet.
Die Trierer Medienwissenschaft war ein der ersten universitären Studiengänge, in denen das Internet zum festen Bestandteil des Curriculums und auch der Forschung gehörte. Insofern: ja die publizistische Praxis hat Eingang in meine akademische Tätigkeit gefunden und auch meine Forschungsinteressen maßgeblich beeinflusst.
Teil 2 folgt
Eine Zusammenfassung des Interviews in meiner Kolumne JOURNALISMUS! auf „kress.de“.
Juli Zeh lässt in ihrem neuen Roman die „Braunschweiger Zeitung“ langsam sterben
Gibt es in einem Jahrzehnt überhaupt noch Tageszeitungen, gedruckt und im Abo? In zeitgenössischer Literatur (noch gedruckt erhältlich) stirbt die Zeitung langsam, sie ist ein Relikt aus alten Zeiten. Juli Zeh schreibt so über die Braunschweiger Zeitung in ihrem neuen Roman „Leere Herzen“, der in der nächsten Woche erscheinen wird. Die Bestseller-Autorin, mit über zwei Dutzend Preisen geehrt, wird oft von Kritikerin gelobt: Sie verfasse die großen Gesellschaftsromane unserer Zeit.
Britta, die Heldin ihres neuen Romans, erfährt abends im Fernsehen von einem Attentat auf dem Leipziger Flughafen, aber sie unterdrückt den Wunsch, Informationen auf ihrem Smartphone zu lesen. „Stattdessen hat sie sich beim Frühstück die Braunschweiger Zeitung gegriffen, die in kleiner Auflage noch immer für nostalgische Ironiker wie Richard gedruckt wird, und auf Seite drei eine knappe Meldung über die Vorgänge in Leipzig gefunden, kurz vor Redaktionsschluss ins Blatt geklemmt. Das Foto kannte sie bereits aus den Nachrichten: schwarze Uniformen in einer Halle, ein länglicher Schatten am Boden. Der Text erzählte genauso wenig wie das Bild.“
Juli Zehs neuer Roman „Leere Herzen“ spielt in Braunschweig, etwa ein Jahrzehnt in der Zukunft, wenn Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, aber Trump noch Präsident der USA. In Deutschland regiert eine rechte Partei, die BBB, der AfD ähnlich. Die Menschen haben keine Visionen und keine Illusionen mehr, sind Pragmatiker.
Die Großstadt ist nicht mehr beliebt bei jungen Erwachsenen, vom Krieg zerstörte Mittelstädte liegen im Trend, „im Geist des Rationalismus wieder aufgebaut“. Britta, die Heldin des Romans, hat begriffen, „dass Großstadt out und Provinz kein Heilmittel für den abgerockten Metropolenwahn ist, da sich kein Übel mit dem Gegenteil kurieren lässt.“ In Braunschweig „gibt es alles, davon aber nicht zu viel“, und es gibt noch die Lokalzeitung.
Britta hat ein Haus in Lehndorf gekauft, „einen Betonwürfel mit viel Glas in einem ruhigen Wohnviertel, praktisch, geräumig, leicht zu reinigen, genau wie Braunschweig selbst, gerade Linien, glatte Flächen, frei von Zweifeln… Wenn man keine Lust hat, sich selbst etwas vorzumachen, ist polierter Beton eben das, was man heutzutage noch lieben kann.“
Offenbar hat Juli Zeh, die selber in der brandenburgischen Provinz lebt, einige Male im Hotel „Deutsches Haus“ gegenüber dem Dom übernachtet, nur ein paar hundert Meter von Verlag und Redaktion der Braunschweiger Zeitung entfernt. In ihrem Roman lässt sie Klienten ihrer Firma im „Deutschen Haus“ übernachten, „auf dessen Fluren es irgendwie nach Sozialismus riecht“.
Braunschweiger dürften sich ärgern, dass ihre Stadt für Britta keine Aura hat, „eine Folge von verkehrsgerechter Entsorgung jeglicher Ästhetik“ ist. „All das stellt eine Erleichterung dar im Vergleich zur klaustrophobischen Pluralität der Metropolen.“
Auf der preisgekrönten Leserseite der Braunschweiger Zeitung könnten empörten Briefe stehen, wie eine Schriftstellerin so über ihre Stadt schreibe; es dürften aber auch zustimmende geben: Der Nachbau des Schlosses, vereint mit einer ECE-Mall, war in der Stadt umstritten, die Zeitung bekam eine Rüge des Presserats, weil sie den Nachbau „Schloss“ nannte. An diese Debatte hängt sich Zeh dran: „An manchen Tagen liebt Britta Braunschweig, den klobigen Prunk totalitärer Prachtbauten, die aussehen wie Schlösser, die in Wahrheit nur Einkaufszentren sind…“
Im Roman geht es um zwei Braunschweiger, die als Terror-Dienstleister in einer Passage am Bahnhof arbeiten.
Eine vorbildliche Reportagen-Reihe: Die 10 Gebote, in die Gegenwart übertragen
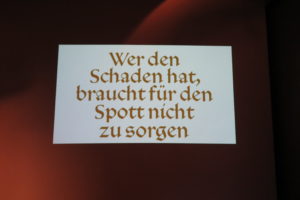
Luthers Beitrag zur Neid-Debatte: Eine Tafel aus der Ausstellung „Luther und die Sprache“ auf der Wartburg 2016
Lasst uns über die Veränderung in der Gesellschaft nachdenken, über den Verlust der Werte! Das gelingt Zeitungen nur sporadisch, sie sind immer noch auf Aktualität ausgerichtet – und je unruhiger die Zeiten, umso mehr konzentrieren sich Zeitungen auf die Aufregung und Erregung des Tages.
Die Braunschweiger Zeitung hat eine nachahmenswerte Idee: Wir produzieren eine Zeitung auch für den Feiertag, an dem die Menschen Zeit und Muße zum Lesen haben, also beispielsweise heute am Reformationstag – nicht über Luther (über ihn gab’s mehr als genug), sondern über Werte, Veränderung und das Beständige, eben über das, was auch immer wieder Luthers Thema war.
Auf 22 Seiten, nahezu frei von Anzeigen, geht es um Werte und Wandel – allerdings nur am Rande mit Analysen, Theorien und Wertungen. Die Reporterin Katrin Schiebold erzählt auf der Hälfte der Seiten von Menschen: Was verändern sie? Wie werden sie verändert? Was macht ihnen Mut? Was lässt sie verzweifeln?
Der rote Faden ist ein uralter Werte-Kanon: Die Zehn Gebote – auf einer Seite geht es um je ein Gebot, wird ein altes Gesetz in die Gegenwart und ihre Geschichten übertragen:
1 – Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Die Reporterin trifft sich mit Christen und Atheisten und lässt sie erzählen: Warum glaubt ein Mensch? Warum widersteht er?
Das 2. Gebot, das wohl schwierigste: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.“
Katrin Schiebold erzählt von Jugendlichen, die den Verlockungen von Islamisten erliegen, und ihren Familien.
3 – Du sollst den Feiertag heiligen.
Ein Pfarrer und ein Ex-Fußballprofi von Eintracht Braunschweig erzählen, warum der Sonntag als Ruhetag wichtig ist. Docj die Gesellschaft ist gespalten: Viele Geschäfte wollen am liebsten jeden Sonntag öffnen.
4 – Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Wie geht es Kindern, die nur noch Mutter oder Vater stets in ihrer Nähe haben oder vom Jugendamt „erzogen“ werden.
5 – Du sollst nicht töten.
Eine Oberstaatsanwältin versucht zu verstehen, warum Menschen töten. Es sind erzählende Sätze wie diese, die den Wert der Reportagen ausmachen, kühl, aber nicht kalt, nicht wertend, denn dies gelingt dem Leser besser im Gespräch mit sich selbst:
Der Angeklagte hält sein Holzkreuz in den Händen, er zeigt keine Reue, kaum eine Regung. Dabei wäre das so wichtig gewesen für seine zehn Kinder, die während des gesamten Prozesses vor dem Braunschweiger Landgericht vergeblich auf eine Erklärung des 54-Jährigen warten. Warum hat er ihre Mutter in der katholischen Kirche in Braunlage getötet? Warum hat er versucht, sie mit Medikamenten zu vergiften, schließlich das Gewehr auf sie gerichtet und geschossen, warum hat er einen seiner Söhne und seine zwölfjährige Tochter dazu gezwungen, das Blut wegzuwischen und die Leiche fortzuschaffen? Warum macht ein Mensch so etwas?
Warum?
Es gibt Taten, die so grausam sind, dass sie selbst routinierte Kriminalisten und Ermittler fassungslos machen. Der Mord an der Küsterin in Braunlage vor fünf Jahren gehört dazu. Kirsten Böök hatte damals als Oberstaatsanwältin die Ermittlungen geleitet. „Der Fall war auch deshalb so ungeheuerlich, weil der Täter eiskalt vorging“, sagt sie. Er habe seine Kinder instrumentalisiert, sie dazu gezwungen, die Spuren seiner Tat zu beseitigen. Außerdem habe er seinen Sohn belastet, um die Schuld von sich zu nehmen.
6 – „Du sollst nicht ehebrechen“.
Eine Wolfsburger Standesbeamtin erzählt von der Trauung – und ein Braunschweiger Familienrichter von Scheidungen.
7- „Du sollst nicht stehlen.“
Vom Datendiebstahl berichtet ein Verfassungsschützer in einem Interview.
8 – „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“
Cybermobbing trifft viele junge Menschen, aber nicht nur sie. Wer Opfer wird, kann sich nur schwer von der Schmach befreien.
Paul und Celina sind ein Paar, doch dann trennt sich der 16-Jährige von seiner Freundin, weil er eine andere kennengelernt hat. Für Celina bricht eine Welt zusammen, sie ist gekränkt, verletzt, eifersüchtig. Abends sitzt sie in ihrem Zimmer, sucht nach einem Ventil, ihrer Wut und Verzweiflung Luft zu machen. Sie nimmt ihr Smartphone, öffnet eine WhatsApp-Gruppe und tippt: ,Paul hat mich vergewaltigt.‘ Der Satz verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Es kommt zu strafrechtlichen Ermittlungen. Am Ende stellt sich heraus: An dem Vorwurf ist nichts dran, Celina hat sich dafür rächen wollen, dass Paul sie verlassen hat. Doch der Vorwurf ist in der Welt.“
9 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.“
Ein Neidforscher erklärt, warum sich Menschen ständig miteinander vergleichen – und wann ein Vergleich zum Neid wird.
10 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat“.
Partnervermittlungen im Internet – und der Seitensprung, der doch die Ausnahme ist.
Eine Reportagen-Reihe – zum Nachahmen empfohlen – nicht nur an Feiertagen. Wer keine komplette Ausgabe damit produzieren kann, dem ist eine Serie über Tage und Wochen zu empfehlen. Sie kommt den Lesern sogar mehr entgegen: Wie viele nehmen sich die Zeit, stundenlang eine Zeitung zu lesen, prall mit exzellenten Geschichten gefüllt?
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?














 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von