Der neue Verleger der „New York Times“ begann als Lokalreporter in einem Fischerdorf
Eigentlich wollte Arthur Gregg Sulzberger, der neue Verleger der New York Times, kein Journalist werden – bevor ihn seine Professorin überredete, für zwei Jahre in der Lokalzeitung eines Fischerdorfs an der Küste zu arbeiten. Sulzberger stand kurz vor seinem Abschluss in Politikwissenschaft, als er in seiner Klasse auf die Professorin Tracy Breton traf, die gleichzeitig eine investigative Reporterin beim Providence Journal war (was in USA nicht ungewöhnlich ist). Tracy Breton, die schon einen Pulitzer-Preis gewonnen hatte, war eine großartige Reporterin, erzählt Sulzberger in einem Interview mit dem New Yorker. Sie weckte die Leidenschaft für den Journalismus – „ich liebte einfach ihre Art zu schreiben.“
Den Moment, in dem er den Journalismus für sich entdeckte, beschreibt Sulzberger so: „Am Ende eines zweistündigen Gesprächs sagte Tracy: ‚ Arthur, ich habe einen Job für dich im Providence Journal. Es ist ein zweijähriges Praktikum, und ich möchte, dass du es machst: Narragansett ist eine kleine Stadt im Süden von Rhode Island.’“
Doch Sulzberger wehrte sich: „Ich werde meine Karriere mit anderen Dingen beginnen.“ Tracy überredete ihn: „Wenn du es nicht versuchst, wirst du dich immer wundern.“ Er versucht es, wird Stadtreporter, berichtet über Stadtrats-und Schulrats-Ssitzungen, ruft jeden Morgen den Polizeichef an und fragt, was über Nacht passiert sei.
„Die ersten drei Monate waren hart“, erzählt Sulzberger, „denn die Aufgabe des Reporters ist es, allen anderen etwas zu erklären. Aber wann immer Sie einen neuen Job beginnen, wissen Sie genau, wie viel Sie nicht wissen.“ Aber er bekam Lust darauf, einen halben Tag mit den Leuten zu reden, herauszufinden, was in der Welt vor sich geht, und den anderen halben Tag alleine eine Geschichte zu schreiben. „Ich liebte einfach den Rhythmus der Tage.“
Es folgten weitere Stationen beim Oregonian und in den Great Plains als Chef der Times Kansas-Stadt-Redaktion, wo er Aufsehen erregt mit der Reportage eines Vegetarier im „Mekka des Fleisches“. David Remnick erinnert sich im New Yorker: „An Arthur Bryants berühmtem Grillplatz lehnte er die Rinderbrust und die mit Schmalz gefüllten Pommes Frites ab und trank ein Budweiser (Bud) zum Mittagessen. Trotz der Größe der Schlagzeile konnten fleischfressende Leser nicht umhin, Sympathie für ihren selbstverleugnenden Korrespondenten zu empfinden.“
Neujahr wurde A.G. Sulzberger Verleger der New York Times als sechstes Mitglied der Familien-Dynastie Ochs-Sulzberger, die 1896 die Zeitung gekauft hatte.
Mehr in meiner Kolumne JOURNALISMUS! bei kress.de.
Journalisten müssen mehr moderieren – Interview mit Medien-Professor Hans-Jürgen Bucher (Teil 1)
Hans-Jürgen Bucher war der erste Professor, als vor zwanzig Jahren die „Medienwissenschaft“ in Trier gegründet wurde. Zum Jubiläum, das am Samstag (27. Januar 2018) gefeiert wird, sprach ich mit Professor Bucher über das Verhältnis von Medienwissenschaft und Journalisten, die Ausbildung von Journalisten in den USA und in Deutschland sowie den Unwillen von Journalisten an der Weiterbildung.
Herr Professor Bucher, Medienwissenschaftler und Journalisten in Deutschland scheinen in verschiedenen Welten zu leben. Was läuft da schief?
Nichts, ich sehe darin kein Problem, sondern eine Chance: Journalisten und Medienwissenschaftler müssen in zwei verschiedenen Welten leben. Täten sie das nicht, würden sich die wechselseitige Kritik und Befruchtung aufheben. Journalismus unterliegt z.B. der Aktualitätsmaxime, was für die Wissenschaft nicht gelten kann, die an langfristigen Erkenntnissen – genannt Grundlagenforschung – interessiert sein muss. Journalismusforschung ohne Distanz zum Journalismus ist rein logisch gar nicht möglich – wenn sie nicht zur Reportage über Journalisten verkommen möchte (was es natürlich auch manchmal gibt).
Das hört sich nett an: Wechselseitige Befruchtung. Die setzt aber Begegnung voraus: Wie kommen nun Medienwissenschaftler und Journalisten in einen Dialog?
Zum Beispiel dadurch, dass man sich gegenseitig zu Tagungen einlädt, wie wir das in der Trierer Medienwissenschaft bei einer Tagung zur journalistischen Qualität getan haben. Auch anwendungsorientierte Forschungsprojekte in Kooperation mit Redaktionen sind ein guter Weg, in einen Dialog zu kommen. Wir haben das bei verschiedenen Relaunch-Projekten von Zeitungen ebenso praktiziert wie bei der Evaluierung von Online-Angeboten.
Sie lehrten als Gastprofessor in den USA, wo die Kommunikation zwischen Redaktionen und Wissenschaft alltäglich ist. Dort werden alle Redakteure an Universitäten ausgebildet. Wäre das ein Vorbild für uns?
Diese Frage wird für die Journalistenausbildung in Deutschland gestellt, seit sich Karl Jäger und Emil Dovifat in den 1920er-Jahren mit den viel älteren US-amerikanischen Universitäts-Curricula für Journalisten befasst haben. Beide haben darauf hingewiesen, dass bei einem Vergleich der Ausbildungswege auch die Unterschiede zwischen den Journalismus-Kulturen in den beiden Ländern zu berücksichtigen sind.
Beide beurteilen demzufolge die universitäre Journalisten-Ausbildung in den USA als „Drill“ und „Berufsausbildung“, während in Deutschland, damals wie heute, der Ansatz einer „Berufsbildung“ oder „Berufsvorbildung“ – wie es bei Jäger heißt – verfolgt wird.
Also doch unser „Learning by doing“ mit ein bisschen Journalistenschule zwischendrin?
Man kann lange darüber streiten, welches der bessere Weg ist. Im Grund haben wir in Deutschland ja beide Modelle: Auf der einen Seite die stark am Beruf ausgerichteten Studiengänge, beispielsweise in Dortmund und Leipzig oder an den Hochschulen Darmstadt und Bremen; auf der anderen Seite die stärker wissenschaftlich ausgerichteten Studiengänge, die wissenschaftliches Wissen über Medien und Journalismus im Sinne eines Orientierungswissens für den späteren Beruf vermitteln.
Ich persönlich halte den zweiten Weg angesichts der hohen Dynamik der Medienentwicklung derzeit für nicht verzichtbar: Universitäten können nicht ein Volontariat ersetzen, und sie sind auch keine Fachhochschulen für die Berufsausbildung.
Hat das zur Folge, dass ein angehender Medienwissenschaftler dem Journalismus fern bleibt, nie in eine Redaktion schaut?
Es spricht überhaupt nichts dagegen, in das zu vermittelnde Orientierungswissen auch die Perspektive der aktuellen Medienpraxis einzubeziehen, sei es durch Lehrbeauftragte aus dem Journalismus, verpflichtende Praktika und medienpraktische Lehrveranstaltungen oder – wie wir das in Trier praktizieren – durch eine Honorarprofessur, die von einem Medienpraktiker und Medienberater besetzt ist.
Gehört die Journalistenausbildung also, wenn überhaupt, an die Fachhochschule? Oder in die großen Akademien der Konzerne wie bei Springer oder RTL?
Viele Wege führen in Deutschland in den Journalismus, und das halte ich für einen Vorteil und keinen Nachteil. Die Anforderungen in den verschiedenen Redaktionen sind auch so unterschiedlich, dass es falsch wäre, den Berufszugang auf ein Modell zu beschränken. Der Redakteur bei der ZEIT braucht andere Qualifikationen als ein Lokaljournalist oder der Video-Reporter für ein Online-Magazin.
Entscheidend ist, dass die Weiterbildungsangebote auch nach dem Abschluss der ersten Phase einer hochschulgebundenen Ausbildung vorhanden sind. Hier würde meine Kritik ansetzen – auch aus der eigenen Erfahrung an einer Journalistenschule: Kaum ein Berufsstand ist so weiterbildungsresistent wie Journalisten. Würde sich das ändern, hätte das gravierende Auswirkungen auf die Qualität der verschiedenen Medienangebote.
Steckt die Journalismus-Forschung bei uns, im Vergleich zu den USA, noch in den Kinderschuhen?
Nein, das Gegenteil erleben Sie immer wieder in Forschungs-Kooperationen und auf internationalen Tagungen: Die Journalismusforschung hat in Deutschland in den letzten 40 Jahren eine eigenständige Entwicklung genommen, mit einer gründlichen theoretischen Fundierung, die es so in den USA nicht gegeben hat. Diese Entwicklung spiegelt sich auch darin, dass für den Journalismus und die Journalismusforschung eine vorbildliche deutschsprachige Einführung- und Fundierungs-Literatur vorliegt.
Wolf Schneider, einer der Großen des Journalismus, rät dringend ab, Germanistik, Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Ein junger Mensch verplempere dafür Jahre seines Lebens. Woher kommt diese weit verbreitete Verachtung des Akademischen im Journalismus?
Ich halte das für keine Mehrheitsmeinung. In ihrer Pauschalität leisten sie auch populistischen, anti-intellektuellen Strömungen Vorschub. Dahinter scheint mir die Auffassung zu stecken, dass Journalismus ein Begabungsberuf ist, den man nicht erlernen kann. Je komplexer die Medienlandschaft wird, umso weniger ist es ausreichend, nur gute Texte schreiben zu können. Im Übrigen hätten Wolf Schneiders Bücher zum journalistischen Schreiben eine bisschen mehr akademisch-linguistisches Basiswissen gut getan.
Sie sind einer der wenigen Professoren, der aus dem Journalismus kommt. Zwar wollten Sie eigentlich Sportlehrer werden, aber gingen nach dem Referendariat in die Wissenschaft, promovierten und lehrten als Dozent am Haus Busch, einer der bedeutenden Ausbildungs-Stätten in den achtziger und neunziger Jahren. Warum volontierten Sie dann noch beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen?
Ich wollte – neben meiner Neugier – wissen, ob meine Ideen für einen guten Journalismus auch praxistauglich sind. Wir hatten an der Journalistenschule das Konzept „Textdesign“ entwickelt – also die Idee, dass Form und Inhalt auch im Journalismus zusammengehören und deshalb Design nicht Verpackungskunst ist, sondern Teil des Journalismus.
Ich hatte bereits während meiner Promotion zu einem Pressethema verschiedene Praktika bei der Lokalzeitung in Tübingen, dem Schwäbischen Tagblatt, absolviert und dabei ein Volontariats-Angebot erhalten, das der damalige Chefredakteur mir für einige Zeit offen gehalten hat. Ich habe das Angebot dann aufgegriffen, da das Schwäbische Tagblatt damals als eine der innovativsten und besten Lokalzeitungen in Deutschland galt.
Die „taz“ beschrieb es 2004 als „eine journalistische Blüte im Sumpf einer von kleinmütigen und buchhalterischen Verlegern beherrschten Zeitungslandschaft“. Die erschien mir als gute Lehrstelle mit den entsprechenden Freiräumen zum Ausprobieren unkonventioneller Ideen – was sich auch bestätigt hat.
„Der Kontrast zum langatmigen wissenschaftlichen Arbeiten kam mir damals sehr entgegen“, zitiert sie die Süddeutsche Zeitung. Haben Sie in den zwei Jahrzehnten als Hochschul-Lehrer die Brücke schlagen können: Weniger langatmig, mehr knapp und hilfreich?
Zumindest kam mir beim Aufbau des Studienganges „Medienwissenschaft“ an der Universität meine journalistische Praxiserfahrung sehr zu Hilfe. Ich hatte ja nach der Zeitung noch als Hörfunkjournalist im Tübinger Landestudio des SWR – der damals noch SWF hieß – gearbeitet und auch journalistische Weiterbildungsseminare an verschiedenen Universitäten und Einrichtungen angeboten.
Sehr früh gelangte dann – dank produktiver Kontakte zu früheren Kollegen an der Journalistenschule – der Online-Journalismus in mein Weiterbildungs-Portfolio, an dem die Relevanz des Konzeptes „Textdesign“ noch offensichtlicher geworden ist: Im Internet ist Design der Schlüssel zum Inhalt. Die Denomination der Trierer Professur als Printprofessur habe ich dann von Beginn auf „Print- und Online-Professur“ ausgeweitet.
Die Trierer Medienwissenschaft war ein der ersten universitären Studiengänge, in denen das Internet zum festen Bestandteil des Curriculums und auch der Forschung gehörte. Insofern: ja die publizistische Praxis hat Eingang in meine akademische Tätigkeit gefunden und auch meine Forschungsinteressen maßgeblich beeinflusst.
Teil 2 folgt
Eine Zusammenfassung des Interviews in meiner Kolumne JOURNALISMUS! auf „kress.de“.
Vier wichtige Fragen in einem Vorstellungsgespräch
Diese Fragen dürften Chefredakteure und Ressortleitern helfen, Redakteure und Mitarbeiter zu finden, die gut sind und vor allem in das Team passen. Sie hat David Walker, Chef einer Immobilienfirma, aus tausend Vorstellungsgesprächen gefiltert:
- Wie hat Sie das Arbeitsklima beim vorangegangenen Arbeitgeber motiviert oder nicht motiviert?
Sprecht der Bewerber auf Kommando schlecht über das alte Arbeitsverhältnis? Oder kann er dem schlimmsten Arbeitgeber etwas Gutes abgewinnen?
- Wie war der beste Chef, den Sie jemals hatten?
Mag er ein Arbeitsklima, das offen ist, und bei dem der Austausch mit dem Chef sehr wichtig ist? Oder bevorzugt er direkte Anweisungen und einseitige Kommunikation?
- Wie haben Sie in der Vergangenheit einen Konflikt mit einem Kollegen gelöst?
Kandidaten sind ehrlicher, wenn sie über eine reale Situation sprechen. Egal wie toll das Arbeitsklima ist: Konflikte wird es immer geben.
- Wie oft möchten Sie Feedback erhalten und wie?
Heißt Feedback eine Messung seiner Leistung? Oder geht es auch um zwischenmenschliche Beziehungen? Denkt er, dass einmal im Jahr völlig ausreicht? Oder will er wöchentlich Feedback?
Quelle: Valentina Resetarits, Business Insider,1. August 2017)
Der Braunschweiger Fotograf Thomas Ammerpohl ist tot: Greenpeace, Movimentos Ballett und WHO in Afrika

Der Fotograf Thomas Ammerpohl in Äthiopien, von Kindern umringt, denen er seine und ihre Bilder zeigt. Foto: Raue
Der Braunschweiger Fotograf Thomas Ammerpohl ist am Montagabend gestorben (13. November 2017); Ende Mai hatte er mit vielen Freunden und Bekannten noch seinen 70. Geburtstag im „Deutschen Haus“ gegenüber vom Braunschweiger Dom gefeiert.
Ammerpohl war ein Fotograf in der Provinz, aber seine Professionalität war alles andere als provinziell. Er, im Harz geboren, mochte seine Heimat, das Braunschweiger Land; er arbeitete erst als Krankenpfleger und Zahntechniker, dann über Jahrzehnte regelmäßig für die „neue braunschweiger“ (nb), er ging zu Kaninchenzüchtern und Ordensverleihungen, zur Goldkonfirmation ebenso wie zum Kreisliga-Fußball – und war beliebt bei den Menschen, die wir gerne die „einfachen“ nennen. Er fotografierte stets frei – aus Überzeugung – für dpa und für Zeitungen, auch internationale.
Er beeindruckte die Leser der Braunschweiger Zeitung mit seinen Ballett-Fotos von den Movimentos-Festspielen in Wolfsburg und bekam dafür in Wien einen europäischen Zeitungspreis: „European Newspaper Award – Excellence“.
Er fühlte sich in der Welt zu Hause, fuhr mit seinem Freund, dem Domprediger Joachim Hempel, fotografierend durch das Morgenland, in dem das Abendland gegründet ist; er reiste Dutzend Male durch Palästina, Syrien, Arabien, Afrika und den Kaukasus. Ihn faszinierten weniger die alten Steine als die Menschen, denen er begegnete. Immer hatte er ein Bündel einheimischer Geldscheine in der Tasche: Wenn er Menschen porträtierte, fragte erst um Erlaubnis und gab dann das Geld – ein Geschäft aus Respekt und auf Gegenseitigkeit.
Wo er saß, war er von Kindern umgeben: Er fotografierte sie und zeigte ihnen auf dem Display die Bilder, er ließ sie staunen und staunte selber. Zu Beginn seiner Laufbahn war er Anfang der achtziger Jahre Fotograf bei Greenpeace; in den neunziger Jahren und darüber hinaus dokumentierte er Leprakranke im Senegal, beauftragt von der WHO.
Auch in der Kultur, die ihn ein Leben lang faszinierte, waren es die Künstler, die ihn anzogen: Zum einen beim Staatstheater Braunschweig, aber noch intensiver weltweit. Mehr als hundert internationale Ballett- und Modern-Dance-Ensembles aus 18 Nationen engagierten ihn; er fotografierte bei Tanz- und Theaterfestivals in Amsterdam, Barcelona, Paris, London, Kasan, Moskau, St. Petersburg und Hamburg, Hannover, München, aber auch in New York – und vor allem beim Movimentos-Festival der Wolfsburger Autostadt von VW.
Auf Ausstellungen wurden seine Werke gezeigt, in Braunschweig, Hannover und Hamburg. Über eine Reihe von Ehrungen konnte er sich freuen: Silbermedaille der schönen Künste bei der Foto-Biennale in Mouscron/Belgien, FIAP-Award-Goldmedaille und mehrfach Gold-, Silber- und Bronze beim Hasselblad Austrian Super Circuit in Linz/Österreich.
Auch die Bilder in dem Buch „Der Domprediger“ stammen von Thomas Ammerpohl: Das große Interview zum Abschied von Joachim Hempel.
Die Beisetzung findet am Samstag, 18. November, um 11 Uhr auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof statt.
Die digitale Fastenzeit der Journalisten: Eine Zeit ohne Smartphone
Stellt Eure Smartphones aus! Vergesst die Mails! Lasst Eure Seele offline gehen! Mit diesen Befehlen beginnen Manager-Seminare, die tausend Euro und mehr kosten. Manager lernen ein Wort, das vor fünfzig Jahren noch nicht einmal erfunden war: „Entschleunigung“. Erfunden hat’s – ein Psychologe, wer denn sonst.
Doch Entschleunigung ist auch bei Journalisten ein Thema, die unzählige Male am Tag auf ihr Smartphone schauen und selbst in der Nacht bei schlafstörendem Harndrang erst einmal den Bildschirm leuchten lassen. Entschleunigung soll dem Infarkt vorbeugen und dem Burnout; für beides gibt es prominente Vorbilder:
Peter Huth war mit Anfang dreißig Redaktionschef bei Bild, arbeitete in der Regel zwölf Stunden und wachte an einem Sommermorgen auf: Herzinfarkt, Notoperation, gerade mal so das Leben gerettet. Er schrieb das Buch seiner „Betriebsstörung“: „Infarkt“. Darin beschreibt er die Manager, mit denen er in der Reha-Klinik an der Ostsee entschleunigen muss: „Die Manager wundern sich kein Stück, dass sie hier sind. Es ist sogar eher so, als hätten sie ihre Taschen zur Abreise schon vor langer Zeit gepackt, so wie eine Schwangere für die Nacht der Entbindung.“
Miriam Meckel war zehn Jahre älter im Vergleich zu Peter Huth, als sie mit einem Burnout zusammenklappte: „Ich war fünfzehn Jahre um die Welt gereist, hatte gearbeitet, geredet, geschrieben, akquiriert, repräsentiert, bis der Arzt kam. Im Wortsinne. Ich habe keine Grenzen gesetzt, mir selbst nicht und auch nicht meiner Umwelt, die zuweilen viel verlangt, mich ausgesaugt hat wie ein Blutegel seinen Wirt.“ Die heutige Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, ab April Herausgeberin, war jüngste Professorin in Deutschland gewesen, Staatssekretärin – eben erfolgreich, wo auch immer sie antrat. In der Reha schrieb auch sie ihr Buch: „Brief an mein Leben. Erfahrungen mit einem Burnout“.
Spätestens seit Huth und Meckel wissen Journalisten, wie mörderisch ihr Beruf sein kann. Dabei erkennen sie besser als andere Bürger: Wir sind überinformiert! Wir hecheln den Nachrichten hinterher, dass es eine Sucht wird.
Journalisten rechtfertigen noch die Hatz, die schlechten Stress erzeugt, die Seele ermatten lässt und Familie wie Freunde verstört: Es ist unser Job, wir müssen ständig auf dem Laufenden sein und reagieren. Müssen wir das wirklich? Nahezu rund um die Uhr?
Nein, es wird Zeit zu fasten – wie das alte Wort für „entschleunigen“ lautet. Im analogen Zeitalter fasteten die Menschen, indem sie auf Whiskey, Wein oder Schwarzwälder Kirschtorte verzichteten, auf Zigaretten oder Hasch. Im digitalen Zeitalter machen uns kleine Geräte, unentwegt eingeschaltet, das Leben schwerer als jede Völlerei.
Diese Fragen stellen sich Journalisten vor der digitalen Fastenzeit: Brauche ich alle Information jederzeit? Oder reichen einige Stunden am Tag? Kann ich sogar einen Tag lang verzichten? Ein Wochenende und einen freien Tag lang? Und welche Informationen brauche ich unbedingt? Wieviel Überraschung plane ich ein?
Man muss kein gläubiger Mensch sein, um zu fasten. Man kann die Bücher von Huth und Meckel lesen oder in den Arzt-Berichten nach einem gründlichen Check. Oder man blättert im großen Geschichtenbuch des Abend- und Morgenlands und findet in der Bibel einen Spruch von Jesus, der seinen Freunde am Ölberg den guten Rat gab: „Seht zu, dass Euch nicht jemand verführe. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei: Seht zu und erschreckt nicht. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort.“
Lasst Euch nicht verführen! Der Rat ist auch zweitausend Jahre später von Gewinn. Und NSA, CIA und andere mehr, die gerne in Handys von Journalisten spionieren, haben zudem keine Chance mehr, wenn alles ausgeschaltet ist.
**
Mehr in der Journalismus!-Kolumne auf Kress.de: „Die Fastenzeit der Journalisten: Entschleunigt Euch!“
Feuilletonisten: Gralshüter, die nicht verstanden werden wollen

Zeitungsleser in Nepal, umgeben von Klangkörpern: Feuilletonisten wollen für die Elite der Elite schreiben. Foto: Paul-Josef Raue
Feuilletonisten schreiben zuerst für andere Feuilletonisten, für Künstler und Kulturmanager, bisweilen auch für Theater- und Ausstellungsbesucher. Feuilletonisten bleiben unter sich, die meisten jedenfalls. In der Redaktion gelten sie als nett, aber schwierig, sie sind Außenseiter. Ein garstiges Vorurteil?
Viele Feuilletonisten stimmten zu, sie schätzen diesen Status des einsamen, aber freien Nachdenkenden, ja sie genießen ihn und wollen Lichtjahre entfernt vom Rest ihrer Redaktion wirken und schreiben. Sie kümmert es kaum, dass nur wenige Abonnenten ihre Rezensionen lesen; sie sind selbstbewusst: Wir schreiben für die wichtigen Leser!
Sie wissen, was Kultur ist, und bauen einen Gral, zu deren Hüter sie sich selbst erwählen. „Der typische deutsche Kulturredakteur möchte von Hinz und Kunz gar nicht verstanden werden“, schrieben wir im Handbuch des Journalismus.
Der weibliche Nachwuchs des Journalismus, weniger der männliche, antwortet im Bewerbungsgespräch auf die Frage nach den Vorlieben: Die Kultur, vorzugsweise. Doch Vorsicht: Die meisten Feuilletonisten schreiben in ihrer eigenen Sprache, schreiben schwer verständliche Texte – eben Tagesliteratur für Eingeweihte, die zwar auch nichts verstehen, aber das Erhabene fühlen.
Wer etwa vom großen Gerhard Stadelmaier das Schreiben lernte, der dürfte für andere Ressorts kaum mehr tauglich sein. Gerhard Stadelmaier, Professor für Theaterkritik, war oberster Theaterkritiker der FAZ, der Texte schrieb, die Germanisten in ihren Seminaren als hermetisch loben würden. Unter Seinesgleichen ist er geachtet und bewundert, auch im Ruhestand, in dem er einen Roman schrieb über die Redaktion der „Staatszeitung“, die der FAZ ähnelt, und die „Verflüssigung der Zeitung“, die an Qualität verliere und an Sprachkraft.
Jan Küveler nennt ihn in der Welt einen der „begnadesten Vertreter“, lobt ihn für seine bildkräftige Sprache, für Formulierungen wie „hirnwütiger Quecksilberbubi“ oder „zentnerschwere Langeweile“. Stadelmaier ist mehrfach preisgekrönt für seine „leichte und doch gewichtige Sprache“; vor einigen Wochen verlieh ihm in Weimar eine Stiftung, die die „Reinheit der deutschen Sprache“ pflegt, den „Deutschen Sprachpreis“.
Man könnte ihm noch einen Preis verleihen – für den längsten Satz, den wohl je ein Journalist geschrieben hat: 208 Wörter lang (nach der Word-Wörterzählung). Der rekordverdächtige Satz war schon einmal Thema in diesem Blog:
Am 17. Juni 2013 druckte die FAZ die Besprechung einer Trauerfeier im Stil einer Rezension: Walter Jens wurde in Tübingen zu Grabe getragen, und Gerhard Stadelmaier schrieb darüber. Da wenig gesprochen und viel Mozart gespielt wurde, schrieb der Kritiker über Jens‘ Beziehung zu Mozart und verlor sich dabei in einem Satz mit 208 Wörtern und fast 1500 Zeichen! Der Satz taugt für jeden Volontärskurs: Wie zertrümmere ich einen Schachtelsatz? Wer findet den Hauptsatz (in der die Hauptsache stehen soll)?
Die Mühe des Zertrümmerns dürfte allerdings vergeblich sein: Der Satz ist nicht redigierbar.
**
Die komplette JOURNALISMUS!-Kolumne zum Thema: https://kress.de/news/detail/beitrag/136591-208-woerter-ein-sprachpreis-fuer-den-laengsten-satz.html
Vorschlag einer Wirtschafts-Professorin: Non Profit-Medien, um die Demokratie zu retten
Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?
Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.
Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.
Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.
Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.
Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.
Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.
Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.
Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:
-
Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.
-
Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.
Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:
-
Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)
-
und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).
In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.
Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?
Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“
Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.
Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:
-
Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?
-
Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?
-
Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?
**
Quellen:
Wie organisiert sich eine Redaktion am besten? (Serie 6: Die Zukunft des Journalismus)

Joachim Braun, Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse, fotografiert auf Facebook die „Flure“ in seiner neuen Redaktion serienweise
Ein Blick zurück und in andere Länder lohnt: In den dreißiger Jahren flogen Brieftauben die Filmrollen in die Redaktion; in den angelsächsischen Ländern rund um den Globus gab und gibt es schon immer die klare Trennung von Recherche und Redigieren, Reportern und Blattmachern; in Deutschland gingen Journalisten nach dem Krieg einen Sonderweg, auf dem der Redaktroniker, vornehmlich in Lokalredaktionen, heimisch wurde. Der deutsche Redakteur arbeitete in seiner Denkerstube, in die er über lange Flure kam: Man sah sich nur in den langen Konferenzen.
Weil sich immer mehr Leser im Internet informieren, scheint sich auch bei uns der gemeinsame Zeitungs- und Online-Desk, der angelsächsisch geprägte Newsdesk, durchzusetzen.
Damit lösen Chefredakteure viele Probleme, aber schaffen neue: Die Zeitungsredakteure übernehmen schnell wieder das Kommando, so dass Online weiter Stiefkind bleibt inklusive der sozialen Netzwerke.
Zudem geht es in dieser Folge über die Zukunft des Journalismus auch über die Zukunft der Demokratie: Wer kontrolliert noch den Landrat, erst recht die Bürgermeister in den kleinen Gemeinden, wenn eine ausreichend große Lokalredaktion nicht mehr zu finanzieren ist?
Kleine und mittlere Zeitungen in der Provinz, so sie noch selbständig sind, haben die besten Überlebens-Chancen. Gehen sie in einem Konzern auf, verliert erst das Lokale im Wirbel der Synergien und verschwinden schließlich die Leser
**
Der komplette Text: „Die Organisation der Redaktion“ – Teil 6 der Reihe von Paul-Josef Raue zur Zukunft des Journalismus, hier:
Was Headhunter raten: Ein Redakteur wäre auch ein guter Zielfahnder
Was können Journalisten besonders gut – und besser als andere Berufsgruppen? Wo finden sie Jobs, wenn die Redaktionen immer kleiner werden? Vor zwei Jahren gab der Headhunter Stefan Koop von „Amrop Delta“ dazu der Wirtschaftswoche ein Interview.
Wer sich mit Headhuntern einlässt oder einlassen muss, wer wissen will, wie sie über Journalisten denken, dem sei das Interview empfohlen. Hier die entscheidenden Passagen:
Welche Fähigkeiten zeichnen Redakteure aus? Koop:
Die können zunächst mal mit Sprache umgehen. Sie können Sachverhalte recherchieren, Fragen stellen und vor allem eins: zeitgenau abliefern. Das ist schon mal viel, was nicht jeder kann. Sie können unter Stress arbeiten und hartnäckig sein. Sie sind gewohnt, im Team zu funktionieren und müssen schnelle Entscheidungen treffen und dabei ihren intellektuellen Überblick permanent ausbauen.
Man liest es mit Freuden, auch wenn man sich wundert über des Headhunters Fähigkeit, mit Sprache „umzugehen“: Wie kann man einen Überblick ausbauen? Und dann noch einen intellektuellen? Ist ein ausbaufähiger Überblick nicht eher ein Unterblick?
Welche Jobs kommen für Redakteure infrage? Koop favorisiert Risikomanagement oder Market Research bei Financial Services. Und weiter:
- Wenn man ganz breit denkt, kommen natürlich auch die Polizei, Bundeswehr, Ministerien und Nachrichtendienste in den Sinn. Hier gilt es auch, eigene Barrieren im Kopf zu überwinden.
- Welcher Journalist hat sich schon einmal bei einer Top Unternehmensberatung beworben. Auch hier muss analysiert, recherchiert, bewertet und geschrieben werden.
- Themen wie Marktforschung sind natürlich auch naheliegend.
Die Berufe, in die Redakteure oft wechseln, tauchen nicht auf: Pressesprecher, PR-Manager, Kommunikations- und/oder Marketingchefs. Allerdings empfiehlt Koop Fachverlage und Fachpublikationen – mit einem starken Argument: Sie haben den Wechsel in die Online-Welt besser geschafft als der klassische Verlagsbereich.
Zudem empfiehlt Koop die Existenz als freier Journalist – „wenn man einen eigenen USP hat. Die Redaktionen werden immer kleiner und brauchen dringend Unterstützung von außen“. Dem Headhunter ist bewusst, dass der freie Journalist – und nicht nur er – beim Geldverdienen Abstriche machen muss. Koop drückt es diplomatisch aus:
Wichtig ist, auch in der eigenen Gehaltsfindung flexibel zu sein. Der Journalist zählt immer noch zu den besser bezahlten Gruppen. Da sollte man sich interessante Neueinstiege mit Perspektive nicht verbauen.
Man kann auch Oberbürgermeisterin werden oder Aufsichtsrats-Vorsitzender beim HSV, nennt Koop noch „ganz anderen Felder“: Als das Interview gedruckt wurde, war die Zeit-Redakteurin Susanne Gaschke noch Oberbürgermeisterin in Kiel und Spiegel-Redakteur Manfred Ertel noch beim HSV. Die ganz anderen Felder waren allerdings zu morastig. Beide rutschten aus.
Und da wäre noch ein Job im Angebot des Headhunters:
Googeln sie mal den Begriff „Zielfahnder“, und sie werden viele Überschneidungen sehen zum Investigativ-Journalisten. Gerade der Wirtschaftsjournalist hat einen guten Überblick über das wirtschaftliche Geschehen, dieses gilt es zu nutzen.
Und wie wäre es mit Privatdetektiv? In den USA und England haben Redakteure den Privatdetektiv zumindest als Krimi-Autoren zu Ruhm und Ehre gebracht. Raymond Chandler erfand Philip Marlowe und war danach in der Gehaltsfindung mehr als flexibel.
**
Quelle: Wirtschaftswoche 5. März 2013
„Ein bisschen vernagelt“ – In seinen Memoiren schaut Wolf Schneider auch auf die DDR und die Einheit zurück
Ein vorlauter Redakteur fragt 1957 bei einer Konferenz des Stern, mit fast zwei Millionen Auflage eines der großen Magazine der Welt: „Wäre die totale Entleerung der DDR nicht eine großartige Vision?“ Der vorlaute ist Wolf Schneider, einen Leitartikler kritisierend, der die Flucht von 300 000 DDR-Bewohnern pathetisch bedauert; der Vorlaute erinnert sich ein halbes Jahrhundert danach noch an diesen Satz und zitiert ihn in seinen Memoiren.
Einer der großen Journalisten, der zudem viele große Journalisten ausgebildet hat, der Sprachpapst, der er ist, aber das Wort nicht mag – er schreibt mit neunzig Jahren sein „langes, wunderliches Leben“ auf, das in Erfurt begann.
Lesen wir das Buch gegen den Strich: Was fällt einem Thüringer auf, der – anders als Schneider – nach dem Krieg nicht zu den Russen, sondern zu Amerikanern ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelte, der sein Leben in der DDR aufrecht lebte, aber nicht als Unrecht empfindet – und der alle Wessis entbehrlich findet, die sich unentwegt auf die Schulter klopfen?
Immerhin bekommt „Ärrfort“, seine Geburtsstadt, ein eigenes Kapitel, das jubelnd mit dem Umzugswagen nach Berlin endet: Bis heute bin ich froh über den Aufbruch aus der Provinz. Da war Schneider 6 Jahre alt.
Der 33-jährige Stern-Redakteur sieht im Ausbluten der DDR die einzige Chance für eine Wiedervereinigung; der 50-Jährige wird in der Süddeutschen Zeitung zitiert mit seinem Kopfschütteln über Willy Brandts Verzicht auf die Wiedervereinigung:
Nie hatte es die Welt mit einer bequemeren deutschen Regierung zu tun. Jedes Runzeln einer ausländischen Augenbraue, jeder neue kommunistische Affront versetzt uns in Bestürzung: Haben wir etwas falsch gemacht?
Der 60-Jährige, nun Leiter der angesehensten deutschen Journalistenschule, wird von der Ostberliner Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft eingeladen, hört seinen Gastgeber für die Beendigung des Wettrüstens werben – und spricht von den Toten an der Mauer. Dreimal nimmt der DDR-Professor die Einladung zum Gegenbesuch nach Hamburg an und bekommt jeweils 300 Mark Honorar; dreimal fährt Schneider nach Ostberlin und ist bass erstaunt über den Journalisten-Nachwuchs, die geistige DDR-Elite:
Da saß ein Häuflein biederer Provinzler, nicht verbiestert, aber ein bisschen vernagelt. Nicht einmal der Marxismus hatte Weltniveau in der DDR.
Wenige Tage vor dem Fall der Mauer reist Schneider mit seinen Schülern durch die DDR und fragt eine Studentin, wie die TV-Berichte aus Prag auf sie wirken, und hört ein Gestammel: „Wir haben doch das Beste gewollt. Soll denn alles umsonst gewesen sein?“
Schneider fragt sich: Wie hoch ist der Anteil der DDR-Bürger, die das Regime ehrlich bejahen und derer, die sich hinter der Mauer halbwegs wohnlich eingerichtet haben? Seine Antwort: „Voll dafür – ein paar Prozent; halbwegs eingewöhnt: 20 bis 30 Prozent. Für die anderen gab es die Stasi.“
Als die Nation vereint ist, loben einige seiner Schüler immer noch den Gegenentwurf zum Kapitalismus und schwärmen von der menschlichen Nähe in der DDR.
Ach ja, Nähe!, hielt ich ihnen entgegen: Die kannte ich noch aus den Bombennächten im Luftschutzkeller, in der Not rückten die Menschen immer zusammen.
Für junge Journalisten im Osten organisiert Schneider direkt nach der Revolution ein gutes Dutzend Kurse „So machen wir das im Westen“; er bekennt: „Mehr Spaß hat die Schule mir nie gemacht“, aber wundert sich auch über die Leser im Osten – zum Beispiel die der „Wochenpost“:
Die hassten ja alles, was nach Marktgeschrei klang, schon allzu viel Offensichtlichkeit irritierte sie, und von der schrillen Werbung waren sie geradezu angewidert. Ihr behäbiges Blatt wollten sie behalten, so, wie es war.
Hatten wir, so fragt Schneider, die 44 Jahre Bevormundung unterschätzt?
Doch genug von der DDR und ihren Folgen. 96 Prozent des Buches spielen auf anderen Schauplätzen, in München, Patagonien und Mallorca, in Srebrenica und auf den Schlachtfeldern Hitlers, dem auch der junge Schneider zugejubelt hatte.
Da erzählt ein welterfahrener Journalist – nach einem knappen Jahrhundert – lebenssatt, selbstbewusst, auch ein bisschen arrogant, klug und mit gerade so viel Altersmilde, dass uns beim Lesen niemals langweilig wird. Und er kann erzählen und zeigt es gleich in den beiden ersten Sätzen über einen gerade noch verhinderten Selbstmord:
Es lag an mir, ob ich diesen Tag überleben wollte. Es war mein 20. Geburtstag, und Deutschland hatte unterschrieben: Kapitulation!
**
LESEPROBE: Markiert
(Besuch in Erfurt kurz vor dem Mauerfall 1989)
Da waren Grenzfälle der Zufriedenheit, die sich jeder Einordnung widersetzen. Wie bei jenem biederen älteren Ehepaar, das sich auf dem Domplatz in Erfurt ein Herz fasste, eine neugierig herumstehende Vierergruppe von uns – erkennbar Westler – ansprach und uns in seine Mansardenwohnung einlud zu Pfefferminztee und Wodka. Die Wohnung eng, aber gemütlich, die Leute richtig nett. Im Nebenzimmer hörten wir’s plätschern. Na, erzählte die Frau: „Es regnet ja ziemlich heftig, und bei uns regnet’s durch, da müssen wir einen Eimer drunterstellen.“ Aha! „Und wenn’s viel regnet, ist der Eimer nach ein paar Stunden voll. Aber wissen Sie: Da dürfen wir natürlich aus der Fabrik nach Hause gehen, den Eimer leeren. So was dürfen Sie ja nicht im Westen, nach allem, was man so hört?“
**
Wolf Schneider: Hottentotten-Stottertrottel, Rowohlt, 447 S., 19,95 Euro
Erschienen in der Thüringer Allgemeine, 1. Mai 2015
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?







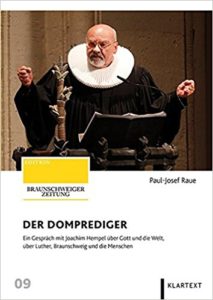

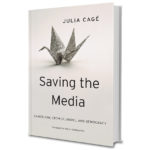


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von