Feuilleton-Adjektive: Saftig
„Die Domchöre zelebrieren es mit saftiger Inbrunst. Viel Applaus.“ (BZ 27.8.19 im Kulturteil – Besprechung eines Chorkonzerts)
Viel Applaus.
Die „Vorbereitung eines Angriffskriegs“: Johannes Willms zum 70.

Johannes Willms schrieb auch eine Balzac-Biografie, die im Diogenes-Verlag erschienen ist. Foto: © Evelyn Schels/ Diogenes
Es zeugt von Stil, dem Kollegen aus dem Konkurrenzblatt zum 70. Geburtstag zu gratulieren: Claudius Seidl würdigt in der FAZ heute (25. Mai 2018) Johannes Willms, den ehemaligen Feuilleton-Chef der „Süddeutschen Zeitung“. Solche Gratulationen sind ein netter Anlass, Anekdoten aus dem Leben zu erzählen – die oft mehr über den Jubilar verraten als manch umstrittene Entscheidung.
„Man lebt im Feuilleton ja oft über seine geistigen Verhältnisse; dass man zum Ausgleich auch mal über seine finanziellen Verhältnisse leben sollte, zum Beispiel in anständigen Restaurants“, schreibt Seidl, der einst auch für die SZ gearbeitet hatte, und erzählt: „Einmal führte er einen sehr schmächtigen Korrespondenten aus, und auf die Spesenquittung schrieb er als Bewirtungsgrund: „Vorbereitung eines Angriffskriegs“.“
Seidl nennt dies einen „profunden Unernst“.
Der Leser ahnt, welche Kämpfe in den Feuilletons tobten in den achtziger Jahren: Willms, so Steidl, setzte „das sogenannte politische Feuilleton durch; auch wenn die (durchaus mächtigen) Stammleser sich mehr Musikkritiken wünschten und die Kollegen aus dem politischen Ressort manchmal vom „Zeugs“ sprachen, das im Feuilleton stehe“. „Zeugs“, das merken wir uns.
Willms blieb ruhig, so Seidl, und reizte seine Gegner, wohlgemerkt in der Redaktion, mit „seiner geistigen Nonchalance“.
TV-Kritik: Kongeniale Dämlichkeit und Leberkäs-Semmel
Ein Verriß von Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung vom 27. Dezember 2017 und Antwort auf die Frage: Wovon träumt ein bekannter Schauspieler kurz vor der Drehpause?
Herbert Knaup als Fugger investiert, kauft, schmiert und verheiratet zwar tapfer, schaut aber dabei so desinteressiert, als wäre er mit dem Kopf nicht bei legendären Marktbeherrschungsplänen, sondern bei der Frage, wie er in der Drehpause an eine Leberkässemmel kommt.
Erwähnt sei auch der Zwischentitel:
Frauen werden an Pfähle gebunden. Die Dialoge sind von kongenialer Dämlichkeit
Zum ARD-Fernsehfilm am Mittwoch, 27. Dezember 2017 (und 2. Teil am Freitag): „Die Puppenspieler“
Journalisten und Manager sollten Leser und Zuchauer respektieren – oder?
Ein Journalist und Manager sollte die Menschen mögen, für die er arbeitet, zumindest sollte er sie respektieren. Thomas Ebeling, Chef von „Pro 7-Sat1“ , sprach in einer Telefonkonferenz über seine Zielgruppe so, ins Deutsche übersetzt:
Es gibt Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen. Das ist eine Kernzielgruppe, die sich nicht ändert.
Es soll auch Zeitungs-Redakteure geben, nicht nur in den Feuilleton-Ressorts, die so über ihre Leser denken – und die sich wundern, wenn einige die Respektlosigkeit zurückgeben, abbestellen und von „Lügenpresse“ sprechen.
Quelle: DWDL / https://www.dwdl.de/nachrichten/64288/prosiebensat1chef_ebeling_lstert_ber_seine_zuschauer/
Journalismus und PR: Was sie trennt. Was sie verbindet.
Ulrike Demmer war Redakteurin der Madsack-Redaktionen in Berlin. Sie wechselte ins Presseamt und ist stellvertretende Regierungssprecherin. Sabine Adler war Korrespondentin des Deutschlandfunks und wurde Sprecherin des Bundestagspräsidenten; sie kehrte nach knapp einem Jahr vom PR-Job zurück in die Redaktion: „Man wird mundtot gemacht; ich fand das furchtbar. Man büßt doch ein hohes Maß an Freiheit ein“, sagte sie in einem Zapp-Interview.
Auch wenn immer mehr gut ausgebildete Redakteure in die PR wechseln, rümpfen die meisten fest angestellten Redakteure die Nase, wenn sich Pressesprecher oder PR-Leute Journalisten nennen. Klaus Kocks, der letzte VW-Sprecher mit Vorstandsrang, ärgert sich über solche Redakteure, „die sich auf dem Ruhekissen der vierten Gewalt räkeln“ und spottet über die „Speichelleckerei gegenüber Lobbying, über die Bequemlichkeit, mit der einige nachbeten, was andere vorsetzen“.
Redakteure, die – ohne sich zu räkeln – in der Unabhängigkeit bleiben, ärgern sich umso mehr, wenn sogar Leser ihre Unabhängigkeit anzweifeln. Degradieren sie ihre Leser zu besseren Pressesprechern, reagieren sie wie Henning Noske, der Lokalchef der Braunschweiger Zeitung ist; er schrieb vor wenigen Tagen in seiner Kolumne „Offen gesagt“:
Kürzlich las ich in einem unserer Internet-Kommentarforen: ‚Herr Noske macht seinem Ruf als Pressesprecher der BISS wieder alle Ehre.‘ Die BISS, das ist die ,Bürgerinitiative Strahlenschutz‘ im Braunschweiger Norden. Zu viel der Ehre, liebe Kommentatoren. Denn wenn einer Pressesprecher wird, muss er sich aus der Redaktion verabschieden. Pressesprecher ist ein ehrenwerter Beruf, den viele Journalisten einschlagen und klasse ausüben. Klar ist allerdings auch: Sie verbreiten Informationen und Wahrheiten, die im Interesse ihres Unternehmens oder ihrer Organisation liegen. Die Zeitung – gedruckt oder online – leistet sich ein Leser, der unabhängig und unvoreingenommen informiert werden will.
Die Pressefreiheit, die unsere Verfassung garantiert, gilt eben nicht für Pressesprecher und Lobbyisten, auch wenn sie mitunter meinen, Parteien und Politiker, für die sie arbeiten, würden sie verleihen und garantieren – und auch einschränken, wenn es sein muss.
Der Public Relations-Sektor wächst, der Journalismus schrumpft; Öffentlichkeitsarbeit wird vom Journalismus unabhängiger,
stellt der Journalistik-Professor Stephan Ruß-Mohl fest, beklagt eine zunehmende Abhängigkeit und mahnt: „Eine sehr gefährliche Dynamik.“
Der Professor trennt scharf: Hier Journalismus – und auf der anderen Seite PR, die folglich kein Journalismus ist. Was unterscheidet also, wenn überhaupt, Journalismus von PR?
Erst einmal: nichts. Beide nutzen die Sprache; sie schreiben so, dass ihre Leser sie verstehen; sie buhlen um Aufmerksamkeit; sie verführen mit Bildern und Grafiken; und sie schreiben für einen Auftraggeber, ob es ein Referatsleiter im Ministerium ist oder Millionen lesend hinter der Bildzeitung. Die Sprache beherrschen müssen alle, die von Menschen und für Menschen schreiben. Und die Regeln der Verständlichkeit gelten für einen Bericht über die Bundestags-Sitzung ebenso wie für einen PR-Artikel über neue Produkte.
Und jeder, der schreibt, wird von einem bezahlt, für den er schreibt. Für den Pressesprecher ist es sein Chef, der meist eitel ist, oder der Referatsleiter im Ministerium, der seine Bürokratensprache schätzt, oder die Marketing-Chefin, die ungenießbare Adjektive verlangt.
Redakteure schreiben für den Chefredakteur oder Verleger, Feuilleton-Redakteure für Intendanten und Dirigenten, deren Beachtung sie suchen und finden; im besten Fall schreiben Redakteure für die Leser, für Tausende und Zigtausende, die eine Zeitung abonnieren oder kaufen.
Man mag den Redakteur mehr achten, der für Tausende schreibt, als den Lobbyisten, aber im luftleeren Raum schreibt keiner. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, mag eine zynische Boulevard-Weisheit sein, aber sie stellt klar: Thema oder Richtung, Sprache oder Ansprache – bestimmt in der Regel der, der bezahlt, ob es die Bürger sind oder der Bürgermeister.
Doch es gibt, bei vielen Gemeinsamkeiten, eine klare Grenze: Sie verläuft eben zwischen unabhängiger Information auf der einen Seite und Verlautbarung wie Propaganda auf der anderen Seite. Der unabhängige Redakteur ist eigentlich nur einem Auftraggeber verpflichtet: Den Bürgern, denen er die notwendigen Informationen zu beschaffen hat, damit sie ihre Macht in der Demokratie ausüben können.
Die Pressefreiheit, die unabhängige Journalisten genießen, ist nicht ihre Freiheit, es ist die Freiheit der Bürger. Sie leihen den Journalisten die Macht, für sie alle Informationen zu sammeln, und verbinden sie mit der Verpflichtung, wichtige Informationen sofort an sie weiterzugeben. Der Journalist handelt also für seinen Auftraggeber – wie ein Treuhänder.
Zeitungen sind ein Markenartikel, sogar der Markenartikel der Demokratie. Und so sind Redakteure, im Gegensatz zur PR-Mitarbeitern, unverzichtbar für unsere Gesellschaft.
Bearbeitete und erweiterte Fassung auf der Webseite von KM (Kompaktmedien): http://www.kompaktmedien.de/wie-viel-journalismus-steckt-in-der-pr/
Fehlerkorrektur
Dies ist eine bearbeitete Fassung. Die Funktion von Ulrike Demmer ist nun korrekt angegeben. Dank an dp-Chefredakteur Sven Goesmann für den Hinweis.
Christopher Schmidt, der SZ-Sprachgewaltige, ist tot
Christopher Schmidt, Literaturchef der Süddeutschen Zeitung, ist mit gerade mal 52 Jahren gestorben. SZ-Foto: Allessandra Schellnegger
Er pflegte eine manchmal mürrische, immer unbestechliche, auf bedauerliche Weise etwas aus der Mode gekommene Distanz.
Kann man Schöneres über einen Journalisten schreiben? Sonja Zekri ehrt so heute (2. März 2017) Christopher Schmidt, den Literaturchef der Süddeutschen Zeitung; er ist mit gerade mal 52 Jahren gestorben.
Sonja Zekri zeichnet auch das Gegenbild des abgehobenen Feuilletonisten, dem Schmidt eben nicht glich:
Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, aus seiner Nähe zu den Berühmten der Bühne, des Films, der Literatur Kapital zu schlagen, ihren Glanz auf sich abstrahlen zu lassen, ein strahlender Name hier, ein Fernsehauftritt dort, eine Whiskey-Runde nach der Vorstellung.
Schmidt war ein besonderer Journalist, ein besonders guter, mehr als ein Profi. „Viele Journalisten haben ein schwieriges Verhältnis zur Sprache, seines war obsessiv“, schreibt Sonja Zekri im Nachruf:
Seine Texte verrieten eine Sprachgewalt, die reichte, um Romane zu füllen, kein Bild war schief, gebraucht, auch nur vage bekannt. Für die Entlarvung des alltäglichen politischen, medialen oder sonstigen Sprachmülls erfand er eine eigene kleine Feuilleton-Rubrik, den „Phrasenmäher“, wo er das „Pimpen“, den „Spoiler-Alarm“ oder den „Atmenden Deckel“ in ihre Einzelteile zerlegte und wieder zusammensetzte.
Sie erinnert an sein schönstes Essay, das der schreibende Heimwerker der Schraube widmete: „Ein Lob an die Schraube – Kopf hoch!“, erschienen vor sieben Jahren. Schmidt beschreibt einen Schrauben-Laden in München:
Hier wird man gemaßregelt. Hier bemüht man sich nicht um den Kunden, hier beugen sich Gleichgesinnte über das obskure Objekt ihrer Begierde. Und Laien werden nur geduldet. Jeder Besuch im Schraubengeschäft: eine Lektion in Demut.
Das Ende des Essays taugt, wie der gesamte Text, zur Ausbildung von Redakteuren: Wie man über einem scheinbar unbedeutenden Gegenstand einen bedeutenden Artikel schreibt:
Es gehört zur spröden Poesie der Schraube, dass sie eines der wenigen Dinge ist, die unendlich sind in einer von Endlichkeiten beherrschten Welt, dass man bei ihr weiß, „um was es sich dreht“, und dass es Ozeane von Erfinderschweiß kostete, um härtesten Stahl so filigran zu formen, dass er an der Spitze ins Nichts übergeht.
Übersprungen sei hier das delikate Verhältnis zwischen der männlichen Schraube und ihrem weiblichen Gegenstück: der Mutter – wie die meisten Mutter-Sohn-Bindungen eine der wenigen perfekten Beziehungen. Aber auch, nachdem die Schraube zu ihrer heutigen Gestalt herangereift war, konnte man ihr noch zweihundert Jahre lang aus dem Weg gehen. Erst als das schwedische Möbelhaus „Ikea“ mit seinen Bausätzen das Wohnen revolutionierte, musste sich fast jeder irgendwann mit der Schraube auseinandersetzen. Denn sie öffnete den Weg in die Emanzipation.
Die instabilen Spezialschrauben von Ikea sind allerdings der Sündenfall in der Geschichte der Schraubverbindungen, und deshalb wurde Ikea zur Strafe an den Stadtrand verbannt.
Feuilletonisten: Gralshüter, die nicht verstanden werden wollen

Zeitungsleser in Nepal, umgeben von Klangkörpern: Feuilletonisten wollen für die Elite der Elite schreiben. Foto: Paul-Josef Raue
Feuilletonisten schreiben zuerst für andere Feuilletonisten, für Künstler und Kulturmanager, bisweilen auch für Theater- und Ausstellungsbesucher. Feuilletonisten bleiben unter sich, die meisten jedenfalls. In der Redaktion gelten sie als nett, aber schwierig, sie sind Außenseiter. Ein garstiges Vorurteil?
Viele Feuilletonisten stimmten zu, sie schätzen diesen Status des einsamen, aber freien Nachdenkenden, ja sie genießen ihn und wollen Lichtjahre entfernt vom Rest ihrer Redaktion wirken und schreiben. Sie kümmert es kaum, dass nur wenige Abonnenten ihre Rezensionen lesen; sie sind selbstbewusst: Wir schreiben für die wichtigen Leser!
Sie wissen, was Kultur ist, und bauen einen Gral, zu deren Hüter sie sich selbst erwählen. „Der typische deutsche Kulturredakteur möchte von Hinz und Kunz gar nicht verstanden werden“, schrieben wir im Handbuch des Journalismus.
Der weibliche Nachwuchs des Journalismus, weniger der männliche, antwortet im Bewerbungsgespräch auf die Frage nach den Vorlieben: Die Kultur, vorzugsweise. Doch Vorsicht: Die meisten Feuilletonisten schreiben in ihrer eigenen Sprache, schreiben schwer verständliche Texte – eben Tagesliteratur für Eingeweihte, die zwar auch nichts verstehen, aber das Erhabene fühlen.
Wer etwa vom großen Gerhard Stadelmaier das Schreiben lernte, der dürfte für andere Ressorts kaum mehr tauglich sein. Gerhard Stadelmaier, Professor für Theaterkritik, war oberster Theaterkritiker der FAZ, der Texte schrieb, die Germanisten in ihren Seminaren als hermetisch loben würden. Unter Seinesgleichen ist er geachtet und bewundert, auch im Ruhestand, in dem er einen Roman schrieb über die Redaktion der „Staatszeitung“, die der FAZ ähnelt, und die „Verflüssigung der Zeitung“, die an Qualität verliere und an Sprachkraft.
Jan Küveler nennt ihn in der Welt einen der „begnadesten Vertreter“, lobt ihn für seine bildkräftige Sprache, für Formulierungen wie „hirnwütiger Quecksilberbubi“ oder „zentnerschwere Langeweile“. Stadelmaier ist mehrfach preisgekrönt für seine „leichte und doch gewichtige Sprache“; vor einigen Wochen verlieh ihm in Weimar eine Stiftung, die die „Reinheit der deutschen Sprache“ pflegt, den „Deutschen Sprachpreis“.
Man könnte ihm noch einen Preis verleihen – für den längsten Satz, den wohl je ein Journalist geschrieben hat: 208 Wörter lang (nach der Word-Wörterzählung). Der rekordverdächtige Satz war schon einmal Thema in diesem Blog:
Am 17. Juni 2013 druckte die FAZ die Besprechung einer Trauerfeier im Stil einer Rezension: Walter Jens wurde in Tübingen zu Grabe getragen, und Gerhard Stadelmaier schrieb darüber. Da wenig gesprochen und viel Mozart gespielt wurde, schrieb der Kritiker über Jens‘ Beziehung zu Mozart und verlor sich dabei in einem Satz mit 208 Wörtern und fast 1500 Zeichen! Der Satz taugt für jeden Volontärskurs: Wie zertrümmere ich einen Schachtelsatz? Wer findet den Hauptsatz (in der die Hauptsache stehen soll)?
Die Mühe des Zertrümmerns dürfte allerdings vergeblich sein: Der Satz ist nicht redigierbar.
**
Die komplette JOURNALISMUS!-Kolumne zum Thema: https://kress.de/news/detail/beitrag/136591-208-woerter-ein-sprachpreis-fuer-den-laengsten-satz.html
Mächtig und virtuos: Auch böse Menschen können gut schreiben (Überschrift des Monats)
Ein Schuft mochte er sein, aber schreiben konnte er.
Überschrift im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung zum Tode des Schriftstellers Hermann Kant, der große Romane wie „Die Aula“ schrieb, aber als Präsident des Schriftstellerverbands der DDR zuließ, dass Autoren wie Stefan Heym ausgeschlossen wurden. „Mächtiger Funktionär und virtuoser Erzähler“, so beginnt die Unterzeile.
„Wahrhaft“: Stadelmaier schrieb den 208-Wörter-Satz und bekommt den Deutschen Sprachpreis
Hält ein Journalist, der lange verschachtelte Sätze pflegt, die deutsche Sprache rein? Ja, meint die Jury des „Deutschen Sprachpreises“, berufen von der Henning-Kaufmann-Stiftung. Den Preis bekommt in diesem Jahr Gerhard Stadelmaier, der vor drei Jahren in diesem Blog herausgehoben wurde: Er schrieb mit 208 Wörtern den längsten Satz. Seitdem ist der Theaterredakteur der FAZ stets bemüht, den eigenen Rekord zu brechen.
Die Jury ehrt Stadelmaier für „beispielhafte sprachliche Gestalt seiner journalistischen Texte“. Die Begründung im Wortlaut:
Mit dieser Auszeichnung ehrt die Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft erstmals einen Theaterkritiker, der sich große Verdienste um die sprachliche und literarische Qualität des deutschen Theaters erworben hat, nicht zuletzt durch die beispielhafte sprachliche Gestalt seiner journalistischen Texte.
Stadelmaier ist ein wahrhaft sprachmächtiger Publizist, dessen Texte ihrem Gegenstand, dem Theater deutscher Sprache, in Lob und Kritik stets angemessen waren. Er hat das Theater auf dem „herrlich langen Weg vom Dichter über den Schauspieler zum Zuschauer“ begleitet und ihm dabei nicht selten den Weg gebahnt. Seine Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu den führenden Feuilletons Deutschlands gehört. Er ist ein vorbildlicher Vermittler und Förderer der Theaterkunst, dessen außerordentliche sprachliche Leistungen mit dem Deutschen Sprachpreis 2016 gewürdigt werden.
„Wagen es die Kollegen, Ponkie zu redigieren?“
Was für eine Frage! Und Wagnis? Selbstverständlich wird auch Ponkie redigiert, wollen wir antworten. Selbst Goethe würde durch Redigieren, vor allem Kürzen, besser. Ponkie ist die dienstälteste Fernsehkritikerin Deutschland. Sie wurde am Samstag (16. April 2016) neunzig und schreibt von Anfang an und immer noch in der Münchner AZ.
Und was antwortete Ponkie der Süddeutschen auf die Frage, ob die Kollegen auch Ponkie redigieren?
Redigieren gibt’s nicht. Punkt. Das ist ein Privileg, das ich in der alten Abendzeitung sehr bald hatte und auf das ich heute noch viel Wert lege. Mein Name steht schließlich unter dem Text, und damit trage ich auch die Verantwortung dafür, dass das inhaltlich in Ordnung ist… Ich liefere immer auf Zeile.
Und Ponkie sagt auch: „Kritiker zu sein, ist eine Lebensform.“ Eine unredigierbare Lebensform.
**
Quelle: SZ 16. April 2016
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?






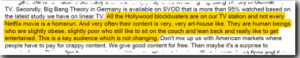




 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von