Besuch bei Buzzfeed: Katzenvideos und Investigativ-Recherche

Redaktion BuzzFeed Deutschland (von links): Chefredakteur Daniel Drepper, Grundrechte-Reporter Marcus Engert, Reporterin für Politik und sexualisierte Gewalt Pascale Müller, Reporterin für Feminismus Juliane Löffler, Reporter für Desinformation und Social News Karsten Schmehl. Foto: Stefan Beetz / BuzzFeed
„Ist das die Zukunft des Journalismus? Querfinanzierung über Katzenvideos und Kochbücher?“, fragt Veronika Wulf in der Süddeutschen Zeitung nach einem Besuch in der Berliner Redaktion von Buzzfeed. Drei Mitarbeiter arbeiten für die Reichweite (Tipps für Analsex, Quiz, Rezepte), vier Reporter betreiben investigative Recherchen (Kosten für den Podcast von Kanzlerin Angela Merkel, Mobbing-Vorwürfe gegen Direktorin eines Max-Planck-Instituts). Chefredakteur Daniel Drepper will von anderen Medien zitiert werden, was ihm auch gelingt. Sein Motto: „Wilde Ideen ermutigen.“
Quelle: Süddeutsche Zeitung, Medien, 29. Januar 2019
Berthold Flöper und die Zeitung der Zukunft: Lokal durchkomponiert

Berthold Flöper leitete das Lokaljournalisten-Programm der „Bundeszentrale für politische Bildung“ bis Ende des Jahres 2018. Foto: Hans Blossey/BpB
Die „Drehscheibe“-Redaktion hat für Berthold Flöper, der Ende 2018 in den Ruhestand gegangen ist, eine Sonder-Drehscheibe herausgegeben, in der Weggefährten auf Begegnungen und Projekte mit ihm zurückblicken. Berthold L. Flöper war seit Mitte der 90er Jahre Leiter des Lokaljournalistenprogramms der „bpb“.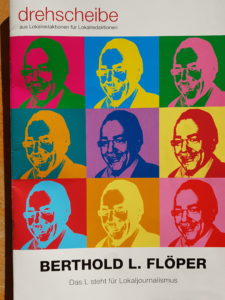
Paul-Josef Raue erinnerte sich in der Extra-„Drehscheibe“ an einen Kongress und ein Buch über die Zukunft der Zeitung, zusammen mit Flöper 1994 organisiert:
„Wir brauchen die Tageszeitung mehr denn je – um zu verstehen, was die Mächtigen vorhaben; um mitwirken zu können in der Demokratie, die ja Sache aller Bürger ist.“ So leiteten wir vor knapp einem Vierteljahrhundert einen Kongress ein, zu dem hundert Chefredakteure, Verleger, Journalisten, Wissenschaftler und „Datenverarbeitungs-Experten“ gekommen waren; Berthold Flöper und Paul-Josef Raue organisierten und moderierten in Königswinter: „Zeitung der Zukunft – Zukunft der Zeitung“.
Wir standen am Beginn der digitalen Medienära, schauten erstaunlich klar und selbstbewusst in die Zukunft und wussten schon: „Die Zeitung wird sich in vielem ändern müssen. Das jedenfalls werden Publikumserwartungen und neue Medien gleichermaßen provozieren.“ Das E-Paper, die Hoffnung der Branche, hieß noch „Bildschirmzeitung“: „Sie scheint trotz aller Skepsis eine aussichtsreiche Zukunft zu haben – vor allem wegen ihrer handwerklichen Benutzbarkeit.“ Erinnern wir uns überhaupt noch an die klobigen Rechner im Jahr 1994?
Schwergewichte aus der Branche sprachen – und einige prophetisch:
- „Journalistisch mitreißend sollten sie sein, innovativ und leidenschaftlich engagiert“, forderte Gerd Schulte-Hillen, der Gruner+Jahr-Chef – und meinte die Verleger, die sich ändern müssten. Erst zwei Jahrzehnte später hat Julia Jäckel bei G+J die Forderung eingelöst.
- „Journalisten sollen Ordnung in die Welt bringen. Wir brauchen keine Missionare“, ermahnte Dieter Jepsen-Föge, Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“, als keiner „Lügenpresse“, AfD und Pegida auch nur ahnen konnte.
- „Das Problem sind nicht die Leser, sondern die Schreiber“, analysierte Art Nauman, Ombudsmann der Hauptstadt-Zeitung aus Kalifornien. Erst vor wenigen Wochen ist die deutsche Ombudsleute-Vereinigung in Deutschland gegründet worden.
- „Journalisten sind weder Politiker noch Pädagogen. Sie haben die Leser nicht an die Hand zu nehmen“, mahnte Dieter Golombek, Chef des Lokaljournalisten-Programms der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihm folgte Berthold Flöper nach.
- „In meiner Zeitung werden die Machenschaften der Politik zu wenig aufgedeckt“, war einer der heftigsten Vorwürfe der Leser in der „Opus“-Forschungsmethode, die Cornelia Tomaschko, Redakteurin aus Karlsruhe, vorstellte. „Opus“, wie ein Spiel aufgezogen, war ein analoger Vorläufer des digitalen „Lesewert“ aus Dresden, mit dem Lesequoten in Zeitungen ermittelt werden und Redakteure erstmals erfahren, was überhaupt gelesen wird.
Berthold Flöper schloss mit der Forderung nach einer „nach dem lokalen Prinzip durchkomponierten Zeitung“. Was wir bekommen haben sind Synergien und Zentralredaktionen.
Paul-Josef Raue führte in seiner Kress-Journalismus-Kolumne ein Interview: „Flöpers Plädoyer für einen öffentlich-rechtlichen Lokaljournalismus“, ebenso das Medium-Magazin in Heft 7/2018: „Die Totgesagten leben noch heute“.
Geschichten über Wandel und Veränderung (1): Spione und Redakteure
Angst vor der Veränderung gibt es nicht nur bei Redakteuren, die das Ende des Journalismus mit dem Ende der Druckmaschinen verwechseln. Auch Spione nach dem Kalten Krieg verging das Lachen. Robert Littell schreibt in dem Thriller „Die kalte Legende“ über Agenten und Verwaltern bei CIA und KGB:
„Das sind alles Opportunisten, die sich mit den Fingerspitzen an einer Welt festklammern, die sie nicht mehr begreifen. Wenn sie sich lange genug festhalten können, haben sie die Pension durch und züchten bis ans Ende ihrer Tage Bohnen im Garten ihres Reihenhauses. Die vorherrschende Emotion ist bei ihnen Nostalgie. Die seltenen Male, dass sie sich wirklich entspannen, fangen sie alle ihre Sätze an mit ,Wisst ihr noch, wie wir…'“
In Redaktionen gibt es ähnlich viele Opportunisten, die sicher sind, gerade noch das Ende zu erreichen, die auf die Altersteilzeit hoffen und einen silbernen Handschlag und die über die Zeiten sprechen, die gut waren, weil sie gut waren.
Digital oder Print? Wichtig ist: Die Leser müssen Journalisten vertrauen
Es wird immer unheimlich viel darüber geredet, ob Journalismus digitaler werden muss, oder darüber, wie man ihn finanziert. Diese ganzen Diskussionen sind wichtig, aber obsolet, wenn die Leute dem nicht mehr vertrauen, was berichtet wird. Dann ist es egal, wie der Inhalt verpackt wird.
Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München in einem Interview auf der Medien-Seite der Süddeutschen (26. April 2018). Auf Fake-News angesprochen, sagt sie:
Zur Glaubwürdigkeit gehört, dass man eigene Fehler eingestehen kann. Nur weil wir menschlich sind und auch Fehler machen, sind wir keine Fake-News-Verbreiter.
Trendforscher Horx: „Apple, Amazon, Google und Facebook werden scheitern“
Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx sieht eine Renaissance der Zeitungen, zumindest der nationalen, die er „Qualitätszeitungen“ nennt. „Die Rache des Analogen“ sei zu spüren, „Digitalisierung wird übertrieben“, sagt er in einem Interview mit der Nordwest-Zeitung (NWZ) zum Jahreswechsel, „wir sind als Menschen analoge Wesen, zu viel Virtualität macht uns krank.“
Dagegen sieht er im Gespräch mit Jörn Perske dunkle Wolken über den Zentralen der Digital-Giganten im Silicon-Valley aufziehen: Apple, Amazon, Google, Facebook und Uber werden, so Horx, in den nächsten Jahren in eine Krise geraten durch ihre Gier, Monopole errichten zu wollen. „Daran werden sie scheitern. Es werden auch nicht 50 Prozent aller Jobs durch die Digitalisierung verschwinden – das ist Blödsinn.“
Die Menschen sehnen sich laut Horx nach Dingen zum Anfassen, nach Realität und schönem Design.
„Wir sind als Menschen analoge Wesen, zu viel Virtualität macht uns krank. Deshalb boomt schönes Papier und Lichtschalter, die „Klick“ machen.“
Die Digitalisierung werde abgelöst durch „Real-Digital“, einer Verbindung von dinglicher und digitaler Welt.
Von einem Trend der Gegenwart ließ sich der Zukunftsforscher überraschen: Der „grölende Populismus“ mit Trump und dem Brexit im Gefolge – und mit der AfD in Deutschland, die Horx aber nicht verdrießlich stimmt.
„Man sieht einen Trend zur Gelassenheit. Viele Menschen verstehen inzwischen, dass es vor allem die Hysterien und Übertreibungen sind, die den bösartigen Populismus stärken. Man sieht auch, dass Deutschland nicht zusammenbricht, wenn es mal eine Zeit von Umorientierungen gibt und eine neue Regierung etwas dauert.“
Der schrille Ton in der Öffentlichkeit, die Übertreibungen, die jede Debatte zu einer Existenzfrage hochpeitschen, erzeugten allerdings den Eindruck, dass die Welt immer schlechter werde:
„Man hat das Gefühl, als ob aller Lärm der Welt gleich nebenan ist… Aber eigentlich ist das alles nur Zorn, Aufgeregtheit, leere Erregung. Dagegen hilft nur eine kluge Ignoranz, die nicht jeden Shitstorm ernst nimmt.“
Juli Zeh lässt in ihrem neuen Roman die „Braunschweiger Zeitung“ langsam sterben
Gibt es in einem Jahrzehnt überhaupt noch Tageszeitungen, gedruckt und im Abo? In zeitgenössischer Literatur (noch gedruckt erhältlich) stirbt die Zeitung langsam, sie ist ein Relikt aus alten Zeiten. Juli Zeh schreibt so über die Braunschweiger Zeitung in ihrem neuen Roman „Leere Herzen“, der in der nächsten Woche erscheinen wird. Die Bestseller-Autorin, mit über zwei Dutzend Preisen geehrt, wird oft von Kritikerin gelobt: Sie verfasse die großen Gesellschaftsromane unserer Zeit.
Britta, die Heldin ihres neuen Romans, erfährt abends im Fernsehen von einem Attentat auf dem Leipziger Flughafen, aber sie unterdrückt den Wunsch, Informationen auf ihrem Smartphone zu lesen. „Stattdessen hat sie sich beim Frühstück die Braunschweiger Zeitung gegriffen, die in kleiner Auflage noch immer für nostalgische Ironiker wie Richard gedruckt wird, und auf Seite drei eine knappe Meldung über die Vorgänge in Leipzig gefunden, kurz vor Redaktionsschluss ins Blatt geklemmt. Das Foto kannte sie bereits aus den Nachrichten: schwarze Uniformen in einer Halle, ein länglicher Schatten am Boden. Der Text erzählte genauso wenig wie das Bild.“
Juli Zehs neuer Roman „Leere Herzen“ spielt in Braunschweig, etwa ein Jahrzehnt in der Zukunft, wenn Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, aber Trump noch Präsident der USA. In Deutschland regiert eine rechte Partei, die BBB, der AfD ähnlich. Die Menschen haben keine Visionen und keine Illusionen mehr, sind Pragmatiker.
Die Großstadt ist nicht mehr beliebt bei jungen Erwachsenen, vom Krieg zerstörte Mittelstädte liegen im Trend, „im Geist des Rationalismus wieder aufgebaut“. Britta, die Heldin des Romans, hat begriffen, „dass Großstadt out und Provinz kein Heilmittel für den abgerockten Metropolenwahn ist, da sich kein Übel mit dem Gegenteil kurieren lässt.“ In Braunschweig „gibt es alles, davon aber nicht zu viel“, und es gibt noch die Lokalzeitung.
Britta hat ein Haus in Lehndorf gekauft, „einen Betonwürfel mit viel Glas in einem ruhigen Wohnviertel, praktisch, geräumig, leicht zu reinigen, genau wie Braunschweig selbst, gerade Linien, glatte Flächen, frei von Zweifeln… Wenn man keine Lust hat, sich selbst etwas vorzumachen, ist polierter Beton eben das, was man heutzutage noch lieben kann.“
Offenbar hat Juli Zeh, die selber in der brandenburgischen Provinz lebt, einige Male im Hotel „Deutsches Haus“ gegenüber dem Dom übernachtet, nur ein paar hundert Meter von Verlag und Redaktion der Braunschweiger Zeitung entfernt. In ihrem Roman lässt sie Klienten ihrer Firma im „Deutschen Haus“ übernachten, „auf dessen Fluren es irgendwie nach Sozialismus riecht“.
Braunschweiger dürften sich ärgern, dass ihre Stadt für Britta keine Aura hat, „eine Folge von verkehrsgerechter Entsorgung jeglicher Ästhetik“ ist. „All das stellt eine Erleichterung dar im Vergleich zur klaustrophobischen Pluralität der Metropolen.“
Auf der preisgekrönten Leserseite der Braunschweiger Zeitung könnten empörten Briefe stehen, wie eine Schriftstellerin so über ihre Stadt schreibe; es dürften aber auch zustimmende geben: Der Nachbau des Schlosses, vereint mit einer ECE-Mall, war in der Stadt umstritten, die Zeitung bekam eine Rüge des Presserats, weil sie den Nachbau „Schloss“ nannte. An diese Debatte hängt sich Zeh dran: „An manchen Tagen liebt Britta Braunschweig, den klobigen Prunk totalitärer Prachtbauten, die aussehen wie Schlösser, die in Wahrheit nur Einkaufszentren sind…“
Im Roman geht es um zwei Braunschweiger, die als Terror-Dienstleister in einer Passage am Bahnhof arbeiten.
Interne Spiegel-Kritik: Wir müssen raus aus der Komfortzone der Redaktion?
Barbara Hans, Jahrgang 1981, ist Chefredakteurin von Spiegel Online. Foto: Iris-Carstenseniegel/Spiegel
Mittelalte, weiße Männer, gutverdienende Akademiker definieren und prägen die journalistische Realität und damit unsere Weltsicht. Was sie am besten kennen, das sind andere mittelalte, weiße Männer, mit Abitur und schicker Altbauwohnung. Was sie weniger gut kennen, das ist das Leben als Arbeiter in Herne Crange. Oder das Leben als lesbische junge Frau.
Spiegel-Online-Chefin Barbara Hans in einem Interview mit dem journalist (8/2017) – vielleicht an ihre Chefredakteure denkend? Sie fordert:
Wir müssen dahin, wo es weh tut. Raus aus der redaktionellen Komfortzone. Wir können nicht alles so lassen und hoffen, dass einige wenige Neueinstellungen zum Wandel führen werden.
Ist oder war der Spiegel nicht dafür bekannt, dass er zu den Rändern der Gesellschaft ging? Dass er sich Autoren leistete, als Storytelling noch ein unbekannter Anglizismus war? Was hat sich verändert?
Wir müssen Dinge für möglich halten, auch wenn wir sie für falsch halten. Und die Frage, was wir für richtig und was wir für falsch halten, sollte nicht unser Leitmotiv sein.
Das ist ein guter journalistischer Standpunkt. Aber passt er auch auf den Spiegel? Ist er nicht zur Institution aufgestiegen, weil er eine Meinung hatte, eine Haltung, wie es heute heißt? Oder haben sich die Leser gewandelt, die nicht mehr eine Haltung erwarten, sondern ein Pro&Kontra, also die Breite der Meinungen?
Spiegel Daily: Wenig Neues, aber erfreulich preiswert
Daniel Bouhs schreibt auf Zapp/NDR:
Blattmacher geben Spiegel Daily kaum eine Chance / Skeptisch: Paul-Josef Raue.
Etablierte Zeitungsmacher bleiben angesichts der neuen Konkurrenz von Spiegel Daily erstaunlich gelassen. „Ich gebe Daily nicht lange – sie kommen zu spät und haben wenig Neues darin“, sagt etwa der einstige Chefredakteur von Braunschweiger Zeitung und Thüringer Allgemeinen, Paul-Josef Raue, in einer ZAPP-Umfrage auf dem Europäischen Zeitungskongress in Wien, bei dem die Daily-Macher wiederum nicht vertreten waren. Raue, der inzwischen Verlage berät, vermutet: „Journalistisch wird da nicht viel passieren.“
Keine Angst: Michael Bröcker – „Nicht wirklich überzeugend“
Auch der Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael Bröcker, äußerte sich äußerst skeptisch über die Zukunft der Digitalzeitung, die das Nachrichtenmagazin seit Mitte Mai werktags pünktlich um 17 Uhr veröffentlicht. „Eine Abendzeitung? Da gibt es viele Ideen von anderen Verlagen, die das ‚Best-of‘ des Tages noch mal anbieten, die [aber] alle nicht wirklich überzeugend funktionieren.“ Seine Redaktion wolle vielmehr auf Podcasts, also Audioangebote, für Pendler setzen. „Wir schauen uns das mit Neugier an und arbeiten weiter an unseren Modellen. Angst haben wir nicht“, sagte Bröcker.
Auch die Chefredaktion von Bild ist nicht vom Tageszeitungsmodell des Spiegel überzeugt. Julian Reichelt sagte ZAPP zwar, er halte das Projekt inhaltlich in weiten Teilen für gelungen, er glaube aber auch, dass „ein fester Erscheinungszeitpunkt für ein digitales Produkt ein sehr gewagtes Projekt ist“. Reichelt wünschte den Daily-Machern allerdings auch „viel Erfolg“, denn: „Diese Mentalität, dass für Journalismus wieder bezahlt werden muss, ist etwas, was wir zwingend in unserem Beruf und unserer Branche brauchen.“
„Nötiger Preisdruck“
Verlagsberater Raue prognostizierte allerdings auch, der Spiegel werde mit seinem täglichen Ableger, der deutlich unter zehn Euro im Monat kostet, „andere in die Bredouille bringen“ – und das sei sogar gut:
Das, was bei den Verlagen online passiert, ist zu teuer. Man versteht nicht, warum man 30, 40 Euro im Monat bezahlen muss, um etwas Digitales zu sehen.
Die Tageszeitung des Spiegel könne hier für den nötigen Preisdruck sorgen.
Wie Leser auf das Ende der Online-Kommentare reagieren: Das Beispiel NZZ

So illustriert die NZZ auf ihrer Webseite die Einführung des neuen Leserforums. NZZ-Foto: Dominic Steinmann
„Der erste Tag ohne Kommentarspalten: Völlig langweilig, uninteressant. Es fehlt Pfeffer und Paprika. Nur weiter so, NZZ. Dann wird es mit Sicherheit bald Schluss sein. Warum sollte ich noch 800.– Franken für das Jahresabonnement bezahlen??“
So kommentiert ein Leser der Neue Zürcher Zeitung (NZZ) den „Umbau“ der Online-Lesermeinungen vor einem Monat. Dem Vorbild von FAZ und Süddeutscher Zeitung folgend ermöglichen die Schweizer keine Kommentare mehr direkt zu einem Artikel. Als Ersatz bietet die Redaktion monatlich fünfzig Themen an, die kommentiert werden können wie aktuell:
- Werden Journalisten zu hart angegangen?
- Oscar-Verleihung: Relevante Weltbühne oder feiert sich die Branche nur selbst?
- Alles normal in der Bundesliga – oder ein Zweiklassenwettbewerb?
Wie reagierten die Leser darauf? Sie schrieben rund tausend Kommentare, hier eine Auswahl:
- Die Redaktion ist zu empfindlich und politisch zu korrekt
Eine bedauerliche Entscheidung der NZZ-Verantwortlichen. Wer bloggt, muss etwas aushalten können, nicht wegen jedem Angriff aus den Socken kippen. Das gilt ja auch für Politiker. Nun ist also ein geschätztes Ventil zu. Die NZZ hätte es ja wie beim Tagi machen können: Unanständige Beiträge einfach nicht publizieren, aber ohne Meinungszensur.
Oliver Fuchs, Jahrgang 1990, Teamleiter Socialmedia der NZZ, begründet den Wegfall der direkten Kommentierung unter anderem mit einem „zufällig herausgegriffenen“ Kommentar auf NZZ.ch; es handelt sich um die Reaktion auf einen Artikel über Transsexualität.
Dies ist der Leserkommentar:
Transsexualität ist die Abart des modernen Menschen, seinen Körper über die natürlichen Grenzen hinweg zu schikanieren. Es gibt keine Frau, die im Körper eines Mannes geboren wurde (oder vice versa). Das ist kompletter Humbug. Es gibt körperlich bzw. hormonell beeinträchtigte Männer und Frauen. C’est tout!» Was ist der Wert dieses Kommentars? Ist er wirklich ein wertvoller Diskussionsbeitrag – und noch wichtiger: Signalisiert der Absender mit seinen Worten nicht deutlich, dass er einen Austausch gar nicht will? Kommentare wie dieser erreichen uns unterdessen jeden Tag.
Eine Leserin reagierte darauf:
Nehmen wir doch den „zufällig herausgegriffenen Kommentar“ über Transsexualität etwas näher unter die Lupe. Was findet die NZZ-Redation daran störend?
Erster Grund: Unhöflicher Schreibstil, insbesondere der Satz „Das ist kompletter Humbug“. Zugegeben, kein besonders respektvoller Ausdruck, aber immerhin sachbezogen und nicht personenbezogen. Müsste man noch verkraften können.
Zweiter Grund: Der Kommentator ist zu sehr von der Richtigkeit seiner eigenen Meinung überzeugt („Signalisiert der Absender mit seinen Worten nicht deutlich, dass er einen Austausch gar nicht will?“). Mit Verlaub: Ist sich die NZZ-Redaktion nicht im gleichen Masse der gegenteiligen Meinung gewiss? Ist es überhaupt ein Vergehen, an die Richtigkeit der eigenen Meinung zu glauben?
Es scheint viel wahrscheinlicher, dass die obigen Gründe eine willkommene Ausrede sind, um den wahren Grund zu vertuschen: Der Absender hat ganz einfach eine „falsche“ Meinung zum Ausdruck gebracht. Ja, in der „liberalen“ Weltanschauung, in welcher die NZZ wortführend ist, ist Political Correctness König, da gibt es die „richtigen“ und da gibt es die „falschen“ Ansichten. Die Worte der NZZ-Redaktion benützend, ist unverweigerlich deutlich zu signalisieren, dass man einen Austausch mit der „falschen“ Meinung gar nicht will. Daher braucht es niemanden zu wundern, dass man künftig nicht mehr alle Artikel kommentieren kann.
Der Schritt der NZZ-Redaktion mag als gutes Beispiel eines schlechten Liberalismus gelten.
Ein anderer Leser dazu:
Gut auf den Punkt gebracht. Es handelt sich m.E. bei diesem NZZ -Umbau der Kommentarspalte nicht nur um einen falschen Liberalismus, sondern um einen „pädagogisierenden Liberalismus“.
- Selbstherrliche Schreiberlinge (zu der Begründung des NZZ für den Umbau: Die Redakteure lesen die Online-Kommentare nicht mehr)
„Viele Journalisten lesen die Kommentarspalte nicht mehr“ – welche Diskrepanz zur gelebten Kommentarkultur der interessierten Leserinnen und Leser. Natürlich – nicht jeder Schreiber ist ein Gelehrter oder hat einen Hochschulabschluss. Es gibt auch einfach Leute, welche ihre Meinung mitteilen möchten. Die NZZ sollte froh sein, dass ihre Kommentarfunktion rege genutzt wird.
Tja, nun wird hier wohl bald Ruhe einkehren
**
Für ziemlich arrogant halte ich die Aussage, dass die NZZ-Redakteure diese Foren nicht mehr lesen. Sind sie zu selbstherrlichen Schreiberlingen mutiert? Wer nicht meiner Meinung ist, den beachte ich nicht?
- Was sind Leserkommentare? Speakers Corner oder gepflegte Konversation?
Die Katze (Umbau) ist aus dem Sack. So weit, so gut. Klar zeigt sich dabei, dass die Kommentarspalte VOR UMBAU nicht mit der Kommentarspalte NACH UMBAU vergleichbar ist.
Im Vergleich war Ersteres ein „Speakers corner“. Wo, frei ab der Leber, spontan der „offene Rede“ gehuldigt wurde. Ohne den Dissens zu scheuen. Zweiteres soll offenbar den gesitteten Meinungsaustausch, zu ausgewählten Themenbereiche, pflegen.
Bei Ersterem hatte des „Speakers opinion“ (die freie Rede!) oberste Priorität. Bei Zweiterem der gepflegte Meinungsaustausch (Konversation), auf der Suche nach Vertiefung und Konsens. Beide Kommunikationsformen haben ihre Berechtigung. Sind aber nicht gegeneinander austauschbar.
Da das Recht der freien Meinungsäusserung über allem steht, und die liberale NZZ sich seit ihren Anfängen diesem Recht verschrieben hat, wäre es doch eine Überlegung wert, ob nicht beiden Arten der Kommunikation (spontan / gepflegt) Raum gegeben werden sollte. Wer sich dabei vor den Gefahren der spontanen, offenen Rede (Fake-News, Populismus, rhetorische Flegeleien usw), trotz Netiquette-Filter, schützen will, hat so Option (jetzt nach Umbau) der „gepflegten Konversation“ hinzugeben. Alle anderen finden sich im Raum der „spontanen, offenen Rede“.
So könnte die NZZ die ganze Breite der Marktbedürfnisse abdecken. Denn immerhin handelt es sich bei (fast) allen um NZZ-Abonnenten / Leser. Zu denen doch Sorge zu
tragen ist. Zumindest hoffentlich.
Ein anderer Leser dazu:
Die beiden Forums-Arten, die Sie als „Speakers Corner“ und als „gesitteten Meinungsaustausch“ bezeichnen, möchte ich lieber als „Hochhalten von Plakaten“ und als „Gespräch“ bezeichnen. Das Hochhalten von Plakaten mag einigen Spaß machen, vor allem wenn sie damit die Gegenseite ärgern können.
Was es aber wirklich braucht, ist das Gespräch. Wie könnten wir uns ohne Gespräch auf Lösungen, die für alle akzeptierbar sind, einigen? Darum ist es verdienstvoll, wenn die NZZ die Gesprächskultur fördern will. Wenn sie das Hochhalten von Plakaten eindämmt, ist das keine Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Im Gespräch machen wir ebenso Gebrauch vom Recht auf freie Meinungsäußerung wie beim Hochhalten von Plakaten.
Wenn man vom Hochhalten der Plakate nicht zum Gespräch übergehen kann, wird man sich am Schluss die Plakate um die Ohren hauen oder noch härtere Gewalt ausüben.
Zudem scheint mir das Feld der Meinungsbildung eine zu ernste Sache, als dass man hier von einem „Markt“ sprechen dürfte. Wenn die NZZ es riskiert, um der Gesprächskultur willen zahlende Kunden zu verlieren, ist auch das verdienstvoll. Ich glaube allerdings, dass die neue Debattenform vielen Lesern bald mehr Spass macht als die früheren Pöbeleien. Das könnte sich für die NZZ auch finanziell positiv auswirken.
- Endlich keine Gerüchte mehr
Nun auf manche Dinge (oder Intrigen), wie z.B., dass H. Clinton an Parkinson leide (und Pizzagate und konkrete Schüsse aufgrund von Lügen- und Intrigendingen) oder Barack Obama nicht direkt auf US-Boden geboren wurde, könnte ich auch verzichten.
- Das Ende der freien Meinung
Ein Leser schreibt direkt an den NZZ-Redakteur:
Lieber Herr Fuchs
Auch wenn der Entscheid teilweise nachvollziehbar sein mag. Gerade die NZZ als liberales Medium sollte für die freie Meinungsäußerung einstehen. Diese wird nun ohne Not eingeschränkt.
Viel besser hätten Sie klarere Regeln aufgestellt, um so alle „unanständigen“ Meldungen zu löschen. Die ganze „Fake News Abteilung“ wurde bisher sowieso immer von den in grosser Mehrzahl vorhandenen, vernünftigen Kommentatoren zerzaust.
Jedenfalls glaube ich, dass Sie resp. das Entscheidungsgremium sich hier übernommen hat. Ein bedauerlicher Entscheid, der dem Anspruch ein liberales Medium zu sein, nicht gerecht wird.
**
Andere Leser:
Das ist ein bedenklicher Schritt. Offenbar verträgt sich das Konzept des Leserkommentars schlecht mit dem Konzept des Leitmediums. Wir kehren zurück zu einem geozentrischen Weltbild (um nicht zu sagen: egozentrischen Weltbild), oder anders ausgedrückt: Die NZZ ist wieder eine Scheibe.
**
Wo die Meinungen anderer mit dem eigenen Bild der Welt kollidieren, sind sie plötzlich nicht mehr gefragt. Drehen wir die Uhr der medialen Welt zurück und stellen die eingefärbten Nachrichten wieder unkommentiert und damit unkritisiert ins Netz.
Natürlich ist der Ton hinter der angenehmen Anonymität rauer. Natürlich gibt es immer ‚Trolle‘. Aber ein Mensch, der nichts zu befürchten hat, spricht am freiesten, oder?
Dies ist hier anscheinend nicht gewollt.**
Schade. Wenn man die Kommentare in Relation zum Artikel liest, weiss man oft erst, wie die Bevölkerung wirklich darüber denkt (im Gegensatz zum Autor). Dieser Realitätsabgleich fehlt dann eben, und es wird einseitig. Man kann das dann eben kritiklos lesen, oder Alternativen suchen.
Dazu ein anderer Leser:
Es ist ein Fehler anzunehmen, die Äusserungen in den Kommentarspalten würden „die Bevölkerung“ widerspiegeln.
- NZZ ist zu nachsichtig gegen Pöbler
Die NZZ hat die Chance verpasst, pöbelnde Kommentarschreiber auszuschließen oder deren Kommentare zu entfernen. Ein kleines Beispiel: Wie oft wurde mir unterstellt, ich sei ein Putin-Troll, bloß weil ich mich seit der Ukraine-Krise dagegen stemmte, dass Russland als neues Feindbild aufgebaut wird. Diese gegen die Person gerichteten Argumente wurden immer dreister.
Als das mit dem Putin-Troll nicht mehr reichte, wurde meine Religionszugehörigkeit als Waffe gegen meine Kommentare verwendet. Nichts passierte, kein Verweis gegen diese pöbelnden Kommentarschreiber seitens NZZ. Dies hinterließ natürlich den schalen Beigeschmack, dass die NZZ nicht unparteiisch agierte, da es um Artikel ging, die mehrheitlich gegen Russland gerichtet waren.
**
Ich bin da bei Ihnen. Letztlich gäbe es andere Mittel, um Pöbler auszubremsen. Meiner Meinung nach waren es die immer gleichen Kommentatoren, die grundsätzlich jede Meldung im Forum dann verhetzt haben mit ‚Lügenpresse‘-Vorwürfen oder völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Vergleichen – oder Wutreden. Beispiel Merkel: egal worüber bezüglich der deutschen Politik berichtet wird, in kürzester Zeit ist jedes offene Forum überschwemmt mit Kommentaren wie ‚Deutschland war früher super, heute ist alles Mist wegen Merkel‘.
Auf die eigentliche Meldung oder Fakten wird nicht eingegangen, eine Diskussion ist so einfach nicht möglich! Anstatt solche Pöbler, die letztlich gar nicht diskutieren wollen, die offensichtlich nur ‚brüllen‘ wollen, anstatt diese gezielt anzuzählen und notfalls eben zu sperren, sind wir nun alle betroffen. Ich finde den Weg des SRF da viel besser: Klarname muss genannt werden und Telefonnummer, das würde viele der unseriösen Trolle abschrecken – und dem Rest bliebe die Debatte erhalten….
**
Ich bleibe dabei: da trollen ganz wenige sehr lautstark und überfluten Foren, wollen eine Mehrheit vorgaukeln, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Es ist sehr schade, und ich hoffe auf bessere Lösungen wie diese nun, aber verstehen tue ich diesen Schritt der NZZ in jedem Fall.
- Oberlehrerhaft
Der „NACH UMBAU“, der erinnert an ein Klassenzimmer mit einem Pädagogen. Der das Thema bestimmt und die SchülerInnen dürfen dazu Stellung nehmen. Wenn die Meinung dem Lehrer nicht passt, kommt seine Korrektur. Mit Zeit werden alle wissen, wie die Meinung geäußert werden soll, damit es keinen Tadel gibt.
- Lob für die NZZ: Gut für die Demokratie
Ah tut das gut, nicht mehr all diese Hasskommentare lesen zu müssen. Danke NZZ!
**
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber sehr oft handelt es sich in solchen Kommentaren nicht um Meinungen, sondern um falsche Tatsachenbehauptungen. Dass jemand z. B. „meint“, die Erde sei eine Scheibe, ist nicht mitteilenswert und deshalb auch nicht publikationswürdig. Danke für die kluge Entscheidung!
**
Ich denke, der Schritt macht Sinn. Es ist tatsächlich müßig immer wieder denselben Verlauf von Diskussionen zu verfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass später ein schrittweiser Ausbau stattfindet zu wieder mehr Themen, die kommentiert werden können.
Wesentlich wichtiger fände ich aber den Zugang zur Kommentarfunktion von Klarnamen abhängig zu machen. Wer eine persönliche Meinung hat, der kann in der Schweiz auch dazu in seinem Namen stehen. Wir haben Meinungs- wie Pressefreiheit. Wer zu seiner Meinung nicht stehen kann und auf Fantasienamen ausweicht, dem sollte im NZZ Forum keine Plattform geboten werden. Alleine damit wären viele Trolle und Diskussionszersetzer Geschichte.
**
Die Demokratie lebt vom Niveau der Auseinandersetzungen. Je höher das Diskussionsniveau, desto besser für die Demokratie. Die neuen Regeln heben das Diskussionsniveau unter den Leserkommentatoren der NZZ. Darum ist der Umbau ein guter Weg für die Demokratie.
- Zu teuer für die NZZ
Warum soll man immer diskutieren müssen, statt einfach nur die eigene Meinung mitteilen zu können? Solange dies einigermaßen manierlich passiert, ist doch dagegen nichts einzuwenden! Wer die Meinung teilt, kann den Beitrag liken, andere können ihre abweichende Ansicht publizieren. Ich glaube, der NZZ sind einfach die Kosten für eine seriöse Triage der eingehenden Kommentare zu hoch geworden.
- Noch eine Echokammer
Die Entscheidung ist teilweise nachvollziehbar. Die Grenzen des guten Geschmacks wurden zuletzt gerade von politisch eindeutig voreingenommenen Kommentatoren regelmässig überschritten und Andersdenkende mit unflätigen Kampfbegriffen eingedeckt.
Vielen Dank an alle, denen es in den letzten Jahren an dieser Stelle nicht um Stimmungsmache, sondern um den Austausch von Argumenten gegangen ist.
Eins der besseren Foren verschwindet also. Das nachfolgende Konzept wird zu Recht mit einiger Skepsis betrachtet. Wohin geht die Reise?
Bereichernder Dialog oder nur eine weitere Echokammer? Alles Gute Ihnen allen.
- Selbstüberschätzung der Leser: Das Volk ist nicht Gott
Aus vielen Leserkommentaren zu diesem Artikel spricht eine maßlose Selbstüberschätzung. Viele glauben, für „das Volk“ zu sprechen und einer setzt „das Volk“ gar mit Gott gleich.
Es ist wichtig, als Leser die eigenen Grenzen zu erkennen. Die Journalisten haben ein einschlägiges Hochschulstudium absolviert. Die NZZ-Korrespondenten haben vor Ort Kontakt zu den verschiedenen Akteuren. Sie besuchen die Schauplätze des Geschehens. Sie studieren die aktuelle wissenschaftliche Fachliteratur. Sie können viel Zeit für die Beobachtung ihres Berichtsgebiets einsetzen. Im Gegensatz dazu scheinen viele Leserkommentatoren einfach am Feierabend im Internet nach Belegen für ihre vorgefassten Meinungen zu suchen. Die Qualität solcher Quellen können sie aber kaum beurteilen.
Kritisch zu sein ist immer gut, aber man sollte vor allem auch selbstkritisch sein.
- Besser als Leserbriefe
Weil ich die Leserbriefe in der Zeitung täglich prioritär anschaue, kann ich bei kontroversen Themen feststellen, dass es nur Leserbriefe schaffen, die meist nahe an der Meinung des Blattes orientiert sind, bzw. sich nur sehr gemäßigt kritisch äußern.
Dagegen habe ich, besonders hier in der NZZ, zahlreiche interessante Aspekte aus den sachlichen Diskussionen mitnehmen können, die in den redaktionellen Beiträgen keine oder nur randliche Erwähnung fanden, m.E. aber kritisch und problemrelevant waren.
Dazu ein anderer Leser:
Ihre Sorge kann ich nicht teilen. Ich bin seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Zeitungsleser und mein erster Blick galt den Leserbriefspalten. Dort standen oftmals zusätzliche Informationen, formuliert in höflicher Sprache und abgewogen in der Argumentation. Von Sterilität keine Spur. Diese Kultur ist durch Trolle und Hate-Speech fast völlig vernichtet worden. Der Hass und die Verachtung, die sich stattdessen breit machten, taten mir psychisch weh. Halten Sie das für erstrebenswert? Ich bin für höflichen Umgang; auf Pseudo-„Ärgernisse“ kann ich verzichten.
- Ein Leser-Rat
Liebe NZZ, ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es mit der Bildung eines ständig wechselnden und per Los bestimmten Gremiums von Kunden/Lesern, die an diesem Kommentarforum mitwirken? Das wäre im Sinne dieses Artikels (http://www.zeit.de/2017/04/rec… ), den ich absolut genial finde, doch mal eine basisdemokratische Beteiligung, an der wohl kaum jemand etwas Kritikwürdiges finden könnte. Natürlich sollten nur identifizierte Personen an dem Losverfahren teilnehmen können
Zum Ende: Orwell
Die Begründung „wir bauen nicht ab, sondern um“ ist Neusprech. Orwell lässt grüssen.
NZZ-Redakteur Fuchs antwortet:
Danke für Ihren Kommentar. Sie vergleichen meine Worte mit denen einer absoluten Diktatur. Ein gelungenes Beispiel für das, was wir nicht sonderlich konstruktiv finden.
**
Dazu auch meine Kress-Kolumne JOURNALISMUS!
Die Erben wollen nicht einsteigen: Süderländer Tageblatt verkauft
Vor einem Jahrzehnt wäre der Verkauf einer Zeitung ein öffentliches Thema gewesen, sogar für die nationalen Zeitungen – selbst bei einer kleinen Zeitung mit einer Auflage von fünftausend. Heute merkt es gerade mal die Gewerkschaft Verdi und meldet es auf einer Regionalseite im Internet: „Märkischer Zeitungsverlag (Ippen-Gruppe) übernimmt Süderländer Tageblatt aus Plettenberg“; die Meldung stand am 30. Januar im Netz, einen Monat nach der Übernahme.
Offenbar ist das Verschwinden einer „publizistischen Einheit“ so normal geworden wie die Streichung von Mantel- und Lokalredaktionen, Ressorts und Stellen. Wir haben uns gewöhnt.
In Plettenberg sind keine Stellen gestrichen worden, gleichwohl ist die Übernahme ein Thema wert: Warum verschwindet die beste der kleinen Lokalredaktionen in einem Konzern? Warum gibt eine Verleger-Familie nach 137 Jahren auf?
„Aus wirtschaftlicher Sicht bestand nicht der geringste Grund, den Zusammenschluss zu suchen“, so Stefan Aschauer-Hundt, Geschäftsführer und Chef der Redaktion.
Die Kinder als Erben wollen nicht mehr, in der Verwandtschaft will auch keiner, die erfolgreiche Zeitung weiterführen: Also blieb nur der Verkauf.
Dabei ist das Süderländer Tageblatt ein Edelstein: Dreimal auf der Siegerliste des Deutschen Lokaljournalistenpreises wegen tiefer und überraschender Recherchen, die Bürger zum Nachdenken und Mitmachen animieren; einmal der Ralf-Dahrendorf-Preis, den Redaktionen bekommen, die unsere Demokratie stärken.
Die Redaktion steht vorbildlich für guten Lokaljournalismus: Kein Zeigefinger, keine Überheblichkeit, keine Kampagnen – einfach tiefe Recherche und klare Analyse, um den Bürgern das eigene Urteil zu ermöglichen.
So sieht es auch Stefan Aschauer-Hundt, der Chef der Redaktion bleibt: „Ich glaube an das Aufleuchten der post-postfaktischen Zeit und daran, dass die Sehnsucht nach Analyse und Einordnung wiederkehrt. Demokratie und Journalismus unterliegen einer stetigen Wellenbewegung. Wir segeln dabei mit, gar keine Frage. Und unser Anspruch ist es, uns auf der Welle zu befinden!“
Das Interview mit Stefan Aschauer-Hundt in meiner Kolumne JOURNALISMUS! auf kress.de: https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/137044-die-kolumne-von-paul-josef-raue-warum-die-beste-kleine-lokalzeitung-nach-137-jahren-verkauft-wurde.html
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?














 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von