Leyendecker: Alltag eines Lokalredakteurs ist schwieriger als der eines Spiegel-Reporters
Hans Leyendecker war einer der großen Investigativ-Reporter in Deutschland, erst beim Spiegel, dann bis zum Ruhestand bei der Süddeutschen Zeitung. Foto: Wjournalist 2014
Im Journalismus gibt es unterschiedlichste Formen von Leistungsdruck. Wenn ein Redakteur in der Lokalredaktion täglich drei Seiten füllen muss, dann ist das für mich echter Druck. Ein Lokalredakteur muss ja nicht nur die Beiträge von nicht einmal freien Mitarbeitern völlig umbauen, sondern am Ende des Tages müssen drei Lokalseiten mit möglichst interessanten News gefüllt sein. Welchen Druck hat im Vergleich dazu derjenige, der beim Spiegel fünf Wochen lang an einem Ort verweilen kann, um eine anständige Geschichte zu liefern?
Hans Leyendecker im Interview mit dem journalist auf die Frage: „Relotius soll nach seiner Enttarnung gesagt haben: ,Es ging nicht um das nächste große Ding. Es war die Angst vor dem Scheitern.‘ Spricht so ein Statement für einen extremen Leistungsdruck im Journalismus?“
Journalisten wie Relotius, so Leyendecker, seien „verdammt privilegiert“:
Der Alltag eines Lokalredakteurs ist dagegen viel schwieriger, viel komplizierter, aber genügend Leute meistern den tagtäglichen Parforceritt mit Bravour. Ein Relotius hat in meinen Augen keine Ahnung davon, was Druck wirklich bedeutet.
„Literarisierende Ausgriffe“ – Der neue Reportagen-Ton?
Oliver Jungen bespricht in der empfehlenswerten FAZ-Rubrik „e-LEKTÜREN“ das E-Buch von Alexander Krützfeldt: „Acht Häftlinge – Leben in einer Parallelwelt“, er lobt die „spannenden, crowdfinanzierten Reportagen“, aber kritisiert als „leicht störend… gelegentliche literarisierende Ausgriffe (die Droge Crystal Meth als eifersüchtige Geliebte), zu denen sich das Genre seit dem New Journalism berufen fühlt“.
Nun ist der deutsche „New Journalism“ eine Feuilleton-Erfindung, doch weist Jungen auf eine wohl deutsche Reportage-Eigenart hin: Der Reporter wäre gerne ein Schriftsteller, einer aus der gehobenen Klasse der Literaten, so wie der Politik-Reporter heimlich gerne Politiker wäre.
Der „New Journalism“ kommt aus den USA, wo sich Journalisten und Literaten schon immer nahe standen und von einem ins andere Lager hüpften. Ist man in Deutschland schon ein Literat, wenn man als guter Reporter ein E-Buch schreibt?
Krützfeldts Buch lobt Jungen zu Recht:
„Das Gefängnis ist nicht einfach ein Abbild der Gesellschaft, sondern eine Verzerrung in Richtung Naturzustand, eine atavistisch nach Kampfstärke strukturierte Gemeinschaft.“
Rowohlt Rotation, E-Book 2,99 €
Christoph Waltz über den kleinen Mann ohne Geschichte
Jeder Mensch hat eine Geschichte, die man erzählen kann. Das könnte eine Reporter-Weisheit sein, vor allem Lokaljournalisten würden zustimmen.
„Der kleine Mann aus Omaha verdient es überhaupt nicht, dass seine Geschichte erzählt wird – wenn es keine interessante Geschichte ist“, sagt dagegen Christoph Waltz, Deutschlands berühmtester Schauspieler, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.
Wenn die Geschichte des kleinen Manns erzählenswert ist: „Ist er dann noch ein kleiner Mann?“, fragt Christoph Waltz. „Ist er nicht in dem Moment groß, in dem wir seine tolle Geschichte ins Zentrum einer Erzählung rücken?“
Christoph Waltz spielt eine Nebenrolle in dem Film von Alexander Payne: „Downsizing“; erzählt wird die Geschichte von Menschen, die auf 12 Zentimeter geschrumpft sind. Für Waltz ist der Film weniger ein Appell für mehr Umweltschutz, als
„eine Metapher für die menschliche Denkweise: Eigentlich sollte seit Kopernikus bekannt sein, spätestens aber seit der Aufklärung, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Gerade durch die digitale Revolution, bei der jeder Mensch in der Lage ist, seine Meinung überall öffentlich kundzutun, ohne dafür geradestehen zu müssen, neigen viele Menschen wieder dazu, sich für das Zentrum des Universums zu halten. Genau wie vor der Aufklärung.“
Waltz empfiehlt einen „wunderbaren Aufsatz von Wilhelm Reich aus den späten Vierzigern: Rede an den kleinen Mann“, in dem Reich zu einem Menschen, der sich machtlos fühlt, sagt: „Du bist nur klein, weil du dich klein machst. Die anderen, die du für groß hältst, sie sind genauso klein. Du bist derjenige, der sie als groß akzeptiert.“ Das sei das beste Mittel gegen die Machtlosigkeit – „Die anderen klein machen.“
Christoph Waltz liest offenbar viel, Geschichten über Größenwahn und Demut, Erfolg und Misserfolg – und empfiehlt Brechts „Leben des Galilei“: Der kleine Mönch sagt seinen Eltern die Wahrheit über die Welt.
„Sie hätten sich plötzlich aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes verstoßen gefühlt. All das Leid, die Mühsal, die Menschen willig ertragen haben, sind ohne einen Gott nur mehr unerträgliche Willkür.“
Quelle: Süddeutsche Magazin, 19. Januar 2018 „Maul halten und Hirn einschalten“
+++++
Nachtrag:
Reporterlegende Kai Hermann («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») beschäftigte sich immer wider mit Außenseitern, berichtete aus Krisengebieten im Nahen Osten und über den jugoslawischen Bürgerkrieg. „Jeder Mensch ist eine Geschichte, das habe ich gelernt“, lautet sein Fazit. „Und: Gut und Böse gibt es nicht in der realen Welt.» (dpa, 24-1-18)
Schulz-Story im Spiegel verkaufte sich überdurchschnittlich gut – Die Blattkritik

Heft 40/2017 – Eines der meistverkauften Spiegel-Hefte in 2017 – dank der Story über den gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz.
Rund 800.000 Hefte hat der Spiegel verkauft mit „Schulz Story – 150 Tage an der Seite des Kanzlerkandidaten – eine große Erzählung über Politik im Jahr 2017“. Am Kiosk verkaufte das Heft 40/2017 weit mehr als der Durchschnitt in diesem Jahr. Auch bei Blendle war die Schulz-Story der am besten verkaufte Artikel im Oktober. Exzellenter Journalismus ist also auch ökonomisch wertvoll.
In meiner JOURNALISMUS!-Kolumne bei kress.de habe ich in einer Blattkritik analysiert, warum die Reportage so fasziniert – und warum sie wichtig ist für Bürger, Demokratie und Journalismus.
Spiegel-Reporter Markus Feldenkirchen begleitete den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz fast ein halbes Jahr und war überall dabei – auch bei Gesprächen, von denen sonst Journalisten ausgeschlossen sind. Die Reportage ist mit rund 13.000 Wörtern umfangreich wie ein kleines Buch; die Hörfassung mit gut anderthalb Stunden Dauer würde nicht einmal auf eine CD passen. Hier die Kolumne, leicht überarbeitet:
Wahlabend. Merkel und Schulz verlassen die TV-Elefantenrunde. Mit der eindrucksvollsten Passage der Geschichte endet die Langzeit-Reportage von Markus Feldenkirchen über den Kandidaten Martin Schulz:
Nach der Sendung gibt er der Frau, die er eigentlich ablösen wollte, kurz die Hand und verschwindet ohne ein weiteres Wort. Er läuft auf den nächstbesten Aufzug zu, aber er darf nicht einsteigen, eine Frau verweigert ihm den Zutritt: „Dieser Aufzug ist für die Frau Bundeskanzlerin reserviert.“
„Ach so, klar, da kann das gemeine Volk natürlich nicht mitfahren“, sagt Schulz. „Ich nehme dann den normalen Aufzug.“
In diesen Sätzen konzentrieren sich die Stärken der Reportage: Der Journalist nimmt sich zurück, beobachtet genau und lässt seinen Helden sprechen, der zum Anti-Helden geworden ist. Der Reporter kommentiert nicht, er lässt die Szene unvermittelt auf den Leser prallen. Die Auswahl ist der Kommentar des Reporters, das, was er aus Tausenden von möglichen Szenen für seinen Artikel nutzt.
Markus Feldenkirchen hätte sicher gerne das letzte Wort gehabt: Fast sechs Monate hat er den Kandidaten Schulz begleitet, war bei Gesprächen dabei, von denen ihn die Berater des Kandidaten gerne ausgeschlossen hätten. Feldenkirchen formuliert den letzten Satz nicht selber, er zeichnet kein sprachliches Bild, das bei Preisverleihungen zitiert würde: Er lässt im Kopf des Lesers einen kleinen Film entstehen, mit Martin Schulz in der Hauptrolle. Dieser Film bleibt im Kopf.
Und wenn Martin Schulz sogar Kanzler geworden wäre – als Wahlsieger?
Der Reporter, der im Hintergrund bleibt, ähnelt einem Schiedsrichter beim Fußballer, der nicht auffällt, der einfach mitläuft und denen, die spielen, die Hauptrolle überlässt. Das gelingt Markus Feldenkirchen über weite Passagen der Reportage, aber immer mal wieder setzt sich Kommentator durch, der dem Leser unbedingt mitteilen will, wie eine Geste, ein Satz, eine Szene zu deuten ist.
Um 15 Uhr trifft Schulz am Flughafen Schönefeld ein. Er steht vor seinem Wagen, schaltet sein Handy an. Es dauert einen Moment, dann sieht er auf dem Display die Frühprognosen der Meinungsforscher. Es ist, nun auch offiziell, das Ende seiner Kanzlerträume.
Das ist eine solide Beschreibung der entscheidenden Szene am Sonntag der Wahl. Der Leser weiß Bescheid, er braucht keinen Kommentar, auch keine Analyse, dass dies das Ende ist. Aber da kann sich der Reporter nicht mehr zurückhalten, es bricht aus ihm heraus, er schreibt, was der Leser denken soll:
Es ist nicht seine Schuld, dass er den europaweiten Trend nicht umkehren konnte, wonach viele der Sozialdemokratie nicht mehr zutrauen, die richtigen Antworten auf das Zeitalter der Digitalisierung zu haben. In den knapp 200 Tagen, die er nun Parteivorsitzender ist, ist das nicht zu leisten, erst recht nicht in den irren Zeiten des Wahlkampfs. Vielleicht wäre ein Kandidat mit weniger Stehvermögen und Leidenschaft in dieser Stimmungslage sogar noch sehr viel tiefer ins Ziel gekommen.
Über diese Fragen können Journalisten lange streiten: Wie viel Deutung darf in eine Reportage fließen, wie viele kommentierende Sätze? Wie stark darf man den Leser führen? Soll man ihm nicht sein Urteil selber finden lassen?
Eine starke Reportage fasziniert durch ihre Erzählung und einen Ton, der nicht belehrend klingt. Das fällt jedem schwer, der ein halbes Jahr einen Politiker begleitet, der am Ende schon so denkt und fühlt wie er: Da löst sich die Distanz auf.
Wenn ständig schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, erhalten die wenigen positiven eine umso größere Bedeutung. Sie wirken wie Antidepressiva gegen die Strapazen und das Gefühl von Vergeblichkeit. Auch wenn Schulz bisweilen in emotionale Löcher sackt, schafft er es immer wieder, sich selbst zu begeistern.
Da beobachtet der Reporter nicht mehr, da spricht schon ein Alter Ego – ebenso wie in diesem Satz:
Er hält eine mitreißende Rede, die Leute feiern ihn. Niemand ahnt, wie es in ihm aussieht.
Der Reporter ahnt es nicht nur.
Es gibt Szenen, in denen der Leser nicht mehr weiß, wer spricht: Schulz oder Feldenkirchen? Als nach der Schleswig-Holstein-Wahl Jörg Schönenborn von der „regionalen Komponente“ spricht, die den Wahlausgang bestimmte:
„Aha“, ruft Schulz. Er hält den Finger in die Luft. „Das ist ’ne interessante Analyse.“ Regionale Komponente bedeutet: SPD-Ministerpräsident Torsten Albig, der auf die falschen Themen gesetzt und ein unfassbar dämliches Interview zu seiner gescheiterten Ehe gegeben hat, ist schuld. Nicht er. Es ist ein klitzekleines Stück Hoffnung an einem trostlosen Tag.
Keinen Konjunktiv nutzt der Autor, diese Eigenart der deutschen Grammatik, eine indirekte Rede markierend: Da denken und fühlen offenbar Schulz und Reporter ähnlich „an einem trostlosen Tag“.
Markus Feldenkirchen schreibt durchgehend im Präsens, er geht chronologisch vor: Das mögen Reporter nicht, ist den meisten zu brav, zu simpel. Doch in der Erzählung eines Wahlkampfs, die ein halbes Jahr umfasst, ist die Chronik der beste, weil einfache Weg: Der Aufstieg und Fall des Helden hat Shakespeare-Format. Das erspart dem Schreiber komplizierte Rückblenden und den wenig schönen Plusquamperfekt.
Er sitzt in seinem Büro. Wieder läuft der Fernseher, wieder eine Niederlage, diesmal die schlimmste, in Nordrhein-Westfalen, Kernland der SPD. „Das Leben ist wie eine Hühnerleiter“, sagt Schulz. „Beschissen.“ Niemand reagiert, Stille im Raum. „Ich bin jetzt königlicher Niederlagenkommentator.“
Feldenkirchen verlässt zwar selten, aber unnötig, den Chronik-Modus und wechselt die Perspektive, interpretiert Episoden mit dem Wissen dessen, der den Ausgang kennt – wie die Leser. Zur Kampagnen-Unterbrechung während der Landtagswahlkämpfe lässt der Reporter Schulz aus dem Off des Nachhinein sprechen:
„Das war falsch“, sagt Schulz im Rückblick. „Wir hätten das weitermachen müssen.“
„Wie man inzwischen weiß“, so wird auch das TV-Duell aus dem Nachhinein beurteilt: So verlässt Markus Feldenkirchen den Strom der Erzählung. Die Reportage ist aber keine Analyse einer verlorenen Wahl, es ist die Geschichte von Aufstieg und Fall, von Wegen, Umwegen und Holzwegen. Der Vorteil von gradlinig erzählten Geschichten ist: Das Erzählen ohne erhobenen Zeigefinger, ohne dies „Ich weiß alles besser“. Im Nachhinein ist jeder klüger: Das ist die Haltung der Leitartikler, der Besserwisser.
Trotz einiger Einwände, die ein guter Redigierer hätte entdecken müssen:
Diese Langzeit-Reportage im „Spiegel“ ist ein journalistischer Glücksfall – mehr noch: Eine Liebeserklärung an die Politik in diesen unruhigen Zeiten, eine Verbeugung vor der Demokratie. Sie holt die Politiker vom Sockel, macht dem letzten AfD-Anhänger klar, dass Politik Menschenwerk ist – und so gesehen und respektiert werden sollte.
Markus Feldenkirchen sollte aus der Reportage ein Buch machen mit all den Geschichten, die es noch zu erzählen gibt.
„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über die Schulz-Story: Eine Geschichte, von der Reporter träumen
Feldenkirchen konnte mit Schulz im Taxi, im Flugzeug und zu Fuß reisen, ihn zu 50 Terminen begleiten; Strategiesitzungen, späte Currywurst-Dinner, ein letzter Kaffee (beziehungsweise Kräutertee, durch Inge Schulz ausgetauscht) am Wahlsonntag auf der Terrasse in Würselen inklusive. Fünf Monate lang war Feldenkirchen immer auf Abruf, Spontaneität ist ja alles im Wahlkampf. Häufig bekam er von Schulz oder einem seiner Leute 15 Minuten vor einem Treffen, einer Besprechung, einem Aufbruch einen Anruf. Am Ende der langen Tage war der Reporter stärker erschöpft als der Kandidat. „Wie soll das später eigentlich heißen, was Sie da schreiben: So wird man Oppositionsführer?“, fragte Schulz im August.
Es gab keine Tabus, nur die Wirklichkeit der Politik im Jahr 2017 und die eine Absprache, dass der Text erst nach der Wahl erscheinen dürfe. Und so ist eine dieser Geschichten entstanden, von denen Reporter und Chefredakteure träumen. Weil sie bleiben werden. Weil sie erzählen, was wirklich geschah.
Anfangs war Martin Schulz übrigens, natürlich, zögerlich gewesen. Der Kollege Feldenkirchen und ich hatten den Kandidaten in Hannover getroffen und ihm von der Idee erzählt; ich hatte einen Text des „New Yorker“-Chefredakteurs David Remnick in der Tasche, den dieser über die letzten Amtstage Barack Obamas geschrieben hatte, eben weil Obama dem Kollegen Remnick die Möglichkeit dazu gegeben hatte.
So etwas funktioniert ja nur mit Zugängen. Und mit Ernsthaftigkeit. Und wenn beide Seiten glauben, dass Politik, dass überhaupt Macht sich nicht abschotten darf. Zugänglich sein muss. Verletzlich sein darf. Dass eben hierin Mut liegt. Schulz‘ Umfeld war gegen das Projekt: viel zu riskant. Das war selbstverständlich nachvollziehbar.
Also vergingen drei Wochen. Dann sagte Schulz: „Wir machen das.“ Und in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit hielte ich es für gut, wenn sehr viel mehr Politiker sehr viel mehr Transparenz und Einblicke zuließen. Damit die Bürger erkennen könnten, dass es sich bei denen da oben um Menschen handelt, mit Stärken und Schwächen, mit Zweifeln und Überzeugungen; und damit die Politiker erkennen könnten, dass es nur der AfD hilft, wenn Imageberater und Pressestellen die Schwächen und die Zweifel verdecken wollen.
(Klaus Brinkbäumer in „Zur Lage“, dem Morgen-Newsletter des „Spiegel“ am 30. September 2017)
Eine vorbildliche Reportagen-Reihe: Die 10 Gebote, in die Gegenwart übertragen
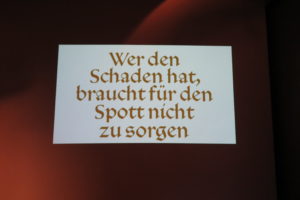
Luthers Beitrag zur Neid-Debatte: Eine Tafel aus der Ausstellung „Luther und die Sprache“ auf der Wartburg 2016
Lasst uns über die Veränderung in der Gesellschaft nachdenken, über den Verlust der Werte! Das gelingt Zeitungen nur sporadisch, sie sind immer noch auf Aktualität ausgerichtet – und je unruhiger die Zeiten, umso mehr konzentrieren sich Zeitungen auf die Aufregung und Erregung des Tages.
Die Braunschweiger Zeitung hat eine nachahmenswerte Idee: Wir produzieren eine Zeitung auch für den Feiertag, an dem die Menschen Zeit und Muße zum Lesen haben, also beispielsweise heute am Reformationstag – nicht über Luther (über ihn gab’s mehr als genug), sondern über Werte, Veränderung und das Beständige, eben über das, was auch immer wieder Luthers Thema war.
Auf 22 Seiten, nahezu frei von Anzeigen, geht es um Werte und Wandel – allerdings nur am Rande mit Analysen, Theorien und Wertungen. Die Reporterin Katrin Schiebold erzählt auf der Hälfte der Seiten von Menschen: Was verändern sie? Wie werden sie verändert? Was macht ihnen Mut? Was lässt sie verzweifeln?
Der rote Faden ist ein uralter Werte-Kanon: Die Zehn Gebote – auf einer Seite geht es um je ein Gebot, wird ein altes Gesetz in die Gegenwart und ihre Geschichten übertragen:
1 – Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Die Reporterin trifft sich mit Christen und Atheisten und lässt sie erzählen: Warum glaubt ein Mensch? Warum widersteht er?
Das 2. Gebot, das wohl schwierigste: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.“
Katrin Schiebold erzählt von Jugendlichen, die den Verlockungen von Islamisten erliegen, und ihren Familien.
3 – Du sollst den Feiertag heiligen.
Ein Pfarrer und ein Ex-Fußballprofi von Eintracht Braunschweig erzählen, warum der Sonntag als Ruhetag wichtig ist. Docj die Gesellschaft ist gespalten: Viele Geschäfte wollen am liebsten jeden Sonntag öffnen.
4 – Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Wie geht es Kindern, die nur noch Mutter oder Vater stets in ihrer Nähe haben oder vom Jugendamt „erzogen“ werden.
5 – Du sollst nicht töten.
Eine Oberstaatsanwältin versucht zu verstehen, warum Menschen töten. Es sind erzählende Sätze wie diese, die den Wert der Reportagen ausmachen, kühl, aber nicht kalt, nicht wertend, denn dies gelingt dem Leser besser im Gespräch mit sich selbst:
Der Angeklagte hält sein Holzkreuz in den Händen, er zeigt keine Reue, kaum eine Regung. Dabei wäre das so wichtig gewesen für seine zehn Kinder, die während des gesamten Prozesses vor dem Braunschweiger Landgericht vergeblich auf eine Erklärung des 54-Jährigen warten. Warum hat er ihre Mutter in der katholischen Kirche in Braunlage getötet? Warum hat er versucht, sie mit Medikamenten zu vergiften, schließlich das Gewehr auf sie gerichtet und geschossen, warum hat er einen seiner Söhne und seine zwölfjährige Tochter dazu gezwungen, das Blut wegzuwischen und die Leiche fortzuschaffen? Warum macht ein Mensch so etwas?
Warum?
Es gibt Taten, die so grausam sind, dass sie selbst routinierte Kriminalisten und Ermittler fassungslos machen. Der Mord an der Küsterin in Braunlage vor fünf Jahren gehört dazu. Kirsten Böök hatte damals als Oberstaatsanwältin die Ermittlungen geleitet. „Der Fall war auch deshalb so ungeheuerlich, weil der Täter eiskalt vorging“, sagt sie. Er habe seine Kinder instrumentalisiert, sie dazu gezwungen, die Spuren seiner Tat zu beseitigen. Außerdem habe er seinen Sohn belastet, um die Schuld von sich zu nehmen.
6 – „Du sollst nicht ehebrechen“.
Eine Wolfsburger Standesbeamtin erzählt von der Trauung – und ein Braunschweiger Familienrichter von Scheidungen.
7- „Du sollst nicht stehlen.“
Vom Datendiebstahl berichtet ein Verfassungsschützer in einem Interview.
8 – „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“
Cybermobbing trifft viele junge Menschen, aber nicht nur sie. Wer Opfer wird, kann sich nur schwer von der Schmach befreien.
Paul und Celina sind ein Paar, doch dann trennt sich der 16-Jährige von seiner Freundin, weil er eine andere kennengelernt hat. Für Celina bricht eine Welt zusammen, sie ist gekränkt, verletzt, eifersüchtig. Abends sitzt sie in ihrem Zimmer, sucht nach einem Ventil, ihrer Wut und Verzweiflung Luft zu machen. Sie nimmt ihr Smartphone, öffnet eine WhatsApp-Gruppe und tippt: ,Paul hat mich vergewaltigt.‘ Der Satz verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Es kommt zu strafrechtlichen Ermittlungen. Am Ende stellt sich heraus: An dem Vorwurf ist nichts dran, Celina hat sich dafür rächen wollen, dass Paul sie verlassen hat. Doch der Vorwurf ist in der Welt.“
9 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.“
Ein Neidforscher erklärt, warum sich Menschen ständig miteinander vergleichen – und wann ein Vergleich zum Neid wird.
10 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat“.
Partnervermittlungen im Internet – und der Seitensprung, der doch die Ausnahme ist.
Eine Reportagen-Reihe – zum Nachahmen empfohlen – nicht nur an Feiertagen. Wer keine komplette Ausgabe damit produzieren kann, dem ist eine Serie über Tage und Wochen zu empfehlen. Sie kommt den Lesern sogar mehr entgegen: Wie viele nehmen sich die Zeit, stundenlang eine Zeitung zu lesen, prall mit exzellenten Geschichten gefüllt?
Schlag nach im „Handbuch des Journalismus“: Leser-Kritik an einer Wahlkampf-Reportage
Wer im Wahlkampf eine Reportage schreibt, sogar locker, vielleicht auch flockig mit Kandidaten und Emotionen umgeht, den kritisieren Leser schnell: Das ist kein guter Journalismus; der sei sachlich, objektiv und langweilig.
In der Braunschweiger Zeitung schrieb eine Leserin zu der Reportage „Martin Schulz – wie ein Popstar umjubelt“ (15. September 2017):
„Betrachte alles von der guten Seite“, ist meine Devise. Bei oben genanntem Artikel ist das allerdings unmöglich. Dass alles, was in den verschiedenen Medien geschrieben oder gesprochen wird, nicht der Meinung aller entspricht, ist nicht zu ändern und gut so. Gleichwohl gilt auch für Journalisten, sich an Regeln zu halten, die guten Journalismus ausmachen. Den publizistischen Grundsätzen im Pressekodex ist zu entnehmen, dass Journalisten ihre publizistische Aufgabe fair, nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahrnehmen sollten.
Trifft das auf den genannten Artikel zu? Dort schreibt Frau Richter (die Reporterin) unter anderem: „kühner Herausforderer“, „selbst ein dänischer Journalist“, „keck im offensichtlichen Parkverbot“, „außergewöhnliche Vorgänge“, „lugen … finster drein“, „heftig am Bierzelt zerrt“, „behilft sich mit Spickzettel“, „korrigiert er auf Zuruf“, „spult seine Rede nicht herunter“.
Der Ombudsrat der Zeitung nahm sich des Falls an und bat die Reporterin Ann Claire Richter, Stellung zu nehmen (14. Oktober 2017):
Ich bedauere sehr, dass der Leserin mein Text zum Wahlkampfauftritt von Martin Schulz missfällt. Möglicherweise hat sie zu diesem Anlass einen nüchternen nachrichtlichen Bericht erwartet, wie er vielfach auf unseren Politikseiten zu finden ist. Mein Auftrag aber war es, eine Reportage für den Lokalteil zu schreiben, die die Atmosphäre bei diesem Politiker-Besuch einfangen sollte.
Während eine Nachricht oder ein Bericht Distanz wahren müssen, dürfen Reportagen ausdrücklich sehr nah und bildhaft an das Geschehen heranrücken. Es gilt sozusagen, mit Worten einen Film im Kopf des Lesers zu erschaffen. Im „Handbuch des Journalismus“ von Wolf Schneider und Paul-Josef Raue ist die Reportage unter der Rubrik „Die unterhaltende Information“ zu finden.
Formulierungen wie „er spult seine Rede nicht herunter“ oder „Wind, der heftig am Bierzelt zerrt“ in meinem Text widersprechen meines Erachtens also nicht den Regeln, die guten Journalismus ausmachen.
In der Kritik wird jedoch deutlich, woran sich Leser reiben:
- Wertungen des Redakteurs, also versteckte Kommentare, mögen nur Leser, die die Perspektive des Redakteurs teilen. „Keck im offensichtlichen Parkverbot“ liest sich flott und neckisch, aber macht deutlich, dass der Journalist den Politiker als hochmütig bewertet: Er kümmert sich nicht wie ein einfacher Bürger um ein Verbot. Bei solchen Adjektiv- und Adverb-Ansammlungen lohnt die Gegenprobe: „Der Politiker stellt sich ins Parkverbot“ – das ist genau beobachtet und überlässt die Wertung dem Leser, der „keck“ urteilt oder „frech“ oder „arrogant“.
- Nicht-Sätze meist vermeiden, stattdessen das beschreiben, was man sieht. „Schulz spult seine Rede nicht herunter“ schreibt der Redakteur. Nur – wie redet er wirklich?
- Adjektive meiden, die dem Leser den Standpunkt des Redakteurs aufdrängen wie „kühn“, „keck“, „außergewöhnlich“ und „finster“. Am besten nutzt man nur Adjektive, die beschreiben, wie ein rotes Buch oder ein weißes Hemd.
Die Reportage, vor allem in Kampfzeiten, soll anschaulich beschreiben, was ist, damit sich der Leser ein eigenes Bild machen – und sein eigenes Urteil bilden kann.
Interne Spiegel-Kritik: Wir müssen raus aus der Komfortzone der Redaktion?
Barbara Hans, Jahrgang 1981, ist Chefredakteurin von Spiegel Online. Foto: Iris-Carstenseniegel/Spiegel
Mittelalte, weiße Männer, gutverdienende Akademiker definieren und prägen die journalistische Realität und damit unsere Weltsicht. Was sie am besten kennen, das sind andere mittelalte, weiße Männer, mit Abitur und schicker Altbauwohnung. Was sie weniger gut kennen, das ist das Leben als Arbeiter in Herne Crange. Oder das Leben als lesbische junge Frau.
Spiegel-Online-Chefin Barbara Hans in einem Interview mit dem journalist (8/2017) – vielleicht an ihre Chefredakteure denkend? Sie fordert:
Wir müssen dahin, wo es weh tut. Raus aus der redaktionellen Komfortzone. Wir können nicht alles so lassen und hoffen, dass einige wenige Neueinstellungen zum Wandel führen werden.
Ist oder war der Spiegel nicht dafür bekannt, dass er zu den Rändern der Gesellschaft ging? Dass er sich Autoren leistete, als Storytelling noch ein unbekannter Anglizismus war? Was hat sich verändert?
Wir müssen Dinge für möglich halten, auch wenn wir sie für falsch halten. Und die Frage, was wir für richtig und was wir für falsch halten, sollte nicht unser Leitmotiv sein.
Das ist ein guter journalistischer Standpunkt. Aber passt er auch auf den Spiegel? Ist er nicht zur Institution aufgestiegen, weil er eine Meinung hatte, eine Haltung, wie es heute heißt? Oder haben sich die Leser gewandelt, die nicht mehr eine Haltung erwarten, sondern ein Pro&Kontra, also die Breite der Meinungen?
Was ist eine „gelenkte Reportage“?
Die Skyline von Pjöngjang, Hauptstadt Nordkoreas, sieht aus wie die einer westlichen Metropole. Foto: Uwe Brodrecht / Wikipedia
Das Programm von Journalisten in Nordkorea besteht aus Pflichtterminen unter Dauerbeobachtung durch Beamte des Aussenministeriums – freie Recherche gibt es nicht.
So schreibt Matthias Müller, Reporter der Neuen Zürcher Zeitung in seiner Reportage. Er schaut also genau hin, um die Widersprüche zu entdecken:
Der Angestellte der Taschen-Fabrik wurde rhetorisch nicht ganz so gut geschult: Auf die Frage, ob man eines Tages Gewinne erwirtschaften möchte, antwortet er unsicher, die Stimme wird immer leiser, bis er nur noch flüstert. Kapitalistisches Gedankengut verschlägt offenbar manchem Nordkoreaner die Sprache.
Im Newsletter am Morgen nennt die NZZ dies eine „gelenkte Reportage“, angelehnt an den Begriff des „Embedded Journalist“, der eingebettet ist in eine meist militärische Struktur; diese lässt ihm keinen Freiraum, schützt aber auch in einem Krieg. Erfunden hat diese „Einbettung“ die US-Armee im Irakkrieg 2003.
Gelenkter wie eingebetteter Journalismus widersprechen zwar den Regeln eines freien, von keinem beeinflussten Journalismus; gleichwohl unterwerfen sich Reporter der Gängelung, um in extremen Lagen der Wahrheit auf die Spur zu kommen und Widersprüche zwischen Schein und Wirklichkeit aufzudecken.
Wie Redaktionen mit Pressereisen umgehen und was der Pressekodex regelt

Pressereisen in attraktive Regionen sind beliebt: Das Höhlenkloster Garedshi in Georgien – Foto (nicht von einer Pressereise): Raue
„Ein Schaf für Gott, ein Schnaps für den Menschen“, titelte die FAZ am 9. März in ihrem Reiseteil über eine Fahrt in den Osten Georgiens. Eine halbes Jahr vorher hatte dieselbe Autorin von einer Reise nach Georgien in der Welt berichtet: „Die Urheimat des Weins“ (15. Oktober 2016). Die beiden Reportagen unterschieden sich zwar deutlich, doch fußten sie offenbar auf einer Pressereise des Veranstalters Via Verde.
Die Welt setzte unter die Reportage den Hinweis:
Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt von Via Verde. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter www.axelspringer.de/unabhaengigkeit
Die Regeln für Pressereisen hat der Springer-Verlag, zu der die Welt gehört, so festgeschrieben:
Einladungen, Geschenke und Pressereisen
Die Gefährdung unabhängiger journalistischer Arbeit durch persönliche Vorteilsnahme ist Gegenstand der Ziffer 15 des Pressekodex. Schon der Anschein, die Entscheidungsfreiheit von Journalisten könne durch Gewährung von Einladungen oder Geschenken beeinträchtigt werden, ist zu vermeiden.
Die Journalisten bei Axel Springer
- tragen dafür Sorge, dass alle Kosten (Reisekosten, Bewirtungen etc.), die im Zusammenhang mit Recherchen entstehen, grundsätzlich durch die Redaktion übernommen werden. Ausnahmen sind von der Chefredaktion zu genehmigen und in der Berichterstattung entsprechend kenntlich zu machen.
- nehmen keine Geschenke an, die den Charakter einer persönlichen Vorteilsnahme haben, oder geben diese – falls die Annahme unvermeidbar ist – an den Verlag weiter, der diese karitativen Zwecken zuführt.
Ein solcher Hinweis fehlt bei der FAZ-Reportage. Der Leser kann dies indirekt dem Info-Kasten entnehmen „In der Wildnis Georgiens“: Dort wird auf den Veranstalter hingewiesen mit Preisen und Web-Adresse. Reicht das?
In Ziffer 15, Richtlinie 15.1, schreibt der Pressekodex vor:
Wenn Journalisten über Pressereisen berichten, zu denen sie eingeladen wurden, machen sie diese Finanzierung kenntlich.
Im seinem Jahresbericht 2013 geht der Presserat ausführlich auf Pressereisen ein:
Ohne Transparenz geht es nicht. Die Offenlegung, auf wessen Kosten ein Journalist auf Recherche unterwegs war, ist erforderlich. Nur durch dieses Grundprinzip kann die Glaubwürdigkeit der Presse gewahrt werden.
Nur wenige Beschwerden gingen beim Presserat ein, „weil der Leser einen möglichen versteckten Einfluss bei der Berichterstattung schwer erkennen kann. Lediglich ein Hinweis wurde ausgesprochen, weil eine Regionalzeitung eine Reportage über eine Flusskreuzfahrt, zu der er von einem Veranstalter eingeladen wurde, nicht entsprechend gekennzeichnet hatte“.
Für den Presserat ist dies nicht nur ein Problem des Reisejournalismus. Sollen Recherchen überhaupt von Dritten finanziert werden? Es geht um Einladungen von Wirtschaftsunternehmen zu Bilanzpressekonferenzen im Ausland, Produktvorstellungen in der Elektronikbranche oder Vorstellungen von neuen Automodellen.
Christopher Schmidt, der SZ-Sprachgewaltige, ist tot
Christopher Schmidt, Literaturchef der Süddeutschen Zeitung, ist mit gerade mal 52 Jahren gestorben. SZ-Foto: Allessandra Schellnegger
Er pflegte eine manchmal mürrische, immer unbestechliche, auf bedauerliche Weise etwas aus der Mode gekommene Distanz.
Kann man Schöneres über einen Journalisten schreiben? Sonja Zekri ehrt so heute (2. März 2017) Christopher Schmidt, den Literaturchef der Süddeutschen Zeitung; er ist mit gerade mal 52 Jahren gestorben.
Sonja Zekri zeichnet auch das Gegenbild des abgehobenen Feuilletonisten, dem Schmidt eben nicht glich:
Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, aus seiner Nähe zu den Berühmten der Bühne, des Films, der Literatur Kapital zu schlagen, ihren Glanz auf sich abstrahlen zu lassen, ein strahlender Name hier, ein Fernsehauftritt dort, eine Whiskey-Runde nach der Vorstellung.
Schmidt war ein besonderer Journalist, ein besonders guter, mehr als ein Profi. „Viele Journalisten haben ein schwieriges Verhältnis zur Sprache, seines war obsessiv“, schreibt Sonja Zekri im Nachruf:
Seine Texte verrieten eine Sprachgewalt, die reichte, um Romane zu füllen, kein Bild war schief, gebraucht, auch nur vage bekannt. Für die Entlarvung des alltäglichen politischen, medialen oder sonstigen Sprachmülls erfand er eine eigene kleine Feuilleton-Rubrik, den „Phrasenmäher“, wo er das „Pimpen“, den „Spoiler-Alarm“ oder den „Atmenden Deckel“ in ihre Einzelteile zerlegte und wieder zusammensetzte.
Sie erinnert an sein schönstes Essay, das der schreibende Heimwerker der Schraube widmete: „Ein Lob an die Schraube – Kopf hoch!“, erschienen vor sieben Jahren. Schmidt beschreibt einen Schrauben-Laden in München:
Hier wird man gemaßregelt. Hier bemüht man sich nicht um den Kunden, hier beugen sich Gleichgesinnte über das obskure Objekt ihrer Begierde. Und Laien werden nur geduldet. Jeder Besuch im Schraubengeschäft: eine Lektion in Demut.
Das Ende des Essays taugt, wie der gesamte Text, zur Ausbildung von Redakteuren: Wie man über einem scheinbar unbedeutenden Gegenstand einen bedeutenden Artikel schreibt:
Es gehört zur spröden Poesie der Schraube, dass sie eines der wenigen Dinge ist, die unendlich sind in einer von Endlichkeiten beherrschten Welt, dass man bei ihr weiß, „um was es sich dreht“, und dass es Ozeane von Erfinderschweiß kostete, um härtesten Stahl so filigran zu formen, dass er an der Spitze ins Nichts übergeht.
Übersprungen sei hier das delikate Verhältnis zwischen der männlichen Schraube und ihrem weiblichen Gegenstück: der Mutter – wie die meisten Mutter-Sohn-Bindungen eine der wenigen perfekten Beziehungen. Aber auch, nachdem die Schraube zu ihrer heutigen Gestalt herangereift war, konnte man ihr noch zweihundert Jahre lang aus dem Weg gehen. Erst als das schwedische Möbelhaus „Ikea“ mit seinen Bausätzen das Wohnen revolutionierte, musste sich fast jeder irgendwann mit der Schraube auseinandersetzen. Denn sie öffnete den Weg in die Emanzipation.
Die instabilen Spezialschrauben von Ikea sind allerdings der Sündenfall in der Geschichte der Schraubverbindungen, und deshalb wurde Ikea zur Strafe an den Stadtrand verbannt.
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?














 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von