Schulz-Story im Spiegel verkaufte sich überdurchschnittlich gut – Die Blattkritik

Heft 40/2017 – Eines der meistverkauften Spiegel-Hefte in 2017 – dank der Story über den gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz.
Rund 800.000 Hefte hat der Spiegel verkauft mit „Schulz Story – 150 Tage an der Seite des Kanzlerkandidaten – eine große Erzählung über Politik im Jahr 2017“. Am Kiosk verkaufte das Heft 40/2017 weit mehr als der Durchschnitt in diesem Jahr. Auch bei Blendle war die Schulz-Story der am besten verkaufte Artikel im Oktober. Exzellenter Journalismus ist also auch ökonomisch wertvoll.
In meiner JOURNALISMUS!-Kolumne bei kress.de habe ich in einer Blattkritik analysiert, warum die Reportage so fasziniert – und warum sie wichtig ist für Bürger, Demokratie und Journalismus.
Spiegel-Reporter Markus Feldenkirchen begleitete den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz fast ein halbes Jahr und war überall dabei – auch bei Gesprächen, von denen sonst Journalisten ausgeschlossen sind. Die Reportage ist mit rund 13.000 Wörtern umfangreich wie ein kleines Buch; die Hörfassung mit gut anderthalb Stunden Dauer würde nicht einmal auf eine CD passen. Hier die Kolumne, leicht überarbeitet:
Wahlabend. Merkel und Schulz verlassen die TV-Elefantenrunde. Mit der eindrucksvollsten Passage der Geschichte endet die Langzeit-Reportage von Markus Feldenkirchen über den Kandidaten Martin Schulz:
Nach der Sendung gibt er der Frau, die er eigentlich ablösen wollte, kurz die Hand und verschwindet ohne ein weiteres Wort. Er läuft auf den nächstbesten Aufzug zu, aber er darf nicht einsteigen, eine Frau verweigert ihm den Zutritt: „Dieser Aufzug ist für die Frau Bundeskanzlerin reserviert.“
„Ach so, klar, da kann das gemeine Volk natürlich nicht mitfahren“, sagt Schulz. „Ich nehme dann den normalen Aufzug.“
In diesen Sätzen konzentrieren sich die Stärken der Reportage: Der Journalist nimmt sich zurück, beobachtet genau und lässt seinen Helden sprechen, der zum Anti-Helden geworden ist. Der Reporter kommentiert nicht, er lässt die Szene unvermittelt auf den Leser prallen. Die Auswahl ist der Kommentar des Reporters, das, was er aus Tausenden von möglichen Szenen für seinen Artikel nutzt.
Markus Feldenkirchen hätte sicher gerne das letzte Wort gehabt: Fast sechs Monate hat er den Kandidaten Schulz begleitet, war bei Gesprächen dabei, von denen ihn die Berater des Kandidaten gerne ausgeschlossen hätten. Feldenkirchen formuliert den letzten Satz nicht selber, er zeichnet kein sprachliches Bild, das bei Preisverleihungen zitiert würde: Er lässt im Kopf des Lesers einen kleinen Film entstehen, mit Martin Schulz in der Hauptrolle. Dieser Film bleibt im Kopf.
Und wenn Martin Schulz sogar Kanzler geworden wäre – als Wahlsieger?
Der Reporter, der im Hintergrund bleibt, ähnelt einem Schiedsrichter beim Fußballer, der nicht auffällt, der einfach mitläuft und denen, die spielen, die Hauptrolle überlässt. Das gelingt Markus Feldenkirchen über weite Passagen der Reportage, aber immer mal wieder setzt sich Kommentator durch, der dem Leser unbedingt mitteilen will, wie eine Geste, ein Satz, eine Szene zu deuten ist.
Um 15 Uhr trifft Schulz am Flughafen Schönefeld ein. Er steht vor seinem Wagen, schaltet sein Handy an. Es dauert einen Moment, dann sieht er auf dem Display die Frühprognosen der Meinungsforscher. Es ist, nun auch offiziell, das Ende seiner Kanzlerträume.
Das ist eine solide Beschreibung der entscheidenden Szene am Sonntag der Wahl. Der Leser weiß Bescheid, er braucht keinen Kommentar, auch keine Analyse, dass dies das Ende ist. Aber da kann sich der Reporter nicht mehr zurückhalten, es bricht aus ihm heraus, er schreibt, was der Leser denken soll:
Es ist nicht seine Schuld, dass er den europaweiten Trend nicht umkehren konnte, wonach viele der Sozialdemokratie nicht mehr zutrauen, die richtigen Antworten auf das Zeitalter der Digitalisierung zu haben. In den knapp 200 Tagen, die er nun Parteivorsitzender ist, ist das nicht zu leisten, erst recht nicht in den irren Zeiten des Wahlkampfs. Vielleicht wäre ein Kandidat mit weniger Stehvermögen und Leidenschaft in dieser Stimmungslage sogar noch sehr viel tiefer ins Ziel gekommen.
Über diese Fragen können Journalisten lange streiten: Wie viel Deutung darf in eine Reportage fließen, wie viele kommentierende Sätze? Wie stark darf man den Leser führen? Soll man ihm nicht sein Urteil selber finden lassen?
Eine starke Reportage fasziniert durch ihre Erzählung und einen Ton, der nicht belehrend klingt. Das fällt jedem schwer, der ein halbes Jahr einen Politiker begleitet, der am Ende schon so denkt und fühlt wie er: Da löst sich die Distanz auf.
Wenn ständig schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, erhalten die wenigen positiven eine umso größere Bedeutung. Sie wirken wie Antidepressiva gegen die Strapazen und das Gefühl von Vergeblichkeit. Auch wenn Schulz bisweilen in emotionale Löcher sackt, schafft er es immer wieder, sich selbst zu begeistern.
Da beobachtet der Reporter nicht mehr, da spricht schon ein Alter Ego – ebenso wie in diesem Satz:
Er hält eine mitreißende Rede, die Leute feiern ihn. Niemand ahnt, wie es in ihm aussieht.
Der Reporter ahnt es nicht nur.
Es gibt Szenen, in denen der Leser nicht mehr weiß, wer spricht: Schulz oder Feldenkirchen? Als nach der Schleswig-Holstein-Wahl Jörg Schönenborn von der „regionalen Komponente“ spricht, die den Wahlausgang bestimmte:
„Aha“, ruft Schulz. Er hält den Finger in die Luft. „Das ist ’ne interessante Analyse.“ Regionale Komponente bedeutet: SPD-Ministerpräsident Torsten Albig, der auf die falschen Themen gesetzt und ein unfassbar dämliches Interview zu seiner gescheiterten Ehe gegeben hat, ist schuld. Nicht er. Es ist ein klitzekleines Stück Hoffnung an einem trostlosen Tag.
Keinen Konjunktiv nutzt der Autor, diese Eigenart der deutschen Grammatik, eine indirekte Rede markierend: Da denken und fühlen offenbar Schulz und Reporter ähnlich „an einem trostlosen Tag“.
Markus Feldenkirchen schreibt durchgehend im Präsens, er geht chronologisch vor: Das mögen Reporter nicht, ist den meisten zu brav, zu simpel. Doch in der Erzählung eines Wahlkampfs, die ein halbes Jahr umfasst, ist die Chronik der beste, weil einfache Weg: Der Aufstieg und Fall des Helden hat Shakespeare-Format. Das erspart dem Schreiber komplizierte Rückblenden und den wenig schönen Plusquamperfekt.
Er sitzt in seinem Büro. Wieder läuft der Fernseher, wieder eine Niederlage, diesmal die schlimmste, in Nordrhein-Westfalen, Kernland der SPD. „Das Leben ist wie eine Hühnerleiter“, sagt Schulz. „Beschissen.“ Niemand reagiert, Stille im Raum. „Ich bin jetzt königlicher Niederlagenkommentator.“
Feldenkirchen verlässt zwar selten, aber unnötig, den Chronik-Modus und wechselt die Perspektive, interpretiert Episoden mit dem Wissen dessen, der den Ausgang kennt – wie die Leser. Zur Kampagnen-Unterbrechung während der Landtagswahlkämpfe lässt der Reporter Schulz aus dem Off des Nachhinein sprechen:
„Das war falsch“, sagt Schulz im Rückblick. „Wir hätten das weitermachen müssen.“
„Wie man inzwischen weiß“, so wird auch das TV-Duell aus dem Nachhinein beurteilt: So verlässt Markus Feldenkirchen den Strom der Erzählung. Die Reportage ist aber keine Analyse einer verlorenen Wahl, es ist die Geschichte von Aufstieg und Fall, von Wegen, Umwegen und Holzwegen. Der Vorteil von gradlinig erzählten Geschichten ist: Das Erzählen ohne erhobenen Zeigefinger, ohne dies „Ich weiß alles besser“. Im Nachhinein ist jeder klüger: Das ist die Haltung der Leitartikler, der Besserwisser.
Trotz einiger Einwände, die ein guter Redigierer hätte entdecken müssen:
Diese Langzeit-Reportage im „Spiegel“ ist ein journalistischer Glücksfall – mehr noch: Eine Liebeserklärung an die Politik in diesen unruhigen Zeiten, eine Verbeugung vor der Demokratie. Sie holt die Politiker vom Sockel, macht dem letzten AfD-Anhänger klar, dass Politik Menschenwerk ist – und so gesehen und respektiert werden sollte.
Markus Feldenkirchen sollte aus der Reportage ein Buch machen mit all den Geschichten, die es noch zu erzählen gibt.
„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über die Schulz-Story: Eine Geschichte, von der Reporter träumen
Feldenkirchen konnte mit Schulz im Taxi, im Flugzeug und zu Fuß reisen, ihn zu 50 Terminen begleiten; Strategiesitzungen, späte Currywurst-Dinner, ein letzter Kaffee (beziehungsweise Kräutertee, durch Inge Schulz ausgetauscht) am Wahlsonntag auf der Terrasse in Würselen inklusive. Fünf Monate lang war Feldenkirchen immer auf Abruf, Spontaneität ist ja alles im Wahlkampf. Häufig bekam er von Schulz oder einem seiner Leute 15 Minuten vor einem Treffen, einer Besprechung, einem Aufbruch einen Anruf. Am Ende der langen Tage war der Reporter stärker erschöpft als der Kandidat. „Wie soll das später eigentlich heißen, was Sie da schreiben: So wird man Oppositionsführer?“, fragte Schulz im August.
Es gab keine Tabus, nur die Wirklichkeit der Politik im Jahr 2017 und die eine Absprache, dass der Text erst nach der Wahl erscheinen dürfe. Und so ist eine dieser Geschichten entstanden, von denen Reporter und Chefredakteure träumen. Weil sie bleiben werden. Weil sie erzählen, was wirklich geschah.
Anfangs war Martin Schulz übrigens, natürlich, zögerlich gewesen. Der Kollege Feldenkirchen und ich hatten den Kandidaten in Hannover getroffen und ihm von der Idee erzählt; ich hatte einen Text des „New Yorker“-Chefredakteurs David Remnick in der Tasche, den dieser über die letzten Amtstage Barack Obamas geschrieben hatte, eben weil Obama dem Kollegen Remnick die Möglichkeit dazu gegeben hatte.
So etwas funktioniert ja nur mit Zugängen. Und mit Ernsthaftigkeit. Und wenn beide Seiten glauben, dass Politik, dass überhaupt Macht sich nicht abschotten darf. Zugänglich sein muss. Verletzlich sein darf. Dass eben hierin Mut liegt. Schulz‘ Umfeld war gegen das Projekt: viel zu riskant. Das war selbstverständlich nachvollziehbar.
Also vergingen drei Wochen. Dann sagte Schulz: „Wir machen das.“ Und in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit hielte ich es für gut, wenn sehr viel mehr Politiker sehr viel mehr Transparenz und Einblicke zuließen. Damit die Bürger erkennen könnten, dass es sich bei denen da oben um Menschen handelt, mit Stärken und Schwächen, mit Zweifeln und Überzeugungen; und damit die Politiker erkennen könnten, dass es nur der AfD hilft, wenn Imageberater und Pressestellen die Schwächen und die Zweifel verdecken wollen.
(Klaus Brinkbäumer in „Zur Lage“, dem Morgen-Newsletter des „Spiegel“ am 30. September 2017)
Eine vorbildliche Reportagen-Reihe: Die 10 Gebote, in die Gegenwart übertragen
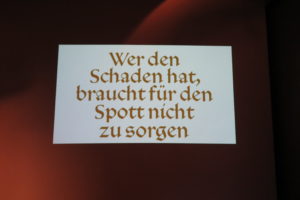
Luthers Beitrag zur Neid-Debatte: Eine Tafel aus der Ausstellung „Luther und die Sprache“ auf der Wartburg 2016
Lasst uns über die Veränderung in der Gesellschaft nachdenken, über den Verlust der Werte! Das gelingt Zeitungen nur sporadisch, sie sind immer noch auf Aktualität ausgerichtet – und je unruhiger die Zeiten, umso mehr konzentrieren sich Zeitungen auf die Aufregung und Erregung des Tages.
Die Braunschweiger Zeitung hat eine nachahmenswerte Idee: Wir produzieren eine Zeitung auch für den Feiertag, an dem die Menschen Zeit und Muße zum Lesen haben, also beispielsweise heute am Reformationstag – nicht über Luther (über ihn gab’s mehr als genug), sondern über Werte, Veränderung und das Beständige, eben über das, was auch immer wieder Luthers Thema war.
Auf 22 Seiten, nahezu frei von Anzeigen, geht es um Werte und Wandel – allerdings nur am Rande mit Analysen, Theorien und Wertungen. Die Reporterin Katrin Schiebold erzählt auf der Hälfte der Seiten von Menschen: Was verändern sie? Wie werden sie verändert? Was macht ihnen Mut? Was lässt sie verzweifeln?
Der rote Faden ist ein uralter Werte-Kanon: Die Zehn Gebote – auf einer Seite geht es um je ein Gebot, wird ein altes Gesetz in die Gegenwart und ihre Geschichten übertragen:
1 – Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Die Reporterin trifft sich mit Christen und Atheisten und lässt sie erzählen: Warum glaubt ein Mensch? Warum widersteht er?
Das 2. Gebot, das wohl schwierigste: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.“
Katrin Schiebold erzählt von Jugendlichen, die den Verlockungen von Islamisten erliegen, und ihren Familien.
3 – Du sollst den Feiertag heiligen.
Ein Pfarrer und ein Ex-Fußballprofi von Eintracht Braunschweig erzählen, warum der Sonntag als Ruhetag wichtig ist. Docj die Gesellschaft ist gespalten: Viele Geschäfte wollen am liebsten jeden Sonntag öffnen.
4 – Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Wie geht es Kindern, die nur noch Mutter oder Vater stets in ihrer Nähe haben oder vom Jugendamt „erzogen“ werden.
5 – Du sollst nicht töten.
Eine Oberstaatsanwältin versucht zu verstehen, warum Menschen töten. Es sind erzählende Sätze wie diese, die den Wert der Reportagen ausmachen, kühl, aber nicht kalt, nicht wertend, denn dies gelingt dem Leser besser im Gespräch mit sich selbst:
Der Angeklagte hält sein Holzkreuz in den Händen, er zeigt keine Reue, kaum eine Regung. Dabei wäre das so wichtig gewesen für seine zehn Kinder, die während des gesamten Prozesses vor dem Braunschweiger Landgericht vergeblich auf eine Erklärung des 54-Jährigen warten. Warum hat er ihre Mutter in der katholischen Kirche in Braunlage getötet? Warum hat er versucht, sie mit Medikamenten zu vergiften, schließlich das Gewehr auf sie gerichtet und geschossen, warum hat er einen seiner Söhne und seine zwölfjährige Tochter dazu gezwungen, das Blut wegzuwischen und die Leiche fortzuschaffen? Warum macht ein Mensch so etwas?
Warum?
Es gibt Taten, die so grausam sind, dass sie selbst routinierte Kriminalisten und Ermittler fassungslos machen. Der Mord an der Küsterin in Braunlage vor fünf Jahren gehört dazu. Kirsten Böök hatte damals als Oberstaatsanwältin die Ermittlungen geleitet. „Der Fall war auch deshalb so ungeheuerlich, weil der Täter eiskalt vorging“, sagt sie. Er habe seine Kinder instrumentalisiert, sie dazu gezwungen, die Spuren seiner Tat zu beseitigen. Außerdem habe er seinen Sohn belastet, um die Schuld von sich zu nehmen.
6 – „Du sollst nicht ehebrechen“.
Eine Wolfsburger Standesbeamtin erzählt von der Trauung – und ein Braunschweiger Familienrichter von Scheidungen.
7- „Du sollst nicht stehlen.“
Vom Datendiebstahl berichtet ein Verfassungsschützer in einem Interview.
8 – „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“
Cybermobbing trifft viele junge Menschen, aber nicht nur sie. Wer Opfer wird, kann sich nur schwer von der Schmach befreien.
Paul und Celina sind ein Paar, doch dann trennt sich der 16-Jährige von seiner Freundin, weil er eine andere kennengelernt hat. Für Celina bricht eine Welt zusammen, sie ist gekränkt, verletzt, eifersüchtig. Abends sitzt sie in ihrem Zimmer, sucht nach einem Ventil, ihrer Wut und Verzweiflung Luft zu machen. Sie nimmt ihr Smartphone, öffnet eine WhatsApp-Gruppe und tippt: ,Paul hat mich vergewaltigt.‘ Der Satz verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Es kommt zu strafrechtlichen Ermittlungen. Am Ende stellt sich heraus: An dem Vorwurf ist nichts dran, Celina hat sich dafür rächen wollen, dass Paul sie verlassen hat. Doch der Vorwurf ist in der Welt.“
9 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.“
Ein Neidforscher erklärt, warum sich Menschen ständig miteinander vergleichen – und wann ein Vergleich zum Neid wird.
10 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat“.
Partnervermittlungen im Internet – und der Seitensprung, der doch die Ausnahme ist.
Eine Reportagen-Reihe – zum Nachahmen empfohlen – nicht nur an Feiertagen. Wer keine komplette Ausgabe damit produzieren kann, dem ist eine Serie über Tage und Wochen zu empfehlen. Sie kommt den Lesern sogar mehr entgegen: Wie viele nehmen sich die Zeit, stundenlang eine Zeitung zu lesen, prall mit exzellenten Geschichten gefüllt?
Christopher Schmidt, der SZ-Sprachgewaltige, ist tot
Christopher Schmidt, Literaturchef der Süddeutschen Zeitung, ist mit gerade mal 52 Jahren gestorben. SZ-Foto: Allessandra Schellnegger
Er pflegte eine manchmal mürrische, immer unbestechliche, auf bedauerliche Weise etwas aus der Mode gekommene Distanz.
Kann man Schöneres über einen Journalisten schreiben? Sonja Zekri ehrt so heute (2. März 2017) Christopher Schmidt, den Literaturchef der Süddeutschen Zeitung; er ist mit gerade mal 52 Jahren gestorben.
Sonja Zekri zeichnet auch das Gegenbild des abgehobenen Feuilletonisten, dem Schmidt eben nicht glich:
Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, aus seiner Nähe zu den Berühmten der Bühne, des Films, der Literatur Kapital zu schlagen, ihren Glanz auf sich abstrahlen zu lassen, ein strahlender Name hier, ein Fernsehauftritt dort, eine Whiskey-Runde nach der Vorstellung.
Schmidt war ein besonderer Journalist, ein besonders guter, mehr als ein Profi. „Viele Journalisten haben ein schwieriges Verhältnis zur Sprache, seines war obsessiv“, schreibt Sonja Zekri im Nachruf:
Seine Texte verrieten eine Sprachgewalt, die reichte, um Romane zu füllen, kein Bild war schief, gebraucht, auch nur vage bekannt. Für die Entlarvung des alltäglichen politischen, medialen oder sonstigen Sprachmülls erfand er eine eigene kleine Feuilleton-Rubrik, den „Phrasenmäher“, wo er das „Pimpen“, den „Spoiler-Alarm“ oder den „Atmenden Deckel“ in ihre Einzelteile zerlegte und wieder zusammensetzte.
Sie erinnert an sein schönstes Essay, das der schreibende Heimwerker der Schraube widmete: „Ein Lob an die Schraube – Kopf hoch!“, erschienen vor sieben Jahren. Schmidt beschreibt einen Schrauben-Laden in München:
Hier wird man gemaßregelt. Hier bemüht man sich nicht um den Kunden, hier beugen sich Gleichgesinnte über das obskure Objekt ihrer Begierde. Und Laien werden nur geduldet. Jeder Besuch im Schraubengeschäft: eine Lektion in Demut.
Das Ende des Essays taugt, wie der gesamte Text, zur Ausbildung von Redakteuren: Wie man über einem scheinbar unbedeutenden Gegenstand einen bedeutenden Artikel schreibt:
Es gehört zur spröden Poesie der Schraube, dass sie eines der wenigen Dinge ist, die unendlich sind in einer von Endlichkeiten beherrschten Welt, dass man bei ihr weiß, „um was es sich dreht“, und dass es Ozeane von Erfinderschweiß kostete, um härtesten Stahl so filigran zu formen, dass er an der Spitze ins Nichts übergeht.
Übersprungen sei hier das delikate Verhältnis zwischen der männlichen Schraube und ihrem weiblichen Gegenstück: der Mutter – wie die meisten Mutter-Sohn-Bindungen eine der wenigen perfekten Beziehungen. Aber auch, nachdem die Schraube zu ihrer heutigen Gestalt herangereift war, konnte man ihr noch zweihundert Jahre lang aus dem Weg gehen. Erst als das schwedische Möbelhaus „Ikea“ mit seinen Bausätzen das Wohnen revolutionierte, musste sich fast jeder irgendwann mit der Schraube auseinandersetzen. Denn sie öffnete den Weg in die Emanzipation.
Die instabilen Spezialschrauben von Ikea sind allerdings der Sündenfall in der Geschichte der Schraubverbindungen, und deshalb wurde Ikea zur Strafe an den Stadtrand verbannt.
Wieviel Spielerei verträgt eine Überschrift?
Wanne heikel
Überschriften sollen den Leser informieren und so klar machen, ob die Lektüre des Artikels für ihn lohnt. Überschriften sollen auch locken – mit raffinierter Sprache und kleinen Spielereien. Aber die Reihenfolge muss stimmen: Erst die Information, dann die feuilletonistischen Reize.
Wer weiß, wie Leser lesen – zuerst das Bild, dann die Überschrift -, wer also die Anziehung eines Bildes kennt, kann die Kraft des Bildes auch nutzen und in der Überschrift spielen – wie die Süddeutsche Zeitung heute auf der Panorama-, der vermischten Seite:
„Wanne heikel“ spielt auf die teure Badewanne des ehemaligen Limburger Bischofs Tebartz-von-Elst an und nimmt kalauernd den Städtenamen Wanne-Eickel auf. Gab es zuvor mal die Überschrift: Wanne eitel?
Christian Lindner, Chefredakteur der Koblenzer Rhein-Zeitung, hat sogar eine „Hall of Fame der „#rzHeadlines“ auf Twitter eingerichtet, aktuell ist er bei Folge 1273:
„Lochte geht baden“ = Zeile auf Sport zur Abkehr der Sponsoren von US-Schwimmer Ryan Lochte.
Weitere Koblenzer Hall-of-Fame-Kandidaten aus jüngerer Zeit:
- „Deutsche finden Anglizismen eher uncool“ | Zeile auf Panorama zu Sprach-Umfrage
- „Wir wollen doch nur spielen“ | Zeile auf Wirtschaft zur Gamescom
- „Früher waren mehr BHs“ | Zeile auf Kultur extra über den Wandel bei NatureOne
- „Deutsch, deutscher, Dackel“ | Zeile auf Panorama zur Dackelschau des Deutschen Teckelclubs
- „Wo man den Wald vor lauter Bäumen sieht “ | Zeile im Reiseteil zu Überblick über Baumwipfelpfade
- „Erdogan im Ausnahmezustand“ | Zeile auf Tagesthema
- „Lochte geht baden“ | Zeile auf Sport zur Abkehr der Sponsoren von US-Schwimmer Ryan Lochte
- Und ein Blick nach nebenan: Goldverdächtige Schlagzeile der Bild zur pro-russischen IOC-Entscheidung im Sinne Thomas Bachs: „So geht Olympia den Bach runter“.
Auf der Panorama-Seite zitiert die SZ heute (30. August 16) die Überschrift einer nicht genannten Lokalzeitung, die über den Bericht zu einer 68-köpfigen Gänse-Schar schrieb, die alle vom Blitz getroffen stürzten:
Das Schlaraffenland liegt in Niedersachsen – Gänse fielen gegrillt vom Himmel
„Die Welt geht doch nicht unter“: Ein Lob dem letzten Satz (Die Reportage)
Der erste Satz! Wie viele Dichter und Journalisten haben Angst vor ihm, denken stunden-, gar tagelang über ihn nach, bekommen Schreibblockaden, schrumpfen innerlich zusammen, wenn der Chef sagt: Wenn sie den ersten Satz vermasseln, liest keiner mehr den Rest. Reißen Sie sich zusammen!
Aber kaum einer bekommt eine Schreibblockade, wenn er an den letzten Satz denkt, den Rausschmeißer. Zwar steht in den Reportage-Ratgebern: Er ist wichtig, bleibt im Kopf, regt zum Weiterdenken an! Aber bei den meisten Reportern ist die Luft am Ende raus, alle Sprachbilder aufgebraucht, die wirklichen Bilder erst recht. Man stiehlt sich irgendwie aus der Reportage raus, feuilletonisiert ein wenig, öffnet das Fenster einen Spalt für den Weltgeist – Ende.
Holger Gertz‘ Reportage über Frankreich bei der Europameisterschaft beweist das Gegenteil: Ein müder Einstieg, ein umwerfender Schluss, dazwischen eine starke, weil nachdenkliche Reportage, die von Terror und Fußball, dem Lebensgefühl der Franzosen und Schweinsteigers Hand im Strafraum erzählt. Allein die Zwischentitel reizen zum Lesen, einer verführerischer als der andere – und stärker als „Am Ende der Tage“, einer langweiligen Überschrift aus dem Text-Baukasten:
-
Wie viel innere Stärke muss eine Stadt haben, die nach allem, was war, wieder so offen sein kann
-
Der Fußball erdrückt sich mit seinem immer pralleren Programm gerade selbst
-
Und in der Welt passiert so viel, dass manche gar nicht wissen, warum jetzt Schweigeminute ist
-
Deutsche Effizienz? Wir packen uns die Bälle im Strafraum neuerdings mit der Hand
Und dann der letzte Absatz, der sogar mit Assoziationen an Sieg-Heil spielen kann, ohne peinlich zu wirken; der an die Isländer und ihren derb-neckischen Schlachtruf erinnert und im letzten Satz mit dem Terror und unserer Angst ironisch ins Gericht geht:
Die deutschen Fußballfans haben die furchtbarsten Lieder und Rufe, aber vor einer Bar in einer warmen Nacht in Bordeaux brüllen sie nicht „Sieg!“, sie rufen „Hu!“ Ein Fortschritt. Und ein Hinweis darauf, dass die Welt doch noch nicht untergeht.
Eine Chronik als Vorbild-Reportage: Das Elfmeterschießen als Drama in 18 Akten
Die Chronik passt weder zur Nachricht noch zur Reportage: Im ersten Satz fährt das Auto auf der Kreisstraße, im letzten Satz ist der Fahrer tot.
Eine Ausnahme ist nicht nur zulässig, sondern auch notwendig: Wenn die Spannung der Reportage im Ablauf liegt – wie beim Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien.
Die 280-Zeilen-Reportage von Michael Horeni in der FAZ ist eine vorbildliche Reportage: „Die Nacht des schwarzen Riesen. Ein Drama in 18 Akten“. Der Reporter folgt dem Ablauf des Dramas: Jeder Schuss ein Akt.
Viele haben das Elfmeterschießen gesehen – und sind trotzdem mitgerissen von Horenis Schilderung. Der Reporter schaut auf die Akteure: Wie gehen sie zum Punkt? Wie legen sie den Ball hin? Wie kehren sie zurück? Was sieht er in den Gesichtern der Torhüter, dem schwarzen Riesen und dem Mann in Rot? Der Reporter kennt die Geschichte der Spieler, er erzählt kleine Geschichten: Wie war es 1976, als Hoeneß den Ball in den Belgrader Himmel schoß? Wie beim deutschen Pokalfinale?
Ein Beispiel aus der Reportage:
Buffon tänzelt wieder wie ein Boxer, die Arme hängend wie Ali, der auf den Schlag des Gegners wartet. Müller will Buffon verladen, schießt nach rechts, nicht hart, nicht platziert. Das rote Trikot ist da, wo der Ball hinkommt. Müller irrt im Strafraum herum, einsam, mit gesenktem Kopf. Es ist nicht sein Turnier. Immer noch 1:1.
Das Elfmeterschießen läuft noch einmal wie ein Film vor dem Leser ab – mit neuen Szenen und mit Tiefenschärfe: Wir sehen etwas, was wir live nicht gesehen haben. Wir sehen mehr.
Der Reporter vertraut den Verben, fast drei Dutzend verschiedene allein in den ersten vier Akten. Es sind meist dynamische Verben: toben, schießen, anlaufen, hüpfen, (Hände) schlagen, fliegen, lahmlegen, wegdrehen, springen, hochjagen, tänzeln, herumirren. Die Substantive, meist Namen und Fußballjargon, sind die Pflicht, die Verben sind die Kür; Adjektive kommen kaum vor.
Besser kann Journalismus nicht sein: Wir sehen ein Spiel, das wir selber gesehen haben, mit anderen Augen – und wir staunen, und wir verstehen, was wirklich geschah.
Grimme-Preis-Jury findet Synonym für Gutmenschen: Gefühlsduselige Sozialromantiker
Für „Marhaba – Ankommen in Deutschland“ bekommt der Moderator Constantin Schreiber vom Privatsender n-tv heute einen der Grimme-Preise. Schreiber erklärt in seiner Sendung jede Woche Flüchtlingen aus Arabien in ihrer Sprache fünf Minuten lang, wie die Deutschen und ihr Land ticken: Essgewohnheiten, Freizeit, Weihnachtslieder, Grundgesetz, Religionsfreiheit die Rolle der Frau und anderes mehr.
In der Begründung schreibt die Jury:
Ohne moralischen Überlegenheitssound, aber auch ohne gefühlsduselige Sozialromantik erklärt Constantin Schreiber in klarem Arabisch unsere Werte, Gesetze und Regeln des Miteinanders.
Wer Pathos und Sptach-Klischees von Jury-Begründungen kennt oder sie selber schon mal benutzt hat, dem sei die komplette Begründung der Jury empfohlen –die sich in eine ntv-Programm-Sitzung hineingedacht hat:
Jetzt stellen wir uns einmal kurz eine Sitzung bei einem deutschen Privatsender vor. Geschäftsführer und Vermarkter lassen sich vom Programm-Macher berieseln. „Hey, wir machen ein Dutzend Fünf-Minuten-Beiträge und erklären Flüchtlingen auf Arabisch unser Land. Themen sind Sex, Religion und Gleichberechtigung. Wir machen das erst lässig im Netz und später old school im Fernsehen, ach ja, und der Titel ist arabisch…“
Ein Blick des Geschäftsführers zum Werbezeitenchef. Dessen Kopf schlägt bedächtig auf die Tischplatte. Zwei Sekunden betretenes Schweigen. Dann hat sich der Geschäftsführer gefasst: „Eine dufte Idee fürs Erste oder ZDF. Haben wir nicht noch eine schöne Weltkriegsdoku? Oder was mit schweren Baumaschinen?“
Beim kleinen Sender n-tv muss es anders gelaufen sein. Der Nachrichtenanbieter hat einem jungen Team um Constantin Schreiber das Budget, die Website und später Programm-Slots für „Marhaba TV“ zur Verfügung gestellt. Schnell und pragmatisch haben die Redakteure klassisches Aufklärungsfernsehen umgesetzt.
Journalist Schreiber hat viele Jahre im arabischen Raum gelebt – ein großer Vorteil für die Umsetzung und Glaubwürdigkeit des Formats. Für die Migranten, die im vergangenen Jahr nach Deutschland kamen, war „Marhaba TV“ eine perfekte Hilfestellung – und das auch noch auf kurzweilige Art und Weise. Das Spektrum der Themen reicht von Parteiprogrammen bis hin zum putzigen Übersetzen deutscher Weihnachtsgedichte ins Arabische.
„Marhaba TV“ hat aber immer auch zu aktuellen Fragen Stellung bezogen. Die sogenannten „Ereignisse von Köln“ wurden thematisiert, ebenso der deutsche Karneval – immer schön auch auf Deutsch untertitelt. Denn auch der eine oder andere Biodeutsche könnte Neues über Demokratie und Toleranz erfahren. Klar, die üblichen Pöbeleien von besorgten Bürgern im Netz ließen nicht auf sich warten. Aber das ließ die Kölner kalt. Sie sendeten weiter und legten sogar mit einer deutsch-arabischen Talkshow nach.
Der Erfolg gab ihnen Recht. Hundertausende klickten das Angebot im Netz an. Ohne moralischen Überlegenheitssound, aber auch ohne gefühlsduselige Sozialromantik erklärt Constantin Schreiber in klarem Arabisch unsere Werte, Gesetze und Regeln des Miteinanders, während andere „wurzeldeutsche“ Moderatoren gerne schon einmal an ihrer Muttersprache scheitern.
Schreiber interviewt junge MigrantInnen, lässt ihre Sicht auf unsere Gesellschaft zu Wort kommen. Zudem stellt „Marhaba TV“ eine kluge Verbindung der Verbreitungswege dar, denn mobile Dienste sind die ersten Informationsquellen der Migranten. Fernsehen soll zudem bilden – das ist eine der Grundideen des Grimme-Instituts. Constantin Schreiber und n-tv haben es verstanden, diese Maxime modern und ohne großes Medien-Tamtam umzusetzen. Sie sind damit auch Vorbild für andere Privatsender, aber sicher nicht nur für diese.
Spotlight – ein exzellenter Film über Journalismus, Recherche, Professionalität und Unabhängigkeit
Spotlight ist ein Film über Journalisten und für Journalisten – der gerade den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Erzählt wird die wahre Geschichte des Reporter-Teams „Spotlight“. Es recherchierte für den Boston Globe, dass Hunderte von katholischen Priestern Kinder missbraucht hatten mit Wissen des Kardinals.
Wer mit Begeisterung Journalist ist, sollte sich diesen Film ansehen aus vier Gründen:
- Spotlight zeigt, dass Recherche die Basis des Journalismus und der Demokratie ist: Nur so gelangen Nachrichten in die Öffentlichkeit, die von den Mächtigen unterdrückt werden. Die Demokratie lebt nicht nur von Pressemitteilungen aus den Zentralen, sondern von den Recherchen aus den Hinterzimmern der Macht. Für die Bürger sind diese Nachrichten oft wichtiger als die Verlautbarungen der Mächtigen.
Pressefreiheit, die unsere Verfassung garantiert, ist vor allem die Freiheit der Recherche – und daraus abgeleitet auch die Pflicht zur Recherche. - Spotlight zeigt, wie eine gute Recherche abläuft:
Erstens brauchen die Reporter Hartnäckigkeit, denn jede schwierige Recherche verrennt sich immer wieder in Sackgassen und scheint zu scheitern.
Zweitens braucht die Recherche ein Team, das aus unterschiedlichen Charakteren zusammengesetzt ist, das zusammen arbeitet, das sich gegenseitig hilft und beim Streit um die richtige Strategie nie das Ziel aus den Augen verliert. Der investigative Einzelgänger ist selten, er lebt vor allem in den Kriminalromanen von Dashiell Hammett und Raymond Chandler. Recherchierende Reporter sind weder abgebrüht noch ausgekocht, sie brechen auch keine Regeln, sondern gehen – wenn ihnen Dokumente vorenthalten werden – auch mal vor Gericht und klagen die Herausgabe ein.
Drittens ist Recherche erst einmal Lesen in Akten, Lesen in Archivbänden, Lesen in Mails und Briefen von Lesern, auch von denen, die man als Querulanten abgestempelt hatte, Lesen in den eigenen Artikeln, die schon erschienen sind. Die Recherche in Spotlight kommt vom Fleck, als in der Bibliothek die Jahresbände des katholischen Bistums entdeckt werden mit Angaben sämtlicher Priester und der Gemeinden, in denen sie wirkten.
Dann folgt das Kombinieren, die Entdeckung der inneren Logik der Geschichte: Wo ist der rote Faden? Was hängt miteinander zusammen? Mit wem müssen wir sprechen? Wo sind die besten Informanten?
Schließlich braucht man die Gespräche mit Opfern, Anwälten und Tätern, und man braucht Geduld, nach der siebten zugeschlagenen Tür weiterzumachen, und man braucht die Gabe, trotz aller Distanz den Informanten Sicherheit und Vertrauen zu garantieren. Mindestens eine Frau braucht jedes Recherche-Team.
Auf eine Tiefgarage zu hoffen, in der hinter einem Pfeiler ein Informant wartet mit einem dicken Umschlag – das ist weltfremd. - Spotlight beleuchtet den Lokaljournalismus mit seinem Mix aus Nähe und Distanz: Den Anstoß zur Recherche gibt der neue Herausgeber Marty Baron – einem Chefredakteur bei uns vergleichbar -, gerade aus Florida nach Boston gekommen: Er liest in einer Kolumne vom Missbrauch und fragt in seiner ersten Ressortleiter-Konferenz, ob weiter recherchiert werde. Ein nassforscher Redakteur spöttelt: Das ist eine Kolumne, da wird nicht mehr recherchiert.
Es wird recherchiert – auch gegen den Unwillen von Spotlight-Chef Walter Robinson, der Hinweise unterdrückt hatte, um seiner Heimatstadt und der Kirche nicht zu schaden.
In einer Schlüsselszene des Films treffen sich Spotlight-Chef Robinson und ein Freund, der den Kardinal berät: „Das ist doch unsere Stadt. Hier leben Menschen, die die Kirche brauchen und deren Vertrauen zerstört wird. Und diese Priester sind doch nur Einzelfälle, wenige faule Äpfel.“
Dieses Gemeinschafts-Gefühl „Wir Kinder dieser Stadt müssen doch zusammenhalten“ schließt den Fremden aus: „Der neue Herausgeber kommt aus New York und Florida, für ihn ist Boston nur eine Zwischenstation in seiner Karriere. Bald geht er wieder.“
Argumentiert wird mit dem Wohl der Stadt: Doch die Mächtigen verwechseln – nicht nur in Boston – bisweilen ihr eigenes Wohl mit dem Wohl der Stadt. Das Wohl der Stadt ist das Wohl der Bürger, die alles Wichtige wissen müssen.
Eine gute Lokalredaktion braucht beide: Den Fremden mit seiner Distanz; er ist nicht Teil eines Netzes von Freunden, die man schon aus dem Kindergarten kennt. Und sie braucht den Einheimischen, der die Stadt und ihre Menschen kennt, der Kontakte hat und sie zu nutzen weiß (oder auch nicht). Beide zusammen sind unschlagbar.
- Spotlight beweist, wie wichtig Unabhängigkeit für eine Zeitung ist. Der Verleger möchte am liebsten Ruhe haben und setzt seine Ruhe gleich mit Ruhe in der Stadt. Die Reporter möchten auch Ruhe haben. Ein Unruhiger, der übrigens in sich ruht, ein Unruhiger wie der Chefredakteur an der Spitze reicht, um die Profis in der Redaktion an ihre Pflicht zu erinnern: Nutzt Eure Unabhängigkeit! Erfüllt Euren Auftrag, der lautet: Seid Sprachrohr der Bürger, nicht Sprachrohr der Mächtigen!
Am Ende gibt die Zeitung den Opfern eine Stimme und rüttelt die wach, die der Kirche vertrauten, obwohl ihre Funktionäre das Vertrauen missbraucht hatten.
Als der neue Chefredakteur zum Antrittsbesuch beim Kardinal erscheint, lächelt der Mann Gottes: „Eine Stadt erblüht, wenn ihre großen Institutionen zusammenarbeiten.“ Marty Baron, der Chefredakteur, lächelt nicht zurück und antwortet trocken: „Eine Zeitung funktioniert am besten, wenn sie alleine arbeitet.“
Der Film zeigt den Wert der tiefen Recherche, und er zeigt ein Defizit des deutschen Journalismus: Nur in den Magazinen wie dem Spiegel und in den nationalen Zeitungen, vorbildlich in der Süddeutschen, wird systematisch recherchiert, in den Regional- und Lokalzeitungen selten oder gar nicht. Wir brauchen solche Recherche-Teams wie „Spotlight“: Vier Redakteure, drei Männer und eine Frau, sind es in Boston.
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist schwierig: Wer an eine langen und schwierigen Recherche arbeitet, fällt für die Tagesproduktion aus. Ist er erfolgreich, stärkt er das Vertrauen der Leser – und das ist mittlerweile unbezahlbar.
Der Boston Globe druckte nach der ersten Reportage, die den Skandal enthüllte, noch sechshundert weitere. Da stimmte sogar die Kosten-Nutzen-Rechnung.
Auch in Deutschland gab es viele Missbrauchs-Fälle. Erst acht Jahre nach dem Skandal in Boston deckten auch deutsche Reporter systematisch auf, beginnend mit einer Recherche der Berliner Morgenpost im Canisius-Kolleg – die eine professionelle Qualität hatte wie die des Boston Globe.
„Hausbesuch“ bei Wut-Lesern: Ein SZ-Reporter reist nach Dresden und München
Wer mit Lesern spricht, die Wut-Briefe schreiben und Pegida loben, der ist überrascht, wie wenige dem Klischee des Neonazis entsprechen. Aber sie mögen die Medien nicht, weil sie mit den Mächtigen unter einer Decke mauscheln, weil sie nicht die Wahrheit schreiben, sagen sie.
Mich erstaunt immer wieder, wie viele von denen, die wütende Briefe schreiben, die Zeitung lesen – trotzdem. Wir sollten mit ihnen sprechen. Dirk Lübke, der Chefredakteur des Mannheimer Morgen, hat nach dem Petry-Schießbefehl-Interview viele Wut-Briefe bekommen: Sie sind nicht objektiv! Er schreibt sie alle an und lädt sie ein zum Gespräch. Kommt jemand? Oder einige? viele?
Wahrscheinlich kommt keiner: Die Redaktion ist fremdes, vielleicht sogar feindliches Terrain. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, zu den Leser zu gehen – Hausbesuche.
So hat es die Süddeutsche Zeitung getan, einige von den Wütenden besucht, in München und Dresden. Sie haben den Redakteur eingeladen: Bernd Kastner, der Reporter, reiste an, in Dresden kamen vier Freunde hinzu, es gab Sächsische Eierschecke.
Ein Finanzdienstler hatte aus seiner Firma gemailt:
Ihr Knallchargen von der vierten Gewalt, die Ihr noch nie den Koran gelesen habt! Ich persönlich würde sogar bewaffnete Gewalt gegen den Münchner Moscheeneubau begrüßen.
Er hat tatsächlich „Ihr“ groß geschrieben, aber bei Anruf legte er auf.
„Pegida ist eine Gedankenwelt“, schreibt Kastner. Aber zuerst ist sie eine wirkliche Welt. In München freut sich eine 79-jährige: Jederzeit – nur am Montag und Donnerstag gehe es nicht „Da gebe ich Migranten Deutschunterricht.“
In Dresden stehen Tucholsky und Kisch im Bücherregal, auf dem Boden liegt ein Stapel der Sächsischen Zeitung. Ihren Namen wollen die Dresdner nicht lesen, sie bekommen ein Pseudonym. „Man wisse ja nie bei der Presse.“ Der 44jährige ist promovierter Diplom-Ingenieur, ein anderer Besitzer einer Autowerkstatt im Erzgebirge.
Man debattiert, der Reporter stellt klar, was an den Gerüchten nicht stimmt. Fast alles stimmt nicht:
- Die vier Frauen eines Muslims bekommen alle eine Rente, wenn er gestorben ist? Ja, aber jede nur ein Viertel.
- Der Staat zahlt den Flüchtlingen die Handy-Gebühr? Jeder bekommt ein Taschengeld, so wie es das Gesetz bestimmt, und damit kann er machen, was er will.
- In München kann man abends nicht mehr mit der U-Bahn fahren? München ist die sicherste Großstadt, obwohl hier mehr Migranten leben als in Berlin.
Dem Reporter fällt Karl Valentin ein: „Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische.“
Jutta Wölk in München will kein Pseudonym, sie lässt sich fotografieren und erzählt, dass sie jeden Tag stundenlang liest, die Welt, die Jüdische Allgemeine, die Süddeutsche.Der Reporter notiert:
„Die SZ sei auch Teil des Schweigekartells, das Anweisungen der Politik befolge. Wie, Frau Wölk, stellen Sie sich das vor? „Da ruft der Seehofer an, die Frau Merkel, und sagt: Das wird nicht gedruckt. So einfach.“ So einfach? „Ich bin überzeugt, dass es so läuft.“ Tatsächlich? „Wie soll ich Ihnen das erklären? Natürlich rufen die nicht selbst an, sie lassen anrufen.“ Woher wissen Sie das? „Natürlich habe ich keinen Beleg dafür.“ Warum dann dieser Vorwurf? „Mir gefällt einfach die Haltung der SZ zur Flüchtlingspolitik nicht.“
Frau Wölks Lippen beginnen zu zittern. „Parallelgesellschaft“, ruft sie, „warum kann man das nicht einfach schreiben?“ Warum sind auf den Fotos in den Medien so oft Flüchtlingsfamilien, so oft Kinder? Es seien doch viel mehr alleinstehende Männer gekommen. Jetzt beben die Lippen.
Frau Wölk hat Angst, sie sagt, fremdenfeindlich sei sie nicht, nur skeptisch; sie beklagt, dass die Medien pauschalieren, pauschaliert selber und sagt: „Gefühle lassen sich nicht so einfach beseitigen.“ Und als der Reporter sie beim Herausgehen fragt, ob sie die Süddeutsche abonniert habe, wundert sich Frau Wölk: „Selbstverständlich.“
Wie wohl die Leser in Dresden und in München die Seite-Drei-Reportage des Reporters beurteilen? Objektiv? Herablassend? Belehrend? Wir könnten von ihnen lernen, wenn wir es wüssten.
**
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 10. Februar, Seite 3, „Hausbesuch“
Vorbildlich: Ein Chefredakteur entschuldigt sich wegen „rassistischer“ Grafik
Die Republik scheint nach den Silvester-Übergriffen in Köln im Ausnahmezustand zu sein, was die Medien und die Politik betrifft. Da reicht ein falsches Bild, ein falscher Satz, und der Sturm bricht los in den Netzwerken, die schnell nicht mehr sozial sind. Da hilft nur eines: Schnell reagieren, auch am Wochenende, so wie es Wolfgang Krach tat, einer der beiden SZ-Chefredakteure. Er entschuldigte sich für zwei Illustrationen, die Leser zum Teil vehement als „rassistisch“ kritisiert hatten. Krach nutzte dafür den Facebook-Auftritt der Süddeutschen Zeitung. Er war schnell und verhinderte so einen langen Shitstorm.
Gut , dass Sie sich entschuldigen. Besser ist noch, wenn Sie wirklich verstehen, warum diese Grafik sowohl rassistische als auch sexistische Stereotype bedient und ab jetzt doppelte Vorsicht walten lassen. Sie sind ein Qualitätsmedium. Ihre Stellungnahme bestätigt das. Viele Kommentare hier lassen mich allerdings an der Qualität ihrer Leser_innen zweifeln.
Die Reaktion von Krach ist vorbildlich; hier im Wortlaut:
Am Wochenende haben wir sowohl in der gedruckten Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ als auch auf SZ.de ausführlich über die Ereignisse der Silvesternacht von Köln und die sexuelle Gewalt berichtet, die dort vielen Frauen angetan worden ist. Wir haben dabei unter anderem zwei Illustrationen verwendet.
Die eine zeigt eine Faust im Kopf, die andere symbolisiert einen sexuellen Übergriff auf eine weiße Frau durch eine schwarze Hand (http://on.fb.me/1SbvU9n). Diese zweite Illustration hat bei etlichen unserer Leserinnen und Leser Unverständnis und Wut hervorgerufen; sie kritisieren sie als sexistisch und rassistisch.
Unsere Absicht war, mit den beiden Illustrationen deutlich zu machen, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen nicht nur aus physischen Übergriffen besteht, sondern meist im Kopf und im Denken beginnt. In den begleitenden Texten haben wir so differenziert wie möglich über die Ereignisse von Köln, die Angriffe auf die Frauen, die Motive und die Hintergründe der Taten, das Versagen der Polizei und auch über die Instrumentalisierung der Taten durch rechte Demagogen berichtet.
Die zweite Illustration läuft dieser differenzierenden Absicht jedoch entgegen. Sie bedient stereotype Bilder vom „schwarzen Mann“, der einen „weißen Frauenkörper“ bedrängt und kann so verstanden werden, als würden Frauen zum Körper verdinglicht und als habe sexuelle Gewalt mit Hautfarbe zu tun. Beides wollten wir nicht. Wir bedauern, wenn wir durch die Illustration die Gefühle von Leserinnen und Lesern verletzt haben und entschuldigen uns dafür.
Wolfgang Krach, Chefredakteur
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?












 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von