Robert Domes: Ich vergleiche journalistische Kreativität mit der Goldsuche

Robert Domes war Lokalchef im Allgäu und ist Autor des Bestsellers „Nebel im August“, der verfilmt wurde. Foto: Simone Schatz
In einem Interview für die Journalismus-Kolumne von Kress spricht der Journalist Robert Domes über Lokaljournalisten, Recherche und Wahrheit, über arrogante Redakteure, die Demokratie, über Claas Relotius und über seinen mehrfach preisgekrönten Film „Nebel im August“.
Dies sind die stärksten Zitate:
Echte Kreativität ist fast immer eine Antwort auf eine möglichst exakte Frage. Ich vergleiche das mit der Goldsuche: Ich grabe mich durch das Sediment und wasche den Sand, bis ich die Goldkörner finde. Das erfordert ein offenes Auge, vor allem aber Fleiß und Geduld.
Ein gutes Beispiel ist die Sendung mit der Maus. Sie bedient sich eines Konzepts, das auch Journalisten nutzen sollten. Man versetze sich in die Sichtweise eines Kindes, das die banalsten Dinge hinterfragt und das immer wieder die „Königsfrage“ stellt: Warum? Schnell erkennen wir auf diese Weise, wie schwierig viele Sachverhalte tatsächlich zu erklären sind. Nicht nur Kinder stellen solche Fragen, auch viele Leser. Dazu dürfen Journalisten nichts für selbstverständlich nehmen.
Das ist die größte Herausforderung im Redaktionsalltag: Muße finden, sich Freiraum schaffen für unkonventionelle Ideen. Das ist auch Aufgabe der Redaktionsleitung, ihrer Mannschaft die Möglichkeit zum Spielen zu geben.
Ich bin ein Verfechter der guten alten Grundsätze: berichten, nicht richten; verdichten, nicht erdichten; beschreiben, nicht vorschreiben.
Der finanzielle und zeitliche Druck (in Lokalredaktionen) hat eher zugenommen. Viele aufwändige Recherchen gelingen nur, weil Kollegen ihre Freizeit dafür opfern und/oder weil die Redaktion Mehrarbeit übernimmt. Allerdings hat inzwischen eine Reihe von regionalen Medienhäusern eigene Reportage-Ressorts eingeführt. Dass sich diese Investition lohnt, zeigen die zahlreichen ausgezeichneten Geschichten.
Ich erlebe Kollegen, die mit Sachverstand glänzen, und andere durch Ignoranz, anbiedernde und arrogante, kluge und dumme, gut und schlecht vorbereitete. Aber das finden wir ja überall in unserer Gesellschaft. Warum sollten Journalisten bessere Menschen sein?
Das Argument „Ich will Vorbild sein und die Demokratie voranbringen“ habe ich noch nie in den Profilanforderungen einer Stellenausschreibung gelesen. Wenn wir solche vorbildliche Journalisten wollen, müssen wir sie entsprechend ausbilden. Dann gehört das Fach „Demokratisches Bewusstsein“ in jeden Voloplan und jeden Studiengang.
Vielleicht ist Claas Relotius ein Beispiel dafür, wie eng Genie und Wahnsinn beieinander liegen. Relotius sagt von sich selbst, er sei krank. Aber: Ebenso krank ist das journalistische System, das einen solchen Betrug gefördert und möglich gemacht hat. Es sind Redaktionen, in denen nicht zuvorderst über Fakten diskutiert wird, sondern über die „Deutungshoheit“. In denen eine Kultur der journalistischen Arroganz gepflegt wird. Das ist eine Einladung zum Hochstapeln.

Der Film „Nebel im August“ ist nach dem Roman von Robert Domes entstanden. Die Hauptrollen spielen Sebastian Koch als „Euthanasie“-Arzt Veithausen und der junge Ivo Pietzcker als Ernst, der das mörderische Treiben in der „Euthanasie“-Klinik durchschaut und selber zum Opfer wird. Foto: Anjeza Cikopano, ZDF
Schulz-Story im Spiegel verkaufte sich überdurchschnittlich gut – Die Blattkritik

Heft 40/2017 – Eines der meistverkauften Spiegel-Hefte in 2017 – dank der Story über den gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz.
Rund 800.000 Hefte hat der Spiegel verkauft mit „Schulz Story – 150 Tage an der Seite des Kanzlerkandidaten – eine große Erzählung über Politik im Jahr 2017“. Am Kiosk verkaufte das Heft 40/2017 weit mehr als der Durchschnitt in diesem Jahr. Auch bei Blendle war die Schulz-Story der am besten verkaufte Artikel im Oktober. Exzellenter Journalismus ist also auch ökonomisch wertvoll.
In meiner JOURNALISMUS!-Kolumne bei kress.de habe ich in einer Blattkritik analysiert, warum die Reportage so fasziniert – und warum sie wichtig ist für Bürger, Demokratie und Journalismus.
Spiegel-Reporter Markus Feldenkirchen begleitete den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz fast ein halbes Jahr und war überall dabei – auch bei Gesprächen, von denen sonst Journalisten ausgeschlossen sind. Die Reportage ist mit rund 13.000 Wörtern umfangreich wie ein kleines Buch; die Hörfassung mit gut anderthalb Stunden Dauer würde nicht einmal auf eine CD passen. Hier die Kolumne, leicht überarbeitet:
Wahlabend. Merkel und Schulz verlassen die TV-Elefantenrunde. Mit der eindrucksvollsten Passage der Geschichte endet die Langzeit-Reportage von Markus Feldenkirchen über den Kandidaten Martin Schulz:
Nach der Sendung gibt er der Frau, die er eigentlich ablösen wollte, kurz die Hand und verschwindet ohne ein weiteres Wort. Er läuft auf den nächstbesten Aufzug zu, aber er darf nicht einsteigen, eine Frau verweigert ihm den Zutritt: „Dieser Aufzug ist für die Frau Bundeskanzlerin reserviert.“
„Ach so, klar, da kann das gemeine Volk natürlich nicht mitfahren“, sagt Schulz. „Ich nehme dann den normalen Aufzug.“
In diesen Sätzen konzentrieren sich die Stärken der Reportage: Der Journalist nimmt sich zurück, beobachtet genau und lässt seinen Helden sprechen, der zum Anti-Helden geworden ist. Der Reporter kommentiert nicht, er lässt die Szene unvermittelt auf den Leser prallen. Die Auswahl ist der Kommentar des Reporters, das, was er aus Tausenden von möglichen Szenen für seinen Artikel nutzt.
Markus Feldenkirchen hätte sicher gerne das letzte Wort gehabt: Fast sechs Monate hat er den Kandidaten Schulz begleitet, war bei Gesprächen dabei, von denen ihn die Berater des Kandidaten gerne ausgeschlossen hätten. Feldenkirchen formuliert den letzten Satz nicht selber, er zeichnet kein sprachliches Bild, das bei Preisverleihungen zitiert würde: Er lässt im Kopf des Lesers einen kleinen Film entstehen, mit Martin Schulz in der Hauptrolle. Dieser Film bleibt im Kopf.
Und wenn Martin Schulz sogar Kanzler geworden wäre – als Wahlsieger?
Der Reporter, der im Hintergrund bleibt, ähnelt einem Schiedsrichter beim Fußballer, der nicht auffällt, der einfach mitläuft und denen, die spielen, die Hauptrolle überlässt. Das gelingt Markus Feldenkirchen über weite Passagen der Reportage, aber immer mal wieder setzt sich Kommentator durch, der dem Leser unbedingt mitteilen will, wie eine Geste, ein Satz, eine Szene zu deuten ist.
Um 15 Uhr trifft Schulz am Flughafen Schönefeld ein. Er steht vor seinem Wagen, schaltet sein Handy an. Es dauert einen Moment, dann sieht er auf dem Display die Frühprognosen der Meinungsforscher. Es ist, nun auch offiziell, das Ende seiner Kanzlerträume.
Das ist eine solide Beschreibung der entscheidenden Szene am Sonntag der Wahl. Der Leser weiß Bescheid, er braucht keinen Kommentar, auch keine Analyse, dass dies das Ende ist. Aber da kann sich der Reporter nicht mehr zurückhalten, es bricht aus ihm heraus, er schreibt, was der Leser denken soll:
Es ist nicht seine Schuld, dass er den europaweiten Trend nicht umkehren konnte, wonach viele der Sozialdemokratie nicht mehr zutrauen, die richtigen Antworten auf das Zeitalter der Digitalisierung zu haben. In den knapp 200 Tagen, die er nun Parteivorsitzender ist, ist das nicht zu leisten, erst recht nicht in den irren Zeiten des Wahlkampfs. Vielleicht wäre ein Kandidat mit weniger Stehvermögen und Leidenschaft in dieser Stimmungslage sogar noch sehr viel tiefer ins Ziel gekommen.
Über diese Fragen können Journalisten lange streiten: Wie viel Deutung darf in eine Reportage fließen, wie viele kommentierende Sätze? Wie stark darf man den Leser führen? Soll man ihm nicht sein Urteil selber finden lassen?
Eine starke Reportage fasziniert durch ihre Erzählung und einen Ton, der nicht belehrend klingt. Das fällt jedem schwer, der ein halbes Jahr einen Politiker begleitet, der am Ende schon so denkt und fühlt wie er: Da löst sich die Distanz auf.
Wenn ständig schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, erhalten die wenigen positiven eine umso größere Bedeutung. Sie wirken wie Antidepressiva gegen die Strapazen und das Gefühl von Vergeblichkeit. Auch wenn Schulz bisweilen in emotionale Löcher sackt, schafft er es immer wieder, sich selbst zu begeistern.
Da beobachtet der Reporter nicht mehr, da spricht schon ein Alter Ego – ebenso wie in diesem Satz:
Er hält eine mitreißende Rede, die Leute feiern ihn. Niemand ahnt, wie es in ihm aussieht.
Der Reporter ahnt es nicht nur.
Es gibt Szenen, in denen der Leser nicht mehr weiß, wer spricht: Schulz oder Feldenkirchen? Als nach der Schleswig-Holstein-Wahl Jörg Schönenborn von der „regionalen Komponente“ spricht, die den Wahlausgang bestimmte:
„Aha“, ruft Schulz. Er hält den Finger in die Luft. „Das ist ’ne interessante Analyse.“ Regionale Komponente bedeutet: SPD-Ministerpräsident Torsten Albig, der auf die falschen Themen gesetzt und ein unfassbar dämliches Interview zu seiner gescheiterten Ehe gegeben hat, ist schuld. Nicht er. Es ist ein klitzekleines Stück Hoffnung an einem trostlosen Tag.
Keinen Konjunktiv nutzt der Autor, diese Eigenart der deutschen Grammatik, eine indirekte Rede markierend: Da denken und fühlen offenbar Schulz und Reporter ähnlich „an einem trostlosen Tag“.
Markus Feldenkirchen schreibt durchgehend im Präsens, er geht chronologisch vor: Das mögen Reporter nicht, ist den meisten zu brav, zu simpel. Doch in der Erzählung eines Wahlkampfs, die ein halbes Jahr umfasst, ist die Chronik der beste, weil einfache Weg: Der Aufstieg und Fall des Helden hat Shakespeare-Format. Das erspart dem Schreiber komplizierte Rückblenden und den wenig schönen Plusquamperfekt.
Er sitzt in seinem Büro. Wieder läuft der Fernseher, wieder eine Niederlage, diesmal die schlimmste, in Nordrhein-Westfalen, Kernland der SPD. „Das Leben ist wie eine Hühnerleiter“, sagt Schulz. „Beschissen.“ Niemand reagiert, Stille im Raum. „Ich bin jetzt königlicher Niederlagenkommentator.“
Feldenkirchen verlässt zwar selten, aber unnötig, den Chronik-Modus und wechselt die Perspektive, interpretiert Episoden mit dem Wissen dessen, der den Ausgang kennt – wie die Leser. Zur Kampagnen-Unterbrechung während der Landtagswahlkämpfe lässt der Reporter Schulz aus dem Off des Nachhinein sprechen:
„Das war falsch“, sagt Schulz im Rückblick. „Wir hätten das weitermachen müssen.“
„Wie man inzwischen weiß“, so wird auch das TV-Duell aus dem Nachhinein beurteilt: So verlässt Markus Feldenkirchen den Strom der Erzählung. Die Reportage ist aber keine Analyse einer verlorenen Wahl, es ist die Geschichte von Aufstieg und Fall, von Wegen, Umwegen und Holzwegen. Der Vorteil von gradlinig erzählten Geschichten ist: Das Erzählen ohne erhobenen Zeigefinger, ohne dies „Ich weiß alles besser“. Im Nachhinein ist jeder klüger: Das ist die Haltung der Leitartikler, der Besserwisser.
Trotz einiger Einwände, die ein guter Redigierer hätte entdecken müssen:
Diese Langzeit-Reportage im „Spiegel“ ist ein journalistischer Glücksfall – mehr noch: Eine Liebeserklärung an die Politik in diesen unruhigen Zeiten, eine Verbeugung vor der Demokratie. Sie holt die Politiker vom Sockel, macht dem letzten AfD-Anhänger klar, dass Politik Menschenwerk ist – und so gesehen und respektiert werden sollte.
Markus Feldenkirchen sollte aus der Reportage ein Buch machen mit all den Geschichten, die es noch zu erzählen gibt.
„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über die Schulz-Story: Eine Geschichte, von der Reporter träumen
Feldenkirchen konnte mit Schulz im Taxi, im Flugzeug und zu Fuß reisen, ihn zu 50 Terminen begleiten; Strategiesitzungen, späte Currywurst-Dinner, ein letzter Kaffee (beziehungsweise Kräutertee, durch Inge Schulz ausgetauscht) am Wahlsonntag auf der Terrasse in Würselen inklusive. Fünf Monate lang war Feldenkirchen immer auf Abruf, Spontaneität ist ja alles im Wahlkampf. Häufig bekam er von Schulz oder einem seiner Leute 15 Minuten vor einem Treffen, einer Besprechung, einem Aufbruch einen Anruf. Am Ende der langen Tage war der Reporter stärker erschöpft als der Kandidat. „Wie soll das später eigentlich heißen, was Sie da schreiben: So wird man Oppositionsführer?“, fragte Schulz im August.
Es gab keine Tabus, nur die Wirklichkeit der Politik im Jahr 2017 und die eine Absprache, dass der Text erst nach der Wahl erscheinen dürfe. Und so ist eine dieser Geschichten entstanden, von denen Reporter und Chefredakteure träumen. Weil sie bleiben werden. Weil sie erzählen, was wirklich geschah.
Anfangs war Martin Schulz übrigens, natürlich, zögerlich gewesen. Der Kollege Feldenkirchen und ich hatten den Kandidaten in Hannover getroffen und ihm von der Idee erzählt; ich hatte einen Text des „New Yorker“-Chefredakteurs David Remnick in der Tasche, den dieser über die letzten Amtstage Barack Obamas geschrieben hatte, eben weil Obama dem Kollegen Remnick die Möglichkeit dazu gegeben hatte.
So etwas funktioniert ja nur mit Zugängen. Und mit Ernsthaftigkeit. Und wenn beide Seiten glauben, dass Politik, dass überhaupt Macht sich nicht abschotten darf. Zugänglich sein muss. Verletzlich sein darf. Dass eben hierin Mut liegt. Schulz‘ Umfeld war gegen das Projekt: viel zu riskant. Das war selbstverständlich nachvollziehbar.
Also vergingen drei Wochen. Dann sagte Schulz: „Wir machen das.“ Und in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit hielte ich es für gut, wenn sehr viel mehr Politiker sehr viel mehr Transparenz und Einblicke zuließen. Damit die Bürger erkennen könnten, dass es sich bei denen da oben um Menschen handelt, mit Stärken und Schwächen, mit Zweifeln und Überzeugungen; und damit die Politiker erkennen könnten, dass es nur der AfD hilft, wenn Imageberater und Pressestellen die Schwächen und die Zweifel verdecken wollen.
(Klaus Brinkbäumer in „Zur Lage“, dem Morgen-Newsletter des „Spiegel“ am 30. September 2017)
„Journalismus wird nur noch als Klotz am Bein mitgeschleppt“: Subventionen für Verlagen, das Tabu

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Vor acht Jahren sagte er: Medienpolitik gewährt notfalls auch die stützende Hand des Staates.(Foto: Bundestag / Walter Gross)
Darf der Staat Lokalzeitungen, die von der Pleite bedroht sind, stützen und sogar retten? In Deutschland wird dies meist rigoros abgelehnt, auch mit dem Argument, dies sei mit Demokratie und Marktwirtschaft nicht vereinbar. Professor Rudolf Wendt von der Universität des Saarlandes, zählt in einem Gutachten einige westeuropäische Staaten auf, die kleine Zeitungen unterstützen:
In den Niederlanden kann der „Business Fund for the Press“ Presseorgane finanziell in Form von Krediten und Krediterleichterungen unterstützen, wenn die Weiterführung oder die Geschäftsaufnahme eines Pressebetriebs gefährdet oder unmöglich ist.
Für Frankreich werden direkte Subventionen in unmittelbarem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation der Zeitungen gewährt. Die Unterstützung etwa für nationale Tageszeitungen ist zudem davon abhängig, dass Auflagenhöhe und Verbreitung gewisse Grenzen nicht überschreiten (Auflage: 250.000 Exemplare; Verbreitung: 150.000 Exemplare). Im Ergebnis ist es so, dass die am stärksten in ihrer Existenz gefährdeten Zeitungen, die besonders engagierten und profilierten kleineren Zeitungen, tatsächlich nur auf Grund der zahlreichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen überleben können.
Auch Schweden kennt staatliche Unterstützungsmaßnahmen, von denen gerade kleinere Presseunternehmen (Zeitungen in nachrangiger Wettbewerbsposition) profitieren. Bei einer Reihe dieser Unternehmen machen die staatlichen Leistungen einen beträchtlichen Teil des Gesamteinkommens aus.
In Luxemburg sieht man ebenfalls eine direkte staatliche Unterstützung als notwendig an, um das Überleben kleinerer Presseunternehmen zu garantieren.
Soweit das Gutachten des Saarbrücker Professors.
In der Schweiz haben die mitregierenden Sozialdemokraten eine Medienförderung durch den Staat mit einem Diskussionspapier wieder auf die politische Tagesordnung gebracht: „Es geht darum, ob die Schweizer Demokratie auch zukünftig auf die vierte Gewalt zählen kann. Und gerade in der Schweiz, wo die Bürgerinnen und Bürger mehrmals pro Jahr über teils komplexe Vorlagen befinden und wo es auch auf lokaler und regionaler Ebene journalistische Qualität und Vielfalt braucht, sind wir auf diese vierte Gewalt angewiesen.“
Massiv kritisiert die SP die großen Verlage. „Die verbliebenen Medienkonzerne fahren zwar hohe Profite ein, diese sind aber zunehmend von Journalismus entkoppelt. Die Eigentümerinnen und Eigentümer scheinen nicht bereit, auf Renditen zu verzichten. Also wird der Journalismus nur noch als Klotz am Bein mitgeschleppt und Schritt für Schritt weiter geschwächt.“
Auch die Grünen, die keinen Sitz im Bundesrat haben, setzen sich für eine öffentliche Pressefinanzierung ein. Die übrigen Parteien lehnen sie ab und folgen den Verlegern der großen Verlage. Auch in Deutschland sind die meisten Verlage, voran die Konzerne, gegen eine direkte staatliche Subvention; in der Regel gehen Verlage auch nicht in die Pleite, sondern werden von größeren Verlage gekauft.
Kleine Lokalzeitungen in der Schweiz hatten sich vor sechs Jahren dafür ausgesprochen, eine direkte Presseförderung zumindest zu prüfen – gegen den Verlegerverband, der sich, ausgestattet mit einigen Gutachten, gegen Subventionen ausgesprochen hatte. Hugo Triner ist Verleger des Bote der Urschweiz, einer Lokalzeitung mit 16.000 Auflage; er sagte in einem Interview mit dem Medienmagazin Edito:
Der Verband wird von den großen Verlegern dominiert. Das ist nicht nur ihre Schuld, es gibt einfach immer weniger kleine Verleger. Der Verband findet in seiner Stellungnahme, die Qualität der Medien sei mehr oder weniger in Ordnung. Ich sehe das anders: Ich stelle eine eindeutige Niveausenkung fest.
Das waren die Argumente der Lokal-Verleger für eine direkte Förderung von Zeitungen:
- Der Markt hilft nicht unbedingt, die Qualität zu steigern, wie es die USA und Italien beweisen.
- Eine direkte Presseförderung ist möglich, wenn der Staat nicht zu viel Einfluss auf den Inhalt nimmt.
- Die Gefahr der staatlichen Einmischung kann gebannt werden durch klare Kriterien, etwa: ein bestimmter Anteil redaktioneller Eigenleistungen oder ein Qualitätsmanagement.
Ob mit dem neuen Bundespräsidenten in Deutschland wieder Schwung in die Debatte um staatliche Förderung des Journalismus kommt? Vor acht Jahren schrieb Frank-Walter Steinmeier über Medienpolitik in der Demokratie: „
Sie setzt nicht auf die Kräfte des Marktes allein, sondern gewährt eine steuernde, stützende Hand der Gesellschaft, notfalls auch des Staates. Letzteres gilt vor allem dort, wo nicht nur eine vorübergehende Marktschwäche, sondern ein offensichtliches Marktversagen im Medienbereich festzustellen oder zu erwarten ist… Wer die Medien dem Markt überlässt, schwächt sie in ihrer demokratischen Rolle und macht sie ausschließlich zu Waren und Dienstleistungen.
Wäre bei uns eine Debatte über die Förderung von Lokalzeitungen notwendig? In den meisten Landkreisen gibt es nur eine Zeitung; in immer mehr Kreisen jenseits der Ballungsgebiete sind die Redaktionen so schwach besetzt, dass eine notwendige Kontrolle der Bürgermeister, Landräte und anderer Funktionäre so gut wie unmöglich ist. Ist dort die Demokratie in Gefahr? Wird die Mitwirkung der Bürger erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht, wenn sie nicht mehr gut und unabhängig informiert werden? Ist es nicht Aufgabe von Politikern, auch jenseits von Festreden die Demokratie zu stärken, gerade in den Städten, Dörfern und Kreisen?
**
Mehr dazu in meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS! Muss der Staat den Journalismus und die Demokratie retten?
Habermas beklagt: Journalisten passen sich zu sehr der Politik an

Jürgen Habermas bei einer Diskussion in der Hochschule für Philosophie München, 2008 (Foto: Wolfram Huke / Wikipedia)
„Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten“, sagte vor fünfzig Jahren Paul Sethe, der als Herausgeber die FAZ gründete. Wer Verleger sein wollte und die Massen mit seinen Zeitungen erreichen, brauchte teure Druckmaschinen. Das änderte sich mit dem Internet. Endlich wird der Traum der Achtundsechziger wahr: Jeder kann von vielen gelesen werden. Die Demokratie ist bei sich angekommen, Öffentlichkeit endlich verwirklicht.
Und nun? Jürgen Habermas, Philosoph der Achtundsechziger, beklagt in einem Interview, die Bürger bedienten sich der neuen Freiheit nicht im Sinne der Aufklärung, sondern kehrten sie gegen die Freiheit und würden zum „Saatboden für einen neuen Faschismus“.
Im Jubiläums-Heft der Blätter für deutsche und internationale Politik, vor sechzig Jahren gegründet, verdächtigt er etablierte Politiker wie Journalisten, „von Anfang an die falsche Richtung eingeschlagen“ zu haben:
Der Fehler besteht darin, die Front anzuerkennen, die der Rechtspopulismus definiert: „Wir“ gegen das System.
Wer mit Rechtspopulisten öffentlich debattiere, nehme sie ernst, verschaffe ihnen Aufmerksamkeit und mache den Gegner stärker – wie Justizminister Heiko Maas, der sich im Oktober mit Alexander Gauland von der AfD in einer ZDF-Talkshow duellierte.
Es sei Schuld der Medien, dass „nach einem Jahr nun jeder das gewollt ironische Grinsen von Frauke Petry kennt und das Gebaren des übrigen Führungspersonals dieser unsägliche Truppe“. Rechtspopulismus verdiene Verachtung statt Aufmerksamkeit. Im Juli hatte Habermas schon in einem Interview mit der Zeit aus der „Perspektive eines teilnehmenden Zeitungslesers“ die Anpassungsbereitschaft der Journalisten gegenüber Merkel und der Politik beklagt: „Der gedankliche Horizont schrumpft, wenn nicht mehr in Alternativen gedacht wird.“
Medien wie Parteien informierten die Bürger nicht mehr „über relevante Fragen und elementare Tatsachen, also über die Grundlagen einer vernünftigen Urteilsbildung“. Das Argument ist nicht weit entfernt von der Kritik bei den Pegida-Spaziergängen in Dresden.
Habermas bringt als weiteres Indiz für den Zerfall der Öffentlichkeit die Wahlmüdigkeit der jungen Leute. „Das klingt so, als sei wieder die Presse schuld“, wirft der „Zeit“-Redakteur Thomas Assheuer ein. „Nein“, zieht sich Habermas zurück, „aber das Verhalten dieser Altersgruppe wirft ein Schlaglicht auf die Mediennutzung jüngerer Leute im digitalen Zeitalter und auf den Wandel der Einstellung zu Politik überhaupt. Nach der Ideologie des Silicon Valley werden ja Markt und Technologie die Gesellschaft retten und so etwas Altmodisches wie Demokratie überflüssig machen.“
Die Forderung nach „Dethematisierung“ verbindet Habermas mit der Forderung an Journalisten und Politiker:
Die Bürger müssen erkennen können, dass jene sozialen und wirtschaftlichen Probleme angepackt werden, die die Verunsicherung, die Angst vor sozialem Abstieg und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, verursachen.
** Mehr in meiner JOURNALISMUS!-Kolumne auf kress.de: Gebt Rechtspopulisten keine Bühne
Nach Münchner Amok: Verliert seriöser Journalismus das Rattenrennen mit sozialen Netzwerken?

Barbara Hahlweg moderierte die Heute-Sendung am Abend des Amoklaufs in München. Foto: ZDF-Carmen Sauerbrei
Die Heute-Sendung des ZDF am Freitag begann, als gerade die ersten Nachrichten vom Amoklauf in München bekannt wurden und noch keiner wusste: Terror oder Amok? Tote und Verletzte? Barbara Hahlweg moderierte Heute und breitete nach einer Viertelstunde ein wenig verzweifelt die Arme aus, als wollte sie sagen: „Nun bitte, Regie, was machen wir denn jetzt?“ Die Geste sollten die Zuschauer eigentlich nicht sehen, aber alle waren verwirrt.
Was soll eine Moderatorin dem Zuschauer mitteilen, wenn die Schaltungen kaum funktionieren, sie nichts weiß und ihre Gesprächspartner noch weniger? Gutes Fernsehen im Auge von Terror und Amok ist live geradezu unmöglich: Es gibt keine Bilder oder nur die aus den sozialen Medien, die kaum einer einzuordnen weiß.
Was soll eine Moderatorin tun? „Im Unterschied etwa zur ARD werden im ZDF auch die Nachrichten in heute nicht von Sprechern, sondern von Redakteuren präsentiert, die für die professionelle Vorbereitung der Nachrichten verantwortlich sind. Journalistische Erfahrung und sachliche Kompetenz kommen dem Zuschauer direkt zugute“, so steht es auf den Internet-Seiten des ZDF.
Aber was nützt all die Erfahrung und Kompetenz in solch einer Lage? „Hektik und künstlich in die Länge gezogenes Gerede stärken die Glaubwürdigkeit nicht, sie schaden ihr“, sagt Claus Kleber, einer der Heute Journal-Moderatoren. Der hat gut reden, mag Barbara Hahlweg gedacht haben, falls sie dies am Morgen danach in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat.
Kleber schrieb den langen Beitrag „Was tun, wenn’s brennt?“ allerdings vor München. Die Druckmaschinen für die SZ-Deutschland-Ausgabe liefen schon mit dem Kleber-Artikel, als noch keiner etwas vom Amok in der Olympia-Mall ahnte. Kleber reagierte auf die Vorwürfe, beim Terror in Nizza und dem Türkei-Putsch nur langsam reagiert zu haben – im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken.
ARD-Aktuell-Chef Kai Gniffke hatte schon in einem FAZ-Interview auf diese Vorwürfe reagiert: „Was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.“
Ähnlich lesen wir bei Kleber:
Es ist niemandem geholfen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich auf ein Rattenrennen mit Social Media einlassen… Es muss nicht immer gleich pausenlos gesendet werden. Denn dann steigt tatsächlich die Gefahr, dass in der Bildernot ständig wiederholte emotionale Szenen das Gefühl von Hilflosigkeit verstärken, das Terroristen verbreiten wollen.
Wahrscheinlich wirkt eine fassungslose Barbara Hahlweg ehrlicher auf die Zuschauer als kühle Routine. Was soll sie denn sagen, wenn im Sendeablauf der Sport an der Reihe ist und sie, wie die meisten Zuschauer, Spielerwechsel in der Bundesliga nicht mehr für wichtig hält und das Wetter erst recht nicht?
Der Tagesschau-Moderator Jens Riewa, auch wenn er nur „Sprecher“ ist, versuchte eine Stunde später zwar mit Pokerface jedes Gefühl zu verbannen, aber ihm erging es nicht besser: Keine Nachrichten, kaum eine Leitung, die stand, Blaulicht und immer wieder Blaulicht – und so blieb es, als die ARD in den nächsten Stunden dran blieb. Thomas Roth in den Endlos-Tagesthemen am Münchner Abend war routinierter – ein halbes Jahrzehnt New York prägt eben -, aber er konnte seinen Gesprächspartnern auch nicht mehr entlocken als „Wir wissen noch nichts Genaues“, und dass er nicht mehr entlocken, dass er nicht Gerüchte anzetteln wollte, das zeichnete den Profi aus.
Aber verliert trotzdem das Fernsehen, wenn es ermüdende Dauerschleifen fährt, nicht gegenüber den Sozialen Netzwerken? Morgenmagazin-Moderatorin Dunja Hayali schreibt in einem Tweet:
Ich kann den Impuls ,ich will sofort alles wissen‘ verstehen. Mir geht es auch so. Als mich die erste Eilmeldung aus München erreichte, habe ich sofort den Fernseher angemacht. Es war noch nichts zu sehen. Der News-Junkie in mir war enttäuscht, der Newsmacher in mir dachte, richtig so.
Und was sollen die TV-Journalisten nun tun? Dunja Hayali zitiert die Antwort des Münchner Polizeisprechers Marcus da Gloria Martins: „Wir machen unsern Job.“ Und der Job der Journalisten ist: „Saubere, sachliche, anständige, unaufgeregte und zurückhaltende Arbeit. Unbestätigtes als solches benennen, aber dabei auch niemanden in falscher Sicherheit wiegen.“
Cleber schreibt in seinem Essay, dass „schnell“ zu seinen Lehrzeiten der wichtigste Maßstab war und mittlerweile zum fragwürdigsten geworden ist. Und er stellt die entscheidende Frage: Was wird, wenn die Bürger nur noch Soziale Medien wahrnehmen mit ihren Echtzeit-Dramen und nur noch wenige Bürger den recherchierenden Journalismus? Bei aller Begeisterung für Twitter, bei allem Verständnis, den ungeliebten Öffentlich-Rechtlichen eins auswischen zu wollen, darüber sollten wir in weniger aufgewühlten Zeiten in Ruhe debattieren:
Die USA machen uns gerade vor, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft mit dem ‚common ground‘ auch den ,common sense‘ verliert, wenn die gemeinsame Basis an Informationen wegfällt, auf der Menschen ihre unterschiedlichen Schlüsse ziehen können.
Die Frage stellt sich für alle seriösen Medien, ob TV, Presse und Lokalmedien. Was passiert, wenn die seriösen Medien nicht mehr die meisten Bürger erreichen?
Deutschlands beste kleine Zeitung kommt aus Marburg (150 Jahre Oberhessische Presse)
Die Oberhessische Presse dürfte die bedeutendste kleine Zeitung in der deutschen Provinz sein: Dreimal empfahl sie sich für die Ruhmeshalle der Zeitungsgeschichte:
Es begann in den achtziger Jahren, als alle Zeitungen in Deutschland Generalanzeiger waren. Eine Zeitung galt als Generalanzeiger, wenn in ihm dieselben Nachrichten standen, wie am Abend zuvor in der Tagesschau zu sehen waren; wenn der Aufmacher auf der Titelseite derselbe war wie der Aufmacher der Tagesschau, sprach man von Qualität. Den Lokalteil nahm keiner ernst.
Die Oberhessische Presse hatte in diesem Sinne keine eigene Qualität: Die Universitätsstadt kaufte den Mantel aus dem ländlichen Wetzlar, der war preiswert, aber nicht gut. Die Entscheidung des Verlegers, Mitte der achtziger Jahre in Marburg selbst den Mantel zu produzieren, war einmalig und revolutionär – aber gar nicht so teuer. Der gerade entwickelte Ganzseiten-Umbruch, ganz schlicht mit XY-Koordinaten, half der Geschäftsführung, auf einen großen Teil der technischen Vorstufe zu verzichten und in die Redaktion zu verlagern: Die Rationalisierung brachte Geld, das zum Teil in die Erweiterung der Redaktion gesteckt wurde.
Die Redaktion dachte nach, wie eine moderne Zeitung auszusehen hat, sie brach mit der Tradition des Generalanzeigers und nahm die wichtigen lokalen und regionalen Nachrichten auf die Titelseite und in das erste Buch: Ein neuer Typus von Zeitung entstand (parallel auch bei der Emder Zeitung an der Nordsee), von der Branche als das „Ende der Qualitätszeitung“ verspottet. Der Erfolg gab und gibt der Redaktion Recht: Die Auflage stieg zweistellig – und ein Vierteljahrhundert später preist die Branche das Lokale als die Rettung der Zeitung, auf Papier wie im Netz.
Den zweiten Eintrag in die Ruhmeshalle der Zeitungen schaffte die selbstbewusste und starke Redaktion mit ungewöhnlichen Themen und Serien: Sie gewann damals zweimal den Deutschen Lokaljournalistenpreis, was zuvor erst einer Redaktion in Deutschland gelungen war. Wer diesen Preis bekommt, darf sich ein Jahr lang als beste deutsche Lokalzeitung rühmen. (Bis heute hat die OP den Preis sieben Mal gewonnen.)
Guntram Dörr, heute Chefredakteur in Nordhorn, holte den ersten Preis mit einer Serie über Selbsthilfegruppen – damals ein neues Phänomen in einer Gesellschaft, die sich zunehmend auf ihre eigenen Kräfte besann, Solidarität übte und den Staat beiseite schob. Zum zweiten Mal holte die Redaktion den Preis mit der kritischen und ungewöhnlich ausführlichen Berichterstattung über Wahlen – als Hochfest der Demokratie.
Für prominente CDU-Politiker in Marburg war die Wahl-Berichterstattung zu kritisch: Sie verlangten vergeblich von der Adenauer-Stiftung, den Preis der OP abzuerkennen, und blieben aus Protest der Verleihung im Marburger Schloss fern.
Zudem gab es einige Sonderpreise, herausragend darunter Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“, die einmalig blieb und die Dieter Golombek, der Jury-Vorsitzende, so pries: „Dieses Projekt sprengt jeden Rahmen, es ist der gelungene Großversuch, das kunstvoll geknüpfte Netz der Macht in einer 80 000-Einwohner-Stadt zu beschreiben.“
Solch großer Journalismus in der Provinz musste über den Tag hinaus bewahrt werden: So entstand die Buch-Reihe „OP Report“, die dreizehn Mal erschien, mit Titeln wie „Selbsthilfegruppen“, „Wählen gehen“, „Macht in Marburg“, aber auch „Die rote Uni“, „Aktuelles Arbeitsrecht“ – oder „Schüler lesen“ mit Dokumentationen des ersten Zeitungsprojekts in Deutschland, das Till Conrad gemeinsam mit der Lehrerfortbildung eines Kultusministeriums organisiert hatte.
In die deutsch-deutsche Geschichte eingeflochten ist der dritte Eintrag in die Ruhmeshalle: Die Gründung der Eisenacher Presse in Marburgs Partnerstadt – die erste deutsch-deutsche Zeitung im Januar 1990, noch zu DDR-Zeiten, im Eisenacher „Haus der Dienste“ produziert, in Marburg gedruckt und mit 30 000 Exemplaren in wenigen Stunden verkauft. Die abenteuerliche Geschichte der Redaktion, der Zeitung und der Einheit ist mehrfach beschrieben, so im Buch „Aufbrüche und Umbrüche“ von Andreas Apelt und in meiner deutsch-deutschen Geschichte „Die unvollendete Revolution“.
Es dürfte kaum eine aufregendere kleine Zeitung in Deutschland geben: Das Beste, was die Provinz zu bieten hat, ohne provinziell zu sein. Wahrscheinlich ist auch die aktuelle Entwicklung der OP einen Eintrag wert: Statt diesen Zeitungs-Kleinod in einem Konzern untergehen zu lassen, wie es einigen Zeitungen widerfuhr, kaufte der Verleger seine Zeitung zurück – zum Wohle Marburgs und der Region, zum Wohle der Leser und der Redakteure und zum Wohle der Demokratie, die eine kräftige Stimme gerade dort braucht, wo die Heimat der Bürger ist.
Die preisgekrönteste kleine Redaktion in Deutschland
- 2014 Deutscher Lokaljournalistenpreis in der Kategorie Foto für die crossmediale Serie „Ich und Ich“.
- 2014 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2014“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für das Jahresprojekt „Besser Esser“ (1. Platz).
- 2013 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2013“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „Das schaffe ich“ (2. Platz).
- 2012 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2012“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „100 Leute, 100 Leben“ (2. Platz).
- 2010 Hessischer Jungjournalistenpreis für Nadine Weigel (heute Foto- und Videoredaktion) für ihren Text- und Video-Beitrag „Pomade und Petticoat“.
- 2009 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmedia-Design und -Branding“ für die Gießener Zeitung – Deutschlands erste Mitmachzeitung.
- 2008 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmediale Kampagnen” für die Oberhessische Presse.
- 1999 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für die Zukunftsserie „Marburg 2010“.
- 1995 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“
- 1993 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Berichterstattung zu den Kommunal- und Bürgermeisterdirekt-Wahlen
- 1989 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für die Serie „Der Fall Löser“
- 1988 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für das Konzept
- 1986 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Serie „Selbsthilfegruppen“
**
Der Beitrag erschien in der Oberhessischen Presse am 16. Juni 2016 zum 150-Jahr-Jubiläum; hier leicht verändert und erweitert. Der Autor war von 1985 bis 1995 Chefredakteur der OP und von 1990 bis 1994 auch der Eisenacher Presse.
Zehn Thesen zur Zukunft des Journalismus (Teil 20 mit Bilanz der Kress-Serie)

Andreas Wolfers leitet die Henri-Nannen-Journalistenschule von Gruner+Jahr: Er preist die klassischen journalistischen Tugend, auch und gerade in der Internet-Ära. (Foto: Journalistenschule)
„Wird mit dem Internet alles besser? Also multimedial, crossmedial, transmedial?“ Darum geht es in der letzten, der zwanzigsten Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“. So soll der Redakteur der Zukunft arbeiten: Er soll an Facebook, WhatsApp und Snapchat denken, Communitys betreuen, Videos produzieren und Podcasts, Grafiken, Snowfalls undsoweiter. Doch – „die Technologiedebatte überlagert völlig, worum es wirklich geht“, warf Nannen-Schulleiter Andreas Wolfers ein bei einer Tagung in der politischen Akademie Tutzing. „Nur weil wir digitale Tools nutzen, ist es keine andere Art von Journalismus.“
Wolfers führt eine der großen deutschen Journalistenschule, er preist das Handwerk, die klassischen journalistischen Tugenden:
Präzise Recherche, genaue Quellenprüfung, sicherer Umgang mit Texten, Themengespür, Relevanz aufspüren: Was wähle ich aus? Was mache ich sie groß? Das ist völlig unabhängig, ob Print, Online, Bewegtbild usw. Es lässt sich alles zurückführen auf die klassischen journalistischen Tugenden.
Allerdings erweitert das Digitale die Möglichkeiten: Journalisten können tiefer und präziser recherchieren, und sie haben mehr Kanäle zur Verfügung. Bessere Recherche und größere Verbreitung: Dem Journalismus ging es noch nie so gut wie heute.
Wenn davon auch die Demokratie profitieren könnte! Sie braucht informierte Bürger, und sie braucht Bürger, die einen annähernd gleichen Informations-Stand haben. Nur wer informiert ist, kann auch mitreden und vernünftige Entscheidungen fällen – und nur wer weiß, dass auch die Bürger, die mit ihm streiten, gut informiert sind.
Die Serie schließt mit zehn Thesen zur Zukunft des Journalismus:
- Journalismus ist Freiheit: Er sichert die Qualität der Demokratie und das Selbstgespräch der Gesellschaft.
- Journalismus ist unabhängig.
- Journalismus richtet sich nach den bewährten Regeln (und braucht keine neuen für die neuen Medien): Präzise Recherche, Kontrolle der Mächtigen und über allem die Achtung vor der Wahrheit.
- Journalismus braucht Journalisten, die die Regeln kennen und achten.
- Journalismus gedeiht nur mit exzellent ausgebildeten Journalisten.
- Journalismus ist lokal und erklärt die Welt aus der Perspektive der Leser.
- Journalismus wird immer wichtiger als Gegenspieler der Unübersichtlichkeit im Netz.
- Journalismus muss experimentieren und gerade im Netz die Chancen der Technik nutzen.
- Journalismus ist angewiesen auf eine Existenz-Garantie.
- Journalismus hat eine große Zukunft vor sich.
Mehr:
Risse im Rechtsstaat und Schwäche in der Demokratie
Was tun Zeitungen und Magazine, wenn unsere Demokratie schwächelt? Was setzen Lokaljournalisten, Reporter und Korrespondenten dagegen, wenn der Staat in einer Sinnkrise steckt?
Die Diagnose stellt mit Peter M. Huber ein Verfassungsrichter, geschrieben in einem Essay zum 25-Jahr-Jubiläum der Einheit vor einem Jahr, noch einmal zitiert heute in einem FAZ-Huber-Porträt:
Ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung steckt der durch das Grundgesetz verfasste Nationalstaat in einer Sinnkrise, der Rechtsstaat zeigt Erosionstendenzen, die Demokratie schwächelt, das Gewaltenteilungsgefüge hat sich weiter zugunsten der Exekutive verschoben, und die Entwicklung des Bundesstaats lässt eine Orientierung vermissen.
Die Therapie in den Medien ist eine Debatte wert, auch jenseits von AfD und Pegida. Die Presse und ihre Freiheit zählen zu den Grundrechten, also zu den Pfeilern, auf denen Staat und Demokratie stehen: Wer durch ein Grundrecht privilegiert ist, hat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Zu den Pflichten eines Journalisten zählt, die Demokratie zu stärken.
**
Quelle: FAZ, 1.10.2015
Die Überheblichkeit der Internet-Gurus und der Kleinmut der Journalisten (Zitat der Woche)
Es ist schade, dass Journalisten oft defensiv und kleinlaut auf die wirren Stimmen der Wut im Netz, auf die irrealen Visionen überheblicher Internet-Gurus oder die wichtigtuerischen Belanglosigkeiten klickreicher Youtube-Stars reagieren. Journalisten – auch wenn die meisten ,digital immagrants‘ im ,Neuland‘ sein mögen – können (und sollten!) mit Recht darauf verweisen, dass es in einer demokratischen Gesellschaft ohne sie nicht geht.
Laszlo Trankovits, ehemals Korrespondent der dpa in Washington, Afrika und im Nahen Osten in: „Journalismus 2020 – die Macht der Medien von morgen“, herausgegeben von „Deutsche Gesellschaft Qualitätsjournalismus“
Vorschlag einer Wirtschafts-Professorin: Non Profit-Medien, um die Demokratie zu retten
Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?
Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.
Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.
Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.
Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.
Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.
Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.
Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.
Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:
-
Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.
-
Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.
Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:
-
Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)
-
und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).
In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.
Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?
Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“
Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.
Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:
-
Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?
-
Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?
-
Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?
**
Quellen:
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?








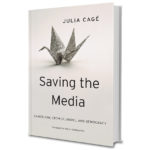


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von