Schreibe wahr! Die sechs Regeln der journalistischen Ethik (Journalismus der Zukunft – 13)
Was ist Wahrheit? Philosophen streiten seit Jahrhunderten – und Journalisten? Immer wieder flammt der Streit auf, was Wahrheit im Journalismus ist, warum der Pressekodex von Wahrhaftigkeit spricht (was ist das?) und warum wir oft die einfachen Regeln nicht beachten. Darum geht es in der 13. Folge der Kress-Serie „Der Journalismus der Zukunft“, in der auch die Wahrhaftigkeit erklärt wird.
Das sind die einfachen Regeln für einen Journalisten, der wahr informieren will:
1. Lüge nicht, also schreibe nicht das Gegenteil von dem, was Du als richtig erkannt hast.
2. Verschweige nichts, was Deine Mitbürger wissen müssen, um die Demokratie lebendig zu halten.
3. Misstraue allen, die die Wahrheit verkünden, und kontrolliere die, die wahr reden sollten.
4. Schreibe so klar, dass Du nicht missverstanden wirst.
5. Lasse Dich nie vor einen Karren spannen, ob Politik, Werbung, Wirtschaft oder Propaganda gleich welcher Art.
6. Folge dem Pressekodex, es sei denn, Du kannst eine andere Entscheidung begründen und vor Dir rechtfertigen.
Diese Regeln lassen sich in einem Satz zusammenfassen, den Hajo Friedrichs im letzten Interview vor seinem Tod gesprochen hat und der zur ersten Journalisten-Weisheit geworden ist: „Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken.“
Mehr lesen:
Tag der Pressefreiheit: „Türkei hat die Gruppe verlassen“
Eine Anzeige im österreichischen Magazin Profil zum „Tag der Pressefreiheit“: Ein Chat-Eintrag auf dem Smartphone zum 3. Mai:
Türkei hat die Gruppe verlassen.
Daneben einige handschriftliche Notizen:
- Angriffe auf Redaktionen
- Einreisesperren für Journalisten
- Missachten der Presse- und Meinungsfreiheit
- Inhaftierung von Journalisten
- Ausweisung von Journalisten
- Zwangsverwaltung von Medienhäusern
- Nachrichtensperren
Unten auf der Seite lesen wir (gut gemeint, aber mit einem schrägen Sprachbild):
Wer die Pressefreiheit untergräbt, macht die Demokratie verwundbar.
„Hintergründe aufdecken gegen Gerüchte und gefühlte Wahrheiten“ (Krüger-Interview 2)
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, spricht im zweiten Teil des Kress-Interviews über Strategien, wie Journalisten mit Politik-Verdrossenheit oder Verschwörungstheorien umgehen sollen.
Wie gewinnen Journalisten das Vertrauen zurück? Müssen sie mehr erklären, wie sie arbeiten?
Thomas Krüger: Dies ist ja bereits in vollem Gange. Redaktionen bekommen über die Sozialen Medien unmittelbare Rückmeldungen zu ihrer Berichterstattung. Journalisten die diesen Kommunikationsweg nicht als „Meckerecke“ abtun, sondern reagieren und sich auf die Diskussion einlassen. Der Dialog ist das A und O, um herauszufinden, was die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich möchten. Für die wiederum ist es wichtig, dass sie ernst genommen werden und in den Journalisten seriöse Partner wissen.
Ist die Medienverdrossenheit ein Spiegel der Politikverdrossenheit?
Thomas Krüger: Für bestimmte Personenkreise ist das sicherlich der Fall. Es ist ja kein Zufall, dass der Schlachtruf „Lügenpresse“ genau dort salonfähig ist, wo es Leute gibt, die – aus welchen Gründen auch immer – meinen, keine politische Stimme mehr zu haben und sich leider im demokratischen Parteienspektrum nicht mehr angemessen vertreten fühlen.
Redaktionen werden von ihren Lesern mit Verschwörungs-Theorien konfrontiert. Sollen sie darauf eingehen, wenn sie geballt in Briefen, Anrufen oder auf Facebook eintreffen?
Thomas Krüger: Auch bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien spielt das Internet eine große Rolle. Es hat dazu beigetragen, dass viele dieser Theorien überhaupt erst im Mainstream bekannt geworden sind, darunter auch solche, die einen rechtsextremen Hintergrund haben. Unser Anspruch als politische Bildner ist es ja, alle erreichen zu wollen und niemanden verloren zu geben. Natürlich ist es schwer, Personen argumentativ zu begegnen, deren Weltbild nicht mehr auf der Grundlage des Common Sense basiert. Versuchen muss man es trotzdem. Gerade dann, wenn solche Theorien auf öffentlichen Plattformen wie Facebook gestreut werden. Denn hier erreichen die Gegenargumente ja nicht nur den Absender selbst.
Sozialpsychologen haben herausgefunden: Die Verschwörung, detailliert nacherzählt, bleibt im Kopf hängen, die Widerlegung dagegen verblasst schnell. Was bedeutet das für Journalisten? Und für die politische Bildung?
Thomas Krüger: Das bedeutet, dass sowohl die Medien als auch wir in der politischen Bildung der „Kreativität“ der Verschwörungstheoretiker ebenso kreative Angebote entgegensetzen müssen.
Wie könnte solch eine Kreativität in einer Lokalredaktion aussehen?
Thomas Krüger: Sie sollte das machen, wofür Journalismus eigentlich schon immer steht: Hintergründe investigativ und faktenbasiert aufdecken und erklären. Ich halte dies für eine der wirkungsvollsten Methoden, um emotional geführten Debatten, die häufig von Gerüchten, Vorurteilen und „gefühlten Wahrheiten“ bestimmt werden, den Druck zu nehmen und in geregeltere Bahnen zu lenken.
Sind denn die Hassprediger noch zum Dialog bereit? Die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen hat es versucht – offenbar ohne Erfolg.
Thomas Krüger: Wenn wir zum Beispiel von den Anführern der Pegida-Bewegung sprechen, dann geht es um Personen, die seit Jahren in ihrem Weltbild gefestigt sind und sich mit Personen umgeben, die sie in diesem Weltbild bestätigen und bestärken. Es ist sehr schwer, solche Leute noch mit politischen Bildungsangeboten zu erreichen, da diese – ab einem gewissen Alter – ja immer auf freiwilliger Basis ablaufen. Politische Bildung kann keinesfalls das alleinige Mittel sein, ein gesamtgesellschaftlicher Prozess muss angestoßen werden. Und hier sehe ich politische Bildung wiederum in der Pflicht ihren Beitrag zu leisten.
Sind also die Sympathisanten noch zu erreichen? Die Menschen, die den Hasspredigern Beifall zollen?
Thomas Krüger: Am Auf- und Abschwung der Pegida-Veranstaltungen sieht man ja, dass dem so ist. Die zunehmende Radikalisierung der Forderungen hat nicht dazu geführt, dass die Demonstrationen mehr Zulauf bekommen – im Gegenteil. Ein für mich eindeutiges Zeichen, dass auch Personen noch erreichbar sind, die dem dort verbreiteten Gedankengut in Teilen zustimmen oder in der Bewegung zeitweise ein Ventil für ihre Sorgen gesehen haben.
Nirgends ist das Vertrauen der Leser so groß wie in ihren Lokalteil. Die Wut-Briefe, die in Redaktion eingehen, zeugen doch davon, dass die Menschen seit Jahrzehnten und immer noch die Zeitung lesen. Was würden Sie als Lokalchef tun?
Thomas Krüger: Das Fundament eines erfolgreichen Lokaljournalismus ist die Recherche. Aktueller Präzedenzfall ist natürlich die Suche nach Unterkünften für Geflüchtete. Verschiedene Lokalmedien haben hier großartige Arbeit geleistet, indem sie transparent aufgezeigt haben, wie viele Geflüchtete tatsächlich in die Region kommen, welcher Ort wie viele von ihnen aufnimmt, wie sie dort leben und woher sie kommen. In der „drehscheibe“, unserem Magazin für gute Ideen und Konzepte im Lokaljournalismus, stellen wir genau solche gelungenen Beispiele vor und hoffen, dass sich andere Zeitungen an ihnen orientieren.
Gerade für die Lokalzeitungen gilt, dass sie nah an den Leserinnen und Lesern sein müssen. Sie sollten ihnen das Gefühl vermitteln, in der Presse ein Sprachrohr und eine Plattform für die vor Ort geführten Diskurse haben, gerade auch für jene, die besonders kontrovers geführt werden. Nicht umsonst unterstützt die bpb seit vielen Jahren die lokale Politikberichterstattung mit den verschiedenen Angeboten des Lokaljournalistenprogramms.
Erleben wir die Dämmerung der Demokratie? Wächst langsam wieder die Sehnsucht nach einem, der alles besser macht?
Thomas Krüger: So schwarz sehe ich auf gar keinen Fall. Laut Kishon ist Demokratie ja das beste politische System, weil man es ungestraft beschimpfen kann. Ich bin überzeugt, dass sich dessen auch viele derer bewusst sind, die gerade ihre sogenannten Sorgen sehr lautstark äußern. Außerdem erlebe ich täglich zahllose engagierte Akteure, die daran mitarbeiten, die Demokratie lebendig zu halten. Dieser Einsatz, das Wissen und der Einfallsreichtum dieser Menschen sind die Voraussetzungen dafür, dass auch jene, die an unserer Gesellschaft zweifeln, wieder auf die richtige Seite gezogen werden können.
Deshalb müssen wir sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Auch die Rolle der Institutionen darf man nicht unterschätzen. Natürlich geben sie als „Teil des Systems“ ein dankbares Ziel für Kritik ab. Trotzdem ist es wichtig, dass Ministerien, Behörden, alle Teile der öffentlichen Hand ein klares Signal senden, indem sie Vielfalt und Demokratie vorleben. Nur so bleibt beides zukunftsfähig.
**
Mit Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, sprach Paul-Josef Raue. Das komplette Interview:
Achte Deinen Leser! (Folge 11 von „Journalismus der Zukunft“)
Warum fällt der Respekt vor den Bürgern ausgerechnet den Menschen so schwer, die in der Öffentlichkeit auftreten und die Öffentlichkeit repräsentieren? Warum neigt der Journalist bisweilen dazu, die Achtung, die er qua Funktion erfährt, in Verachtung zu verwandeln – und seinen Mut in Hochmut?
Dabei lautet die erste Lektion im Lehrbuch der Demokratie: Es gibt keine guten und schlechten Bürger, keine erste, zweite und dritte Klasse; jeder kann wählen, demonstrieren, Initiativen gründen, Kommentare, Blogs, Leserbriefe und Tweets schreiben oder auch nichts tun. Und wenn alle vor dem Gesetz gleich sind, so sind sie es auch vor den Medien.
Journalismus in einer Demokratie ist ein öffentliches Gut, er gehört allen. Deshalb und nur deshalb haben Journalisten eine besondere Stellung: Sie sind von der Verfassung auserwählt als die radikalen Verteidiger der Freiheit; aber sie verteidigen ihre Freiheit nur, wenn sie die Freiheit der Bürger verteidigen.
Die Macht der Journalisten ist eine geliehene Macht. Nicht weil sie Journalisten sind, genießen sie die größte Freiheit; sie genießen Freiheit und Macht nur, weil sie Treuhänder der Bürger sind und nicht Lautsprecher von Politikern und Verwaltungen. Deshalb haben sie Macht, aber sie können die Macht nicht übernehmen; Entscheidungen fällen andere. Diese Macht ist die Macht der Nachricht und der Kontrolle und Kritik; diese Macht kann kein Politiker, kein Richter wesentlich einschränken.
Darum geht es in der elften Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Achte Deinen Leser!
Ohne tiefe Recherche keine Demokratie und keine Kontrolle der Macht (Journalismus der Zukunft – 9)
Journalisten stürzten im Watergate-Skandal den US-Präsidenten, und sie deckten den systematischen Missbrauch von Kindern durch katholische Priester auf. Diese Recherchen schrieben das Drehbuch für zwei Filme, die mehrere Oscars gewannen:
„Die Unbestechlichen“ (All the president’s men) und jüngst „Spotlight“ über das Reporter-Team des Boston Globe. Die beiden Filme sind ein Plädoyer für die tiefe und professionelle Recherche. Nur wenn Journalisten und Verleger mit Leidenschaft und Geld die Recherche weiter fördern, wird unsere Demokratie lebendig bleiben; nur so wird die Kontrolle der Mächtigen weiter funktionieren. Darum geht es im neunten Teil der Kress-Reihe „Journalismus der Zukunft“.
„Spotlight“ zeigt eindrucksvoll die Schwierigkeiten der Recherche im Lokaljournalismus zwischen Nähe und Distanz. In einer Schlüsselszene des Films treffen sich „Spotlight“-Chef Robinson und ein Freund, der den Kardinal berät. Dieser appelliert an den Reporter: „Das ist doch unsere Stadt. Hier leben Menschen, die die Kirche brauchen und deren Vertrauen zerstört wird. Und diese Priester sind doch nur Einzelfälle, wenige faule Äpfel.“
Dieses Gemeinschafts-Gefühl „Wir Kinder dieser Stadt müssen doch zusammenhalten“ schließt den Fremden aus und argumentiert mit dem Wohl der Stadt: Doch die Mächtigen verwechseln – nicht nur in Boston – bisweilen ihr eigenes Wohl, also Wiederwahl und Ruhm, mit dem Wohl der Stadt. Das Wohl der Stadt ist das Wohl der Bürger, die alles Wichtige wissen müssen.
Eine gute Lokalredaktion braucht beide: Den Fremden mit seiner Distanz und den Einheimischen, der die Stadt und ihre Menschen kennt, der Kontakte hat und sie zu nutzen weiß (oder auch nicht). Beide zusammen sind unschlagbar.
Wovon Journalisten lernen können: Der Bundespräsident als Geschichten-Erzähler
Journalisten wissen, dass ihre Leser bei den Geschichten hängenbleiben: Erzählen, erzählen, erzählen! Journalisten sollten Geschichten-Erzähler sein – aber im Vergleich mit den Literaten nur die wirklichen Geschichten erzählen, am besten die, die sie selber erlebt haben.
Bundespräsident Joachm Gauck, sonst eher fürs Belehrende und die Moral zuständig, hat ein Beispiel für die Kraft von Geschichten gegeben und sich als Geschichten-Erzähler beliebt gemacht bei seinem schwierigen Besuch in China: Ich erzähle meine Geschichte und die Geschichte meines Landes. Ein Diplomat ist, wer Geschichten und Geschichte erzählen kann statt Vorwürfe zu machen und den anderen bloß zu stellen.
Gauck erzählte seine Geschichten aus der untergegangenen DDR, in der er Pfarrer war, und erzählte die Geschichte der Vereinigung zweier ungleicher Gesellschaften, er erzählte Geschichten vom Unrecht und vom Recht, er erzählte von Menschen und ihren Erfahrungen und stellte sie neben – und nicht über – die Erfahrungen der Menschen in China.
Ich komme aus einem Land zu Ihnen, das vielerlei Erfahrungen gesammelt hat mit Neuanfang, Transformation und Anpassung. Aus einem Land, das vor mancherlei Problem gestanden hat, mit dem sich auch China auseinandersetzen muss. Deutschland hat einen besonderen, einen vor allem selbstverschuldet schwierigen Weg hinter sich. Nach zwei Gewaltherrschaften und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem es gegen die Gebote der Menschlichkeit verstoßen und schrecklichste Menschheitsverbrechen begangen hat, ist es schließlich – zuerst im Westen, 1990 dann in Gänze – zu einem anderen Land geworden. Einem Land, in dem alle staatliche Gewalt einem obersten Grundwert verpflichtet ist: der Würde des Menschen. So möchte ich Ihnen etwas von meinem Land, von seiner Geschichte und ein wenig auch von meinem Leben berichten. Diese Erfahrungen dränge ich niemandem auf – nicht Ihnen und nicht Ihren Landsleuten. Sie sind ein Angebot besser zu verstehen, was mich, aber auch die deutsche Gesellschaft leitet.
Das ist die Geste, die den anderen nicht in die Ecke stellt, sondern zum Mitdenken auffordert: Meine Erfahrungen drängen ich niemandem auf, sie sind ein Angebot – erst recht wenn ich auch von den Misserfolgen erzähle.
Nicht nur über deutsche Erfolge kann ich Ihnen berichten. Ich habe auch erlebt, was einer Gesellschaft fehlen kann. Mehr als vier Jahrzehnte lang habe ich – als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener – in der DDR gelebt, jenem Staat, dessen Propaganda ihn als den „besseren“ der beiden deutschen Staaten anpries. Doch das war er nicht. Es war ein Staat, der als Teil des kommunistischen Staatenverbundes und abhängig von der Sowjetunion sein eigenes Volk entmündigte, einsperrte und jene demütigte, die sich dem Willen der Führung widersetzen.
Dieser Staat sollte als „Diktatur des Proletariats“ den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung dienen, der Ausbeutung ein Ende setzen, der Entfremdung der Menschen wehren und so ein Zeitalter des Glücks und der Zufriedenheit eröffnen. Das Problem dieser Zeit aber war, dass die Mehrheit der Menschen weder beglückt noch befreit war. Und dem ganzen System fehlte eine tatsächliche Legitimation. Eine Wahl durch die Bevölkerung, die frei, gleich und geheim war, gab es nicht. Die Folge war ein Glaubwürdigkeitsdefizit, verbunden mit einer Kultur des Misstrauens zwischen Regierten und Regierenden.
Wer so spricht, ist kein Richter, kein arroganter Moralist: Er spricht von sich und meint den anderen. Am Ende seiner Rede vor Studenten der Shanghai-Universität kommt dann doch der Pfarrer durch, der sich nicht sicher ist, ob alle Zuhörer die Lehre aus dem Erzählten ziehen. Also doziert er für seine Gemeinde vom Nutzen der Geschichten fürs Leben:
Dass sich alle Institutionen des Staates, alle Parteien und Personen der Herrschaft des Rechts beugen, ist zu einem unverzichtbaren Leitgedanken der deutschen Demokratie geworden. Er begleitet, lenkt und begrenzt die Macht der Regierenden.
Es ist ein schöner Satz, auch für Journalisten – und nicht nur formuliert fürs Poesiealbum der Volontäre: Er fasst das, was Demokratie ist, schnörkellos in knapp drei Dutzend Wörtern zusammen. Auf den Internet-Seiten des Bundespräsidenten, die alle Reden versammeln, fehlt dieser Satz. Er stand wohl nicht im Manuskript; Constanze von Bullion hat genau zugehört und ihn für die Leser der Süddeutschen Zeitung notiert.
Constanze von Bullion nennt Gaucks Erzähl-Strategie einen Trick. Es ist Diplomatie und Respekt vor den Menschen.
**
Quellen: Reden des Bundespräsidenten (http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2016/03/160323-China-Universitaet.html – Stand 25. März, 11 Uhr) und Süddeutsche Zeitung, 24. März „Eine Rede, zwei Interpretationen“
Bürger misstrauen Journalisten schon immer: Die Krise ist nicht neu (Serie „Journalismus der Zukunft“)
Haben die Deutschen ihr Vertrauen in die Medien verloren? Ja, aber dies ist schon seit Jahrzehnten so, und es ist typisch für den skeptischen Bürger in einer Demokratie. Um die von den Medien selbst hochgespielte Vertrauenskrise geht es im siebten Teil meiner Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“. Der Münchner Kommunikations-Professor Carsten Reinemann meint, Journalisten könnten nicht mit Zahlen umgehen, und stellt nach seinen Recherchen fest:
Zumindest bis Ende 2014 hat sich das Medienvertrauen großer Teile der Bevölkerung gar nicht dramatisch verändert. Auch die im Jahr 2015 erhobenen Daten lassen diesen Schluss nicht zu.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Professor Kim Otto und Andreas Köhler von der Universität Würzburg, die Umfragen des Eurobarometers auswerten, die von der EU jährlich in Auftrag gegeben werden:
Von einer neuen generellen Vertrauenskrise in die Medien in Deutschland kann angesichts der Langzeitdaten nicht gesprochen werden. Insofern kann die gegenwärtige gesellschaftliche Diskussion über die Arbeit der Journalisten schon fast als hysterisch bezeichnet werden, und es wäre ratsam, Dampf aus der Debatte zu nehmen.
Wer sich in der politischen Mitte verortet, vertraut den Medien im Gegensatz zu denen, die sich politisch extrem einstufen, also weit rechts oder links. „Dass dieser Personenkreis von ,Lügenpresse‘ spricht, ist ein weit bekanntes Muster“, meinen die Wissenschaftlicher.
Umfragen zeigen, dass mehr als jeder fünfte befragte Pegida-Anhänger deutliche Kritik an der Arbeit von Journalisten übt. Dabei steht insbesondere der Vorwurf der Tendenzberichterstattung im Raume.
Auch wer seine wirtschaftliche Lage als schlecht einstuft, misstraut eher den Massenmedien. So fehlt der Mehrheit der Ostdeutschen das Vertrauen im Gegensatz zu den Westdeutschen: 58 Prozent misstrauen im Osten, nur 47 Prozent im Westen. Professor Otto:
Die Menschen in Ostdeutschland sind bekanntlich mit dem Funktionieren der Demokratie grundsätzlich unzufriedener als die Menschen in Westdeutschland. Auch das Institutionenvertrauen ist geringer.
**
Die Links:
http://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/medienvertrauen-auf-dem-tiefpunkt
Wie organisiert sich eine Redaktion am besten? (Serie 6: Die Zukunft des Journalismus)

Joachim Braun, Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse, fotografiert auf Facebook die „Flure“ in seiner neuen Redaktion serienweise
Ein Blick zurück und in andere Länder lohnt: In den dreißiger Jahren flogen Brieftauben die Filmrollen in die Redaktion; in den angelsächsischen Ländern rund um den Globus gab und gibt es schon immer die klare Trennung von Recherche und Redigieren, Reportern und Blattmachern; in Deutschland gingen Journalisten nach dem Krieg einen Sonderweg, auf dem der Redaktroniker, vornehmlich in Lokalredaktionen, heimisch wurde. Der deutsche Redakteur arbeitete in seiner Denkerstube, in die er über lange Flure kam: Man sah sich nur in den langen Konferenzen.
Weil sich immer mehr Leser im Internet informieren, scheint sich auch bei uns der gemeinsame Zeitungs- und Online-Desk, der angelsächsisch geprägte Newsdesk, durchzusetzen.
Damit lösen Chefredakteure viele Probleme, aber schaffen neue: Die Zeitungsredakteure übernehmen schnell wieder das Kommando, so dass Online weiter Stiefkind bleibt inklusive der sozialen Netzwerke.
Zudem geht es in dieser Folge über die Zukunft des Journalismus auch über die Zukunft der Demokratie: Wer kontrolliert noch den Landrat, erst recht die Bürgermeister in den kleinen Gemeinden, wenn eine ausreichend große Lokalredaktion nicht mehr zu finanzieren ist?
Kleine und mittlere Zeitungen in der Provinz, so sie noch selbständig sind, haben die besten Überlebens-Chancen. Gehen sie in einem Konzern auf, verliert erst das Lokale im Wirbel der Synergien und verschwinden schließlich die Leser
**
Der komplette Text: „Die Organisation der Redaktion“ – Teil 6 der Reihe von Paul-Josef Raue zur Zukunft des Journalismus, hier:
Spotlight – ein exzellenter Film über Journalismus, Recherche, Professionalität und Unabhängigkeit
Spotlight ist ein Film über Journalisten und für Journalisten – der gerade den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Erzählt wird die wahre Geschichte des Reporter-Teams „Spotlight“. Es recherchierte für den Boston Globe, dass Hunderte von katholischen Priestern Kinder missbraucht hatten mit Wissen des Kardinals.
Wer mit Begeisterung Journalist ist, sollte sich diesen Film ansehen aus vier Gründen:
- Spotlight zeigt, dass Recherche die Basis des Journalismus und der Demokratie ist: Nur so gelangen Nachrichten in die Öffentlichkeit, die von den Mächtigen unterdrückt werden. Die Demokratie lebt nicht nur von Pressemitteilungen aus den Zentralen, sondern von den Recherchen aus den Hinterzimmern der Macht. Für die Bürger sind diese Nachrichten oft wichtiger als die Verlautbarungen der Mächtigen.
Pressefreiheit, die unsere Verfassung garantiert, ist vor allem die Freiheit der Recherche – und daraus abgeleitet auch die Pflicht zur Recherche. - Spotlight zeigt, wie eine gute Recherche abläuft:
Erstens brauchen die Reporter Hartnäckigkeit, denn jede schwierige Recherche verrennt sich immer wieder in Sackgassen und scheint zu scheitern.
Zweitens braucht die Recherche ein Team, das aus unterschiedlichen Charakteren zusammengesetzt ist, das zusammen arbeitet, das sich gegenseitig hilft und beim Streit um die richtige Strategie nie das Ziel aus den Augen verliert. Der investigative Einzelgänger ist selten, er lebt vor allem in den Kriminalromanen von Dashiell Hammett und Raymond Chandler. Recherchierende Reporter sind weder abgebrüht noch ausgekocht, sie brechen auch keine Regeln, sondern gehen – wenn ihnen Dokumente vorenthalten werden – auch mal vor Gericht und klagen die Herausgabe ein.
Drittens ist Recherche erst einmal Lesen in Akten, Lesen in Archivbänden, Lesen in Mails und Briefen von Lesern, auch von denen, die man als Querulanten abgestempelt hatte, Lesen in den eigenen Artikeln, die schon erschienen sind. Die Recherche in Spotlight kommt vom Fleck, als in der Bibliothek die Jahresbände des katholischen Bistums entdeckt werden mit Angaben sämtlicher Priester und der Gemeinden, in denen sie wirkten.
Dann folgt das Kombinieren, die Entdeckung der inneren Logik der Geschichte: Wo ist der rote Faden? Was hängt miteinander zusammen? Mit wem müssen wir sprechen? Wo sind die besten Informanten?
Schließlich braucht man die Gespräche mit Opfern, Anwälten und Tätern, und man braucht Geduld, nach der siebten zugeschlagenen Tür weiterzumachen, und man braucht die Gabe, trotz aller Distanz den Informanten Sicherheit und Vertrauen zu garantieren. Mindestens eine Frau braucht jedes Recherche-Team.
Auf eine Tiefgarage zu hoffen, in der hinter einem Pfeiler ein Informant wartet mit einem dicken Umschlag – das ist weltfremd. - Spotlight beleuchtet den Lokaljournalismus mit seinem Mix aus Nähe und Distanz: Den Anstoß zur Recherche gibt der neue Herausgeber Marty Baron – einem Chefredakteur bei uns vergleichbar -, gerade aus Florida nach Boston gekommen: Er liest in einer Kolumne vom Missbrauch und fragt in seiner ersten Ressortleiter-Konferenz, ob weiter recherchiert werde. Ein nassforscher Redakteur spöttelt: Das ist eine Kolumne, da wird nicht mehr recherchiert.
Es wird recherchiert – auch gegen den Unwillen von Spotlight-Chef Walter Robinson, der Hinweise unterdrückt hatte, um seiner Heimatstadt und der Kirche nicht zu schaden.
In einer Schlüsselszene des Films treffen sich Spotlight-Chef Robinson und ein Freund, der den Kardinal berät: „Das ist doch unsere Stadt. Hier leben Menschen, die die Kirche brauchen und deren Vertrauen zerstört wird. Und diese Priester sind doch nur Einzelfälle, wenige faule Äpfel.“
Dieses Gemeinschafts-Gefühl „Wir Kinder dieser Stadt müssen doch zusammenhalten“ schließt den Fremden aus: „Der neue Herausgeber kommt aus New York und Florida, für ihn ist Boston nur eine Zwischenstation in seiner Karriere. Bald geht er wieder.“
Argumentiert wird mit dem Wohl der Stadt: Doch die Mächtigen verwechseln – nicht nur in Boston – bisweilen ihr eigenes Wohl mit dem Wohl der Stadt. Das Wohl der Stadt ist das Wohl der Bürger, die alles Wichtige wissen müssen.
Eine gute Lokalredaktion braucht beide: Den Fremden mit seiner Distanz; er ist nicht Teil eines Netzes von Freunden, die man schon aus dem Kindergarten kennt. Und sie braucht den Einheimischen, der die Stadt und ihre Menschen kennt, der Kontakte hat und sie zu nutzen weiß (oder auch nicht). Beide zusammen sind unschlagbar.
- Spotlight beweist, wie wichtig Unabhängigkeit für eine Zeitung ist. Der Verleger möchte am liebsten Ruhe haben und setzt seine Ruhe gleich mit Ruhe in der Stadt. Die Reporter möchten auch Ruhe haben. Ein Unruhiger, der übrigens in sich ruht, ein Unruhiger wie der Chefredakteur an der Spitze reicht, um die Profis in der Redaktion an ihre Pflicht zu erinnern: Nutzt Eure Unabhängigkeit! Erfüllt Euren Auftrag, der lautet: Seid Sprachrohr der Bürger, nicht Sprachrohr der Mächtigen!
Am Ende gibt die Zeitung den Opfern eine Stimme und rüttelt die wach, die der Kirche vertrauten, obwohl ihre Funktionäre das Vertrauen missbraucht hatten.
Als der neue Chefredakteur zum Antrittsbesuch beim Kardinal erscheint, lächelt der Mann Gottes: „Eine Stadt erblüht, wenn ihre großen Institutionen zusammenarbeiten.“ Marty Baron, der Chefredakteur, lächelt nicht zurück und antwortet trocken: „Eine Zeitung funktioniert am besten, wenn sie alleine arbeitet.“
Der Film zeigt den Wert der tiefen Recherche, und er zeigt ein Defizit des deutschen Journalismus: Nur in den Magazinen wie dem Spiegel und in den nationalen Zeitungen, vorbildlich in der Süddeutschen, wird systematisch recherchiert, in den Regional- und Lokalzeitungen selten oder gar nicht. Wir brauchen solche Recherche-Teams wie „Spotlight“: Vier Redakteure, drei Männer und eine Frau, sind es in Boston.
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist schwierig: Wer an eine langen und schwierigen Recherche arbeitet, fällt für die Tagesproduktion aus. Ist er erfolgreich, stärkt er das Vertrauen der Leser – und das ist mittlerweile unbezahlbar.
Der Boston Globe druckte nach der ersten Reportage, die den Skandal enthüllte, noch sechshundert weitere. Da stimmte sogar die Kosten-Nutzen-Rechnung.
Auch in Deutschland gab es viele Missbrauchs-Fälle. Erst acht Jahre nach dem Skandal in Boston deckten auch deutsche Reporter systematisch auf, beginnend mit einer Recherche der Berliner Morgenpost im Canisius-Kolleg – die eine professionelle Qualität hatte wie die des Boston Globe.
Besteht die Unwort-Jury selber aus Gutmenschen? Oder will sie nur belehren? (Friedhof der Wörter)
Ist „Gutmensch“, das Unwort des Jahres, ein gutes Unwort? Fragen wir den großen Weimarer Dichter:
Der edle Mensch
Sei hilfreich und gut!
Unermüdet schaff er
Das Nützliche, Rechte.
So endet Goethes Gedicht „Das Göttliche“. Zwei Merkmale hat also der Mensch: Er hilft, er ist gut. Genauer: Er soll gut sein, soll sich darum mühen, er sei eben gut.
Gut zwei Jahrhunderte später soll sich jeder schämen, wenn er von guten Menschen spricht? Es lohnt ein Blick in die Motive der sechsköpfigen Jury, in der vier Sprachwissenschaftler in der absoluten Mehrheit sind, darunter nur eine Frau. Sie wollen das Volk belehren, wollen ihm die schlechten Wörter austreiben. Mit Wissenschaft hat das wenig zu tun.
Und dem Volk aufs Maul schauen sie auch nicht: Der „Gutmensch“ steht nur auf dem dritten Platz der Einsendungen; die folgenden Rügen – „Hausaufgaben“ und „Verschwulung“ -, tauchen unter den ersten zehn Vorschlägen überhaupt nichts auf. Überhaupt scheint sich das Volk wenig ums Unwort zu kümmern: 1640 beteiligten sich; zum Vergleich: Im kleinen Volk der Österreicher beteiligten sich am Unwort-Wettbewerb zwanzig Mal so viel!
Die Moral beurteilen die Sprachforscher, nicht die Sprache; das ginge so: Das Substantiv ist der Übeltäter, weil es aus der Verbindung vom positiv besetzten Adjektiv „gut“ und dem ebenfalls positiven „Mensch“ eine Abwertung schafft. Zusammengesetzte Substantive sind das Besondere der deutschen Sprache, sie verwandeln Wörter: Ein Gutmensch ist eben nicht der gute Mensch, vielmehr bekommt das Wort eine eigene Bedeutung.
„Mit dem Vorwurf ,Gutmensch‘ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm oder weltfremdes Helfersyndrom diffamiert“, schreibt die Jury, die offenbar auch aus Gutmenschen besteht, obwohl diese Bezeichnung an dieser Stelle zumindest politisch nicht korrekt ist.
Gute Menschen können anstrengend sein: Der moralinsaure Ton kann auf die Nerven gehen, auch die Attitüde, wir sind die besseren Menschen. Mit Gutmenschen bezeichnen wir vornehmlich die, deren Gut-Sein sich im Appell an den Staat oder andere erschöpft, endlich Gutes zu tun. Doch das sind keine Gutmenschen, sondern Gut-Forderer.
Wie soll man die Gutmenschen denn nennen? Mit der Rüge ist das Denken nicht verschwunden: Utopisten, Träumer, Weltverbesserer? Oder einfach: gute Menschen? Wer so spricht, dem vergeht jeder Spott.
Enden wir mit Goethe, der in einem Gedicht von Gutmann und Gutweib spricht. Es ist ein lustiges Gedicht.
**
Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 18. Januar 2016 (dieser Blog ist eine erweiterte Fassung)
Info:
Die Jury bilden die Sprachwissenschaftlern Prof. Dr. Nina Janich/TU Darmstadt (Sprecherin), PD Dr. Kersten Sven Roth (Universität Düsseldorf), Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald) und Prof. Dr. Martin Wengeler (Universität Trier) sowie der Autor Stephan Hebel. Als jährlich wechselndes Mitglied war in diesem Jahr der Kabarettist Georg Schramm beteiligt.
Begründungen der Jury laut Pressemitteilung:
> „Gutmensch“ ist zwar bereits seit langem im Gebrauch und wurde auch 2011 schon einmal von der Jury als ein zweites Unwort gewählt, doch ist es im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema im letzten Jahr besonders prominent geworden. Als „Gutmenschen“ wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen.. Der Ausdruck „Gutmensch“ floriert dabei nicht mehr nur im rechtspopulistischen Lager als Kampfbegriff, sondern wird auch hier und dort auch schon von Journalisten in Leitmedien verwendet. Die Verwendung dieses Ausdrucks verhindert somit einen demokratischen Austausch von Sachargumenten. Im gleichen Zusammenhang sind auch die ebenfalls eingesandten Wörter „Gesinnungsterror“ und „Empörungs-Industrie“ zu kritisieren. (Der Ausdruck „Gutmensch“ wurde 64-mal und damit am dritthäufigsten eingesendet.)
> „Hausaufgaben“ Das Wort „Hausaufgaben“ wurde in den Diskussionen um den Umgang mit Griechenland in der EU nicht nur, aber besonders im Jahr 2015 von Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten als breiter politischer Konsensausdruck genutzt, um Unzufriedenheit damit auszudrücken, dass die griechische Regierung die eingeforderten so genannten Reformen nicht wie verlangt umsetze: Sie habe ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht. In diesem Kontext degradiert das Wort souveräne Staaten bzw. deren demokratisch gewählte Regierungen zu unmündigen Schulkindern: Ein Europa, in dem „Lehrer“ „Hausaufgaben“ verteilen und die „Schüler“ zurechtweisen, die diese nicht „erledigen“, entspringt einer Schule der Arroganz und nicht der Gemeinschaft. Das Wort ist deshalb als gegen die Prinzipien eines demokratischen Zusammenlebens in Europa verstoßend zu kritisieren.
> Verschwulung“ Das Wort „Verschwulung“ ziert einen Buchtitel des Autors Akif Pirinçci („Die große Verschwulung“) und wurde von der Online-Zeitschrift „MÄNNER“ und ihren Lesern zum „Schwulen Unwort 2015“ gekürt. Die Jury teilt die Ansicht der Zeitschrift und ihrer Leser, dass ein solcher Ausdruck und die damit von Pirinçci gemeinte „Verweichlichung der Männer“ und „trotzige und marktschreierische Vergottung der Sexualität“ eine explizite Diffamierung Homosexueller darstellt und kritisiert den Ausdruck daher ebenfalls als ein Unwort des Jahres 2015. Auch durch die Analogie zu faschistischen Ausdrücken wie „Verjudung“ ist die Bezeichnung kritikwürdig.
Unwort-Statistik 2015: Für das Jahr 2015 wurden 669 verschiedene Wörter eingeschickt, von denen ca. 80 auch den Unwort-Kriterien der Jury entsprechen. Die Jury erhielt insgesamt 1644 Einsendungen. Die zehn häufigsten Einsendungen, die allerdings nicht sämtlich den Kriterien der Jury entsprechen, waren
- Lärmpause [165],
- Willkommenskultur [113],
- Gutmensch [64],
- besorgte Bürger [58],
- Grexit [47],
- Wir schaffen das! [46],
- Flüchtlingskrise [42],
- Wirtschaftsflüchtling [33],
- Asylgegner/-kritiker/Asylkritik [27]
- Griechenlandrettung/ Griechenlandhilfe [27].
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?





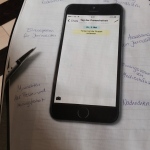





 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von