Alle Artikel der Rubrik "C Der Online-Journalismus"

Die FAZ am 16. Juli 2016 nach dem Anschlag in Nizza
„Nice“ ist nett, ist ein schönes englisches Wort, das viele kennen, auch wenn sie nur Bruchstücke des Englischen verstehen. „Nice“ ist aber auch das englische Wort für Nizza, die seit dieser Woche die Stadt des Terrors ist, die Stadt der fast hundert Menschen, die starben, als ein Lastwagen in die Menge gerast ist.
Bei Twitter lautet der Hashtag, also das Stichwort für den Terror in Nizza: #niceAttacks. Das kann man als Nizza-Anschlag lesen oder auch als netten Anschlag. Magdalena Taube (piqer) schreibt dazu:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht’s noch? Ja, ja. Nice ist die englischsprachige Variante von Nizza. Aber, was viele nun in all der Hektik lesen ist: „nett“. Das wertet die Aktion vielleicht zwingendermaßen auf. Doch es überhöht sie auf schrille Weise. Ist das nicht etwas zu viel des hochwertigen Sauerstoffs für Terror?
Tweet des Schweizers Ralph Lehner @RalphLehner
Die Verwendung des englischen Hashtags #NiceAttack ist in meinen Augen mehr als unglücklich…
Manfred Ruch antwortet:
Blickwinkel ändern
Und Ralph Lehner darauf:
Gut, ja, aus Sicht des Attentäters passts. Aber den Blickwinkel sollte keiner einnehmen…

Der Tag nach dem Brexit: Titelseite von SZ und Thüringischer Landeszeitung
So kennen wir die taz: Verspielt, ironisch bis leicht hämisch mit der Schlagzeile auf der Titelseite. Die taz? Am Tag nach dem Brexit titelte „Bye-bye, Britain“ die Süddeutsche Zeitung (Duden-affin) – um auf den folgenden Seiten zur Sache zurückzukehren. Die taz dagegen blieb für ihre Verhältnisse zurückhaltend: „Well done, little Britain“.
Ähnlich wie die Süddeutsche Zeitung spielte die Thüringische Landeszeitung (TLZ): „Bye, bye, Europa“ (nicht Duden-affin) – allerdings nicht in der Überschrift, sondern in einer Nel-Karikatur oben auf der Titelseite. Die Überschrift darunter war im Tagesschau-Stil, regional gewendet: „Brexit verunsichert die Thüringer Wirtschaft“.
Wieviel Kommentar verträgt eine Schlagzeile? Wieviel Spiel? Wieviel Ironie?
Der Boulevard braucht das Spiel, die Ironie, er will reizen, gar verletzen. Die Bildzeitung spielt nach dem Brexit mit der Sprache und schreibt in riesigen Lettern „OUTsch!“
Die taz hatte nie Probleme mit diesen Fragen. Als Weltanschauungs-Zeitung spielt und kommentiert sie in der Zeile, bis es dem Gegner weh tut – wie etwa der katholischen Kirche mit dem „Balken-Sepp“ nach dem Kruzifix-Urteil – und bis der Presserat die Rüge aus dem Sack holt.
Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und die FAZ machen es gelegentlich. Die FAZ hat sich ein neues Meinungs-Stilmittel oben auf der Titelseite einfallen lassen: Nachdem das Bilderverbot für Seite Eins gefallen war, spielt sie über der Aufmacher-Schlagzeile mit einem Bild oder einer Grafik, das kommentierend bis ironisch auf eine Geschichte im Innenteil verweist – ein grafisches Streiflicht.
Die nationalen Zeitungen, die sich „Qualitätszeitungen“ nennen, formulieren in der Regel sachliche Überschriften im Tagesschau-Stil – bis es staubt. Sie verstehen sich, wie auch die meisten Regionalzeitungen, als pädagogische Anstalt, die dem Leser ein historisches Ereignis markieren: Pass auf, so wird es auch in den Geschichtsbüchern stehen! Die Oberstudienrätin freut sich, alle anderen sind gelangweilt.
Das „Neue Handbuch des Journalismus“ postuliert es ähnlich und appelliert an den Redakteur:
- Er möge den Willen haben, politische Nachrichten mit strikt unparteiischen Überschriften zu versehen.
- Über der politischen Nachricht ist Ironie deplatziert.
Ist dieser Appell in digitalen Zeiten noch zeitgemäß, wenn jeder, auch wirklich jeder die Nachricht kennt und vieles dazu? Allerdings raten Online-Redakteure zu eher sachlichen Überschriften und nicht zu feuilletonistischem Überschwang, der den Leser und Google verstört.
Vielleicht sind grafische Lösungen zeitgemäß, wie sie skandinavische Zeitungen mögen – wie die dänische Jyllands-Posten nach dem Brexit: Nahezu die komplette Titelseite mit den EU-Sternen im Kreis; ein Stern fehlt:

Andreas Wolfers leitet die Henri-Nannen-Journalistenschule von Gruner+Jahr: Er preist die klassischen journalistischen Tugend, auch und gerade in der Internet-Ära. (Foto: Journalistenschule)
„Wird mit dem Internet alles besser? Also multimedial, crossmedial, transmedial?“ Darum geht es in der letzten, der zwanzigsten Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“. So soll der Redakteur der Zukunft arbeiten: Er soll an Facebook, WhatsApp und Snapchat denken, Communitys betreuen, Videos produzieren und Podcasts, Grafiken, Snowfalls undsoweiter. Doch – „die Technologiedebatte überlagert völlig, worum es wirklich geht“, warf Nannen-Schulleiter Andreas Wolfers ein bei einer Tagung in der politischen Akademie Tutzing. „Nur weil wir digitale Tools nutzen, ist es keine andere Art von Journalismus.“
Wolfers führt eine der großen deutschen Journalistenschule, er preist das Handwerk, die klassischen journalistischen Tugenden:
Präzise Recherche, genaue Quellenprüfung, sicherer Umgang mit Texten, Themengespür, Relevanz aufspüren: Was wähle ich aus? Was mache ich sie groß? Das ist völlig unabhängig, ob Print, Online, Bewegtbild usw. Es lässt sich alles zurückführen auf die klassischen journalistischen Tugenden.
Allerdings erweitert das Digitale die Möglichkeiten: Journalisten können tiefer und präziser recherchieren, und sie haben mehr Kanäle zur Verfügung. Bessere Recherche und größere Verbreitung: Dem Journalismus ging es noch nie so gut wie heute.
Wenn davon auch die Demokratie profitieren könnte! Sie braucht informierte Bürger, und sie braucht Bürger, die einen annähernd gleichen Informations-Stand haben. Nur wer informiert ist, kann auch mitreden und vernünftige Entscheidungen fällen – und nur wer weiß, dass auch die Bürger, die mit ihm streiten, gut informiert sind.
Die Serie schließt mit zehn Thesen zur Zukunft des Journalismus:
- Journalismus ist Freiheit: Er sichert die Qualität der Demokratie und das Selbstgespräch der Gesellschaft.
- Journalismus ist unabhängig.
- Journalismus richtet sich nach den bewährten Regeln (und braucht keine neuen für die neuen Medien): Präzise Recherche, Kontrolle der Mächtigen und über allem die Achtung vor der Wahrheit.
- Journalismus braucht Journalisten, die die Regeln kennen und achten.
- Journalismus gedeiht nur mit exzellent ausgebildeten Journalisten.
- Journalismus ist lokal und erklärt die Welt aus der Perspektive der Leser.
- Journalismus wird immer wichtiger als Gegenspieler der Unübersichtlichkeit im Netz.
- Journalismus muss experimentieren und gerade im Netz die Chancen der Technik nutzen.
- Journalismus ist angewiesen auf eine Existenz-Garantie.
- Journalismus hat eine große Zukunft vor sich.
Mehr:
http://kress.de/mail/news/detail/beitrag/135175-journalismus-der-zukunft-bilanz-und-ausblick-wir-sind-nicht-im-besitz-der-wahrheit.html
Es gibt viele überflüssige Umfragen im Netz, noch mehr dumme – nur um eine Umfrage zu haben und Klicks zu bekommen. Es gibt auch intelligente und heitere – wie diese der Berliner Morgenpost:
Wen würden Sie lieber als Nachbarn haben? Alexander Gauland, der AfD-Politiker aus Potsdam, oder Jérôme Boateng, deutscher Fußball-Nationalspieler, geboren in Wedding.
Gauland soll der FAS gesagt haben: „Die Leute finden ihn (Boateng) als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“
Wer liegt vorn? Boateng mit fast neunzig Prozent bei knapp 1500 Antworten.

Stefan Plöchinger, Chefredakteur SZ.de (Foto: SZ)
Die einen investieren in Zentralredaktionen, die Süddeutsche Zeitung investiert in Journalismus, in ein Recherche-Ressort, geleitet vom Investigativ-Papst Hans Leyendecker, sowie in Aus- und Weiterbildung von Redakteuren, die lernen, tief und tiefer zu recherchieren. SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach zu Horizont-Online:
Die SZ unterscheidet sich hier von allen anderen Zeitungen in Deutschland. Die Investition in die investigative Recherche zahlt sich für uns sowohl journalistisch als auch wirtschaftlich aus.
Konkret wird Gesamtvertriebsleiter Mario Lauer:
- Der Einzelverkauf stieg am Montag, als die „Panama Papers“ erstmals im Blatt standen, um das Doppelte an den Bahnhof-Kiosken und um 80 Prozent an den anderen Verkaufsstellen. An den ersten drei Tagen verkaufte die SZ über 30.000 Exemplare mehr als an vergleichbaren Wochentagen.
- Die Downloadzahlen stiegen um mehr als 30 Prozent gegenüber den Vorwochen, bei den Testzugängen über 50 Prozent.
- Das Interesse sank rasch: „Dies hat ganz sicherlich damit zu tun, dass sich Informationen rascher über das Netz verbreiten und zu jedem Zeitpunkt und über verschiedenste Kanäle verfügbar sind.“
Und Online?
Digitalchef Stefan Plöchinger:
Wir machen mit exklusiven Geschichten gerade auch im Netz klar, was der Wert von unabhängigem Journalismus ist und dass wir nicht zuletzt deshalb ein Bezahlmodell eingeführt haben.
Die Zahlen konkret:
- Der Gesamt-Traffic hatte am Sonntag und Montag des Erscheinens das Drei- bis Vierfache normaler Werktage erreicht, zwischen 3 und 4 Millionen Visits je Tag.
- In der ersten Woche 13 Prozent mehr Visits als in der Vorwoche, 10 Prozent mehr Nutzer und 7 Prozent mehr PI. Die Werte blieben auch in der zweiten Woche leicht höher.
- Mehr Zugriffszahlen aus dem englischsprachigen Raum. Der erfolgreichste Text insgesamt, die englische Variante des Erklärstücks „Das ist das Leak“, kam auf mehr als 2 Millionen PI. Die erfolgreichste Einzelgeschichte war mit mehr als 400.000 PI die Island-Geschichte auf Englisch.
- Aus dem Ausland kamen mit Abstand die meisten Zugriffe. Das ist ein Novum in der Geschichte von SZ.de: USA 36 Prozent, Deutschland 33 Prozent, Kanada 5 Prozent, Großbritannien 4 Prozent, China, Österreich, Australien, Schweiz und Niederlande je 2 Prozent. Die englischen Übersetzungen haben sich also zur internationalen Profilbildung bestens bezahlt gemacht.
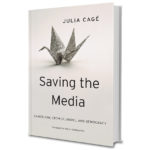
Das Buch der französischen Wirtschafts-Professorin zum Konzept der Non-Profit-Medien
Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?
Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.
Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.
Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.
Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.
Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.
Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.
Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.
Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:
-
Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.
-
Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.
Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:
-
Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)
-
und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).
In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.
Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?
Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“
Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.
Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:
-
Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?
-
Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?
-
Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?
**
Quellen:

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Foto: bpb/Ulf Dahl
In einem Interview mit kress.de spricht Thomas Krüger (56), Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, über „Dunkeldeutschland“, Journalisten und das Misstrauen der Bürger gegenüber den Medien, Medien-Manipulation und den Fehlern, die Journalisten verschweigen oder zugeben.Thomas Krüger (56) studierte Theologie in der DDR, war nach der Revolution Jugend-Senator in Berlin und ab 1994 einige Jahre Abgeordneter im Bundestag.
Gerade im Westen sagen viele: 25 Jahre Einheit müssten doch ausreichen, um die Diktatur aus den Köpfen zu vertreiben.
Thomas Krüger: Diktatur-Aufarbeitung dauert lange, das ist ein Generationen-Projekt. So etwas braucht seine Zeit. Nehmen Sie mal die Zeit des Nationalsozialismus. Sie dauerte 12 Jahre. Der zeitliche Abstand zur DDR ist heute 26 Jahre, also wären wir, was die NS-Aufarbeitung angeht, heute gerade mal im Jahr 1971 angelangt, also: vor der TV-Serie „Holocaust“, dem Gedenkstättenboom, dem kritischen Nachfragen einer neuen Generation. Die DDR dauerte 40 Jahre, also fast zwei Generationen. Warum sollte die „Aufarbeitung“ und Bewältigung schneller gehen als bei der des Nationalsozialismus?
Ist der Osten also wirklich noch Dunkeldeutschland?
Thomas Krüger: Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich sehe – wie der Bundespräsident – in ganz Deutschland und auch in Ostdeutschland eine engagierte und organisierte zivilgesellschaftliche Willkommenskultur, viele Ostdeutsche verurteilen die Fremdenfeindlichkeit und die Übergriffe aufs Schärfste. Aber gerade in den letzten Monaten, wo sich Menschen, die aus größter Not zu uns gekommen sind, gewalttätigen rechtsextremen Demonstranten aussetzen, gibt es eine Notwendigkeit, diese Schattenseiten klar und deutlich anzusprechen.
Haben Journalisten diese Schattenseiten nicht deutlich genug angesprochen. Kurzum: Haben die Medien, haben die Journalisten versagt?
Thomas Krüger: Nein, ich bin Anhänger der These, dass der Journalismus heute nicht schlechter, die Leser aber sehr viel kritischer sind. Als publizistisches Rückgrat der demokratischen Öffentlichkeit bleiben Journalisten unersetzlich und natürliche Verbündete der politischen Bildung. Beiden geht es darum, Sachverhalte zu erklären, Kontroversen aufzuzeigen und letztendlich das demokratische Bewusstsein und die aktive Mitarbeit zu stärken.
Offenbar haben auch Journalisten einiges falsch gemacht. Umfragen deuten an: Das Vertrauen ist bei vielen Bürgern erschüttert. Haben Journalisten vielleicht wie Oberlehrer aufs Volk hinabgeschaut – was die Bürger eben nicht mögen?
Thomas Krüger: Wenn Journalisten etwas falsch gemacht haben, dann höchstens zwei Dinge: Erstens, dass sie sich zu spät in die Debatten im Netz, in den sozialen Medien eingeschaltet haben. Hier haben viele Journalisten die Möglichkeiten unterschätzt, sich frühzeitig Gehör zu verschaffen. Und zweitens haben Sie ihr Licht unter den Scheffel gestellt. Guter Journalismus setzt sich schon durch, dachte man, dass dazu aber heute eine transparente Kommunikation gehört, haben viele noch nicht begriffen.
Journalisten wie der ehemalige FAZ-Redakteur Udo Ulfkotte schreiben: Medien manipulieren, lassen sich korrumpieren und von Amerika und der Nato einspannen. Stimmt unsere Politik-Berichterstattung nicht mehr?
Thomas Krüger: Natürlich kann man manches kritisieren. Wenn zum Beispiel der Eindruck entsteht, im politischen Berlin würde eine Art „Hofberichterstattung“ stattfindet, und zum Beispiel Pressekonferenzen nur dazu genutzt werden, um O-Töne einzuholen, statt Dinge kritisch zu hinterfragen – dann werden Journalisten ihrer Rolle als „vierte Gewalt“ nicht mehr gerecht. Aber es gibt sie ja noch, die investigativen und meinungsstarken Formate und Reporter und die genannten Vorwürfe von Herrn Ulfkotte sind doch sehr verschwörungstheoretisch. Da macht es auch keinen Unterschied, dass er mal für die FAZ geschrieben hat.
Wenn Redaktionen Fehler öffentlich zugeben, laufen sie Gefahr, dass andere wie beispielsweise der Ministerpräsident Seehofer sagen: Seht Ihr, jetzt geben sie schon selber zu, dass sie Fehler machen! Wäre es da nicht besser zu schweigen und die Fehler auszusitzen?
Thomas Krüger: Auf keinen Fall! Fehler müssen benannt und analysiert werden – auch öffentlich. Die Taktik, solche Dinge totzuschweigen, ist nicht mehr zeitgemäß und führt keinesfalls dazu, Vertrauen, das durch einen Fehler möglicherweise verloren gegangen ist, wieder zurückzugewinnen. Gerade in den lokalen und regionalen Tageszeitungen konnten wir aktuell feststellen, dass sich besonders die Lokalredaktionen herausgefordert sehen, sie aktiv auf ihre Leser zugehen – durch Bürgerdialog-Veranstaltungen und andere Events. Hinzu kommt eine neue Ombuds-Bewegung, die sich den Fragen und der Kritik der Leserschaft annimmt.
Teil 2 folgt.
Das komplette Interview, geführt von Paul-Josef Raue:
http://kress.de/news/detail/beitrag/134670-interview-mit-bpb-praesident-thomas-krueger-stimmt-unsere-politik-berichterstattung-nicht-mehr.html

Wie lese ich im Internet? Die Teilnehmer, im Durchschnitt 25 Jahre alt, sitzen allein in einem Raum und lesen die aktuelle Webseite einer Zeitung. Für den Blickaufzeichnung-Test setzt der Designer Norbert Küpper den Probanden eine dicke Brille auf.
Wer seinen Leser achtet, der muss wissen, wie er liest. Lange kannten Redakteure den Leser nur, wenn sie ihn getroffen haben und nicht selten dabei erschraken. Dann kamen Marktforscher und verteilten Fragebogen – mit dem Effekt, dass die meisten nicht ehrlich antworteten, sondern so, wie sie gesehen werden wollen. Heute wissen wir mehr:
- Die Blickaufzeichnung, das Eyetracking, findet heraus, wie er wirklich liest – auch wenn die Labor-Atmosphäre den Leser ein wenig hemmt ebenso wie die große Brille;
- die Neurobiologen, die Hirnforscher, schleichen sich ins menschliche Gehirn ein und entdecken Regeln, so etwas wie die Naturgesetze des Lesens.
Wir wissen viel mehr als die Journalisten vor zwanzig oder dreißig Jahren, die aus dem Bauch heraus Zeitung machten. Und Online? Die „Naturgesetze “ des Lesens gelten auch auf dem Bildschirm, von leichten Veränderungen abgesehen. Nur – wer das erklärt, der erntet bei digitalen Propheten meist ein mitleidendes Kopfschütteln.
Aber es ist so: Das menschliche Gedächtnis ist ein Wunderwerk, das sich nicht alle paar Jahre ändert und nicht aus dem Rhythmus der Evolution herausspringen kann, als wäre es ein Produkt aus dem Silicon Valley.
Die „Naturgesetze“ des Lesens erzählt die 12. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“ mit einem Lob des Kaffees und Anekdoten aus Umberto Ecos Lesesälen in mittelalterlichen Klöstern und Geschichten aus Wiener Kaffeehäusern.
**
Quelle:
http://kress.de/mail/news/detail/beitrag/134701-journalismus-der-zukunft-teil-12-wie-lesen-leser.html
Der Mensch ist nicht ein sanftes liebebedürftiges Wesen… Infolgedessen ist ihm der Nächste auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen… ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten.
Was Sigmund Freud 1930 in „Das Unbehagen in der Kultur“ schrieb, ist täglich in Internet-Foren zu beobachten. Jeder, so Freud, benimmt sich „in irgendeinem Punkte ähnlich wie der Paranoiker“ und trägt diesen Wahn in die Realität ein. Heißt dieser Wahn: Internet?

Roland Panter ist Kommunikationsvorstand des Bundesverbands der Community Manager (Foto: Bundesverband)
Wie ein aktueller Kommentar zu Freuds Unbehagen liest sich ein Interview, dass Andreas Weck vom t3n-Magazin mit Roland Panter geführt hat, Kommunikationsvorstand des Bundesverbands der Community Manager. Der Profi erzählt, wie man mit dem Hass im Netz umgeht und mit den Trollen, in die wir uns alle mal verwandeln können. Hier Auszüge aus dem Interview:
Emotionen statt Reflektion: Abschied vom kühlen Kopf
Hass breitet sich über digitale Kanäle genau so schnell und dynamisch aus wie Liebe oder der Glaube an die positive Kraft der Kommunikation. Und das sogar so sehr, dass wir zwischenzeitlich das Gefühl hatten, uns würde eine Welle des Hasses überrollen.
Hier treten vor allem Mechanismen auf, die sich in der Unvollständigkeit der Kommunikation begründen – wir können viele Dinge schlichtweg nicht richtig lesen. Ist mein Gegenüber freudig oder verärgert, macht er oder sie vielleicht gerade einen ironischen Kommentar?
Je höher die Emotionalität, desto weniger reflektiert gehen wir als Mensch manchmal vor, und lassen uns ab und an zu Äußerungen verführen, die wir mit kühlem Kopf vielleicht nie getroffen hätten.
Wer verliert den kühlen Kopf? Der Wettbewerb der Zermürbung
Das betrifft wohl uns alle, nicht nur die vermeintlich Bösen. Dazu kommt die ganz klassische Gruppendynamik mit ihrer fatalen Wirkung. Menschen fangen an, sich zu verbünden oder wollen Aussagen gezielt in eine gewisse Richtung stoßen. Das wird in so einem Fall schnell zu einem Zermürbungswettbewerb, in dem die Lager immer mal wieder den Pfad des Anstands verlassen – übrigens bis hin zu Repressalien im realen Leben. Alles schon vorgekommen.
Der internationale Siegeszug der Gerüchte
Wir konnten wir in den vergangenen Monaten beobachten, das Gerüchte auch das Zeug zur internationalen Verschwörung haben. Es ist nicht immer so einfach, den wirklichen Treiber einer gewissen Themenpolitik auf Anhieb zu erkennen – hier sei beispielhaft auch Putins sogenannte „Troll Armee“ genannt.
Wie sollen wir mit Gerüchten umgehen?
Die alte These, dass Trolle nicht gefüttert werden sollen, gilt heute nur noch bedingt. Wir haben von der Facebook-Fanpage der Bundesregierung gelernt, dass mit geschickter Gegenrede oftmals mehr erreicht werden kann. Manche Beiträge sind allerdings so krude, dass sie für sich selbst sprechen und keine weiteren Kommentare benötigen. Viel lässt sich auch mit feinem Humor erreichen.
Hass-Prediger einfach rauswerfen, ganz oder teilweise
Früher befürchtet man noch eine Welle der Empörung nach Löschungen. Heute haben Nutzer hingegen akzeptiert, dass es diese Maßnahme gibt und sie ab und zu auch ein notwendiges Werkzeug ist. Ganz oft reicht auch eine temporäre Sperre, um dem Nutzer eine Möglichkeit zum Abkühlen zu geben.
Kommentar-Spalten einfach schließen? Nein, semantische Software einsetzen
Hier sieht man häufig, dass eine Unterscheidung zwischen Fakten und Überzeugungen durch die jeweiligen Nutzer scheinbar nicht mehr möglich ist. Das bedeutet in der Folge, dass man denen mit guten Worten nicht mehr beikommen kann. Da geht es um Verschwörungstheorien, arge Beleidigungen, völlig unreflektierte Behauptungen und dies in unglaublich großer Anzahl.
Ich würde mir eher wünschen, dass diese Medien mehr Ressourcen für ein besseres Community-Management zur Verfügung stellen. Das geht aufgrund der Masse an Kommentaren aber oft schon nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Hier gibt es erste erfolgreiche Ansätze mit semantischer Software, die automatisierte Moderation ermöglicht und zumindest die ganz schlimmen Fälle aussiebt – mit erstaunlich geringer Fehlerquote übrigens. Als gutes Beispiel sei an dieser Stelle das Community-Management von „Die Welt“ genannt, die ihre Kommentare auch dadurch gut in den Griff bekommen.
**
Quelle:
http://t3n.de/news/community-management-trolle-hass-interview-699024/?utm_source=t3n-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=So+machen%27s+die+anderen!

Wolf Schneiders Lieblingsspruch hängt in der Henri-Nannen-Journalistenschule, in Stein gemeißelt: Qualität kommt von Qual.
Über Qualität können sich Journalisten stundenlang erbittert streiten. Gibt es einen eigenen Qualitäts-Journalismus? Oder ist eine Qualitätszeitung nur ein Marketing-Gag? Geht vielleicht sogar ein Riss quer durch den Journalismus: Im Olymp die Edlen, in der Provinz der Rest?
In den abschließenden Kapiteln der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“ geht es um die Qualität, genauer: um die journalistischen Grundprinzipien oder die acht Pfeiler, auf denen der Journalismus ruht. Aber verändern sich die nicht im digitalen Zeitalter?
Nein, sagt auch Google-Chef Chinnappa :
Zwar stehen uns so viele Informationen wie noch nie zur Verfügung, aber dadurch wird es umso wichtiger, an den journalistischen Grundprinzipien festzuhalten.
Nachrichten bleiben Nachrichten, ob auf Twitter oder Facebook, in der Zeitung oder Online; nur die Präsentation ändert sich – ebenso wie die Technik, Nachrichten zu verbreiten.
Am Rande geht es auch um die beliebte Ausrede, man könne ja bessere Zeitungen oder Online-Auftritte schaffen, wenn man nur bessere Redakteure hätte. Nein, sagt Rainer Wagner, Psychologe und einer der Top-Berater für Verlage und Redaktionen:
Verändere die Umstände, nicht die Menschen. Management als ein Reparaturdienst des Verhaltens von Mitarbeitern und Führungskräften ist vergebliche Mühe.
**
Quelle: http://kress.de/mail/news/detail/beitrag/134569-journalismus-der-zukunft-teil-10-was-ist-qualitaet.html










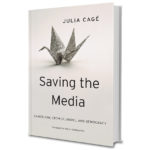






 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von