Trotz oder wegen Trump, Erdogan und AfD: Medien-Vertrauen im Allzeit-Hoch

Noch nie war das Vertrauen in die Presse laut Euro-Barometer so hoch in Deutschland wie 2017. Grafik: Uni Würzburg
Kim Otto ist Professor für Wirtschaftsjournalismus an der Universität Würzburg; er sorgt dafür, dass Journalisten wieder ruhiger schlafen können.
Noch nie seit über 15 Jahren war das Vertrauen in die Presse so hoch wie heute. Den deutschen Medien ist es gelungen, das in sie gesetzte Vertrauen zu stärken und weiter auszubauen.
Der Bayerische Rundfunk berichtet über die neue Studie des Würzburger Professors, der regelmäßig, zusammen mit Andreas Köhler, Daten des Eurobarometers auswertet; in Deutschland befragt Infratest im Auftrag der Europäischen Kommission 1.500 Bürger im Alter ab 15. Unter Presse werden Zeitungen, Magazine, TV und Radio subsumiert.
Was fiel den Wissenschaftlern besonders auf:
- Auch bei den jungen Leuten von 25 bis 34 stieg das Vertrauen um zehn Prozentpunkte – auf fünfzig Prozent. Zum Vergleich: Bei den Ältesten über 75 vertraut zwei Drittel der Presse.
- Das Vertrauen stieg besonders stark – um 18 Prozentpunkte – im rechten Spektrum: Die Hälfte der Bürger die sich selbst rechts einordnen, vertrauen den Zeitungen, aber auch zunehmend Radio und TV.
Offenbar gelang es den Medien zuletzt immer besser, dem von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen vertretenen Eindruck entgegen zu treten, ihre Berichterstattung sei politisch gefärbt und von oben gesteuert. Die Diskussionen über Fake-News und die Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei haben sicherlich auch einen Anteil daran, dass die Menschen in Deutschland Presse und Rundfunk stärker wertschätzen,
sagt Medienprofessor Kim Otto. Skeptischer schätzen andere, meist ältere Studien das Medien-Vertrauen ein. Es bringt allerdings wenig, wenn in Umfragen allgemein nach Medien gefragt wird. Jeder Bürger stellt sich etwas anderes vor, wenn er nach „den Medien“ gefragt wird. Erkunden sich Interviewer differenzierter, schneiden Zeitungen deutlich besser ab als die sozialen Netzwerke oder der Boulevard.
Gibt es auch einen Unterschied zwischen einer Lokalzeitung und einer nationalen Zeitung? Zwischen dem Spiegel und dem Südkurier in Konstanz? Die „Forschungsgruppe Wahlen“ fragte im Herbst vergangenen Jahres genauer und wollte endlich einmal erfahren: Wie beurteilen Bürger ihre Lokal- und Regionalzeitungen?
Erstaunlich ist das Ergebnis nicht, aber das Gefühl erreicht endlich einen festen Boden: Regionale Tageszeitungen liegen vorn. Auf einer Thermometer-Skala – von plus 5 für exzellent bis minus 5 für katastrophal – liegen die Regionalzeitungen bei 2,4; es folgen die nationalen Zeitungen (2,2), Magazine wie der Spiegel (2,1) und das Fernsehen (1,9). Die sozialen Netzwerke liegen im Frostbereich der Skala bei minus 1,5.
Offenbar bleiben die Bürger auch den Nachrichtenquellen treu, die sie kennen – selbst wenn digitale Angebote sich rasant vermehren; das belegt eine große schwedische Studie, die das Medienverhalten der Menschen über dreißig Jahren verfolgt. Der Kreis schließt sich: Ich vertraue dem Medium, das ich häufig nutze; und ich nutze das Medium, dem ich vertraue. So wird das Vertrauen zum Markenzeichen, das Manager und Journalisten hegen und pflegen müssen.
Überraschend ist das Ergebnis bei den digitalen Ureinwohner: Sie bewerten die Zeitungen, die regionalen wie die nationalen, noch besser als die analoge Generation (2,5); auch die sozialen Netzwerke schneiden bei den jungen Leuten mit minus 1,5 so schlecht ab wie bei den Älteren. Zu den 16-29-Jährigen schreibt die „Forschungsgruppe Wahlen“:
Sie haben ein relativ großes Vertrauen in die Qualitätsmedien und eine größere Skepsis gegenüber den Boulevardmedien und auch gegenüber den sozialen Medien.
Es gibt meines Wissens keine wissenschaftliche Studie, die einen positiven Einfluss von sozialen Medien, inklusive Youtube, feststellt, wenn es um Vertrauen und politische Meinungsbildung geht.
Die Allensbacher Befragung zur Glaubwürdigkeit der Medien, von den Zeitschriftenverlegern in Auftrag gegeben, zeigt ebenfalls: Sieben von zehn Bürgern vertrauen Zeitungen und Zeitschriften, gerade mal einer vertraut Facebook und Twitter. Das Netz ist in Ungnade gefallen, wenn es um Genauigkeit und Fairness der politischen Debatten geht.
Aber viele Leser wollen erfahren, was andere denken. Dabei stört sie nicht der falsche Ton: Sie können einerseits einschätzen, dass unerfahrene Kommentatoren nicht so geschliffen schreiben wie Profis in den Redaktionen; sie unterscheiden andererseits deutlich eine Nachricht, die vertrauenswürdig sein muss, von einer Meinung, die durchaus kontrovers und aggressiv sein darf. So ist auch der Erfolg von Leser-Seiten in Zeitungen zu erklären, die dem Vorbild der Speakers Corner folgen und Querdenker zu Wort kommen lassen, oft bis an die Grenze des Erlaubten und über die Grenze des Erwünschten hinaus.
Bei den Leser-Kommentaren wünscht sich laut Allensbach-Umfrage nur eine Minderheit die politische Korrektheit, die für eine Mehrheit der Redakteure wichtig ist. Die Kommentar-Rubriken sind ein Schauspiel, das man sich gerne anschaut – ohne die Lust zu verspüren, selber auf die Bühne zu gehen und mitzuspielen. Drei Viertel der Bürger will die eigene Meinung nicht aufschreiben, gerade mal jeder Zehnte hat mehrmals auf einen Artikel im Netz reagiert.
Wahrscheinlich reicht es den meisten, wenn sie im Netz und in Zeitungen die eigene Meinung lesen, wie sie ein anderer formuliert; findet man aber seine Meinung nicht oder nur selten wieder, entsteht der Eindruck der Manipulation oder im schlimmsten Fall der Ausgrenzung: Man darf in diesem Land ja nicht mehr seine Meinung sagen!
**
Mehr in meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS: – https://kress.de/news/detail/beitrag/137356-vertrauen-die-buerger-noch-den-journalisten-studien-beweisen-ja.html
Wie Leser auf das Ende der Online-Kommentare reagieren: Das Beispiel NZZ

So illustriert die NZZ auf ihrer Webseite die Einführung des neuen Leserforums. NZZ-Foto: Dominic Steinmann
„Der erste Tag ohne Kommentarspalten: Völlig langweilig, uninteressant. Es fehlt Pfeffer und Paprika. Nur weiter so, NZZ. Dann wird es mit Sicherheit bald Schluss sein. Warum sollte ich noch 800.– Franken für das Jahresabonnement bezahlen??“
So kommentiert ein Leser der Neue Zürcher Zeitung (NZZ) den „Umbau“ der Online-Lesermeinungen vor einem Monat. Dem Vorbild von FAZ und Süddeutscher Zeitung folgend ermöglichen die Schweizer keine Kommentare mehr direkt zu einem Artikel. Als Ersatz bietet die Redaktion monatlich fünfzig Themen an, die kommentiert werden können wie aktuell:
- Werden Journalisten zu hart angegangen?
- Oscar-Verleihung: Relevante Weltbühne oder feiert sich die Branche nur selbst?
- Alles normal in der Bundesliga – oder ein Zweiklassenwettbewerb?
Wie reagierten die Leser darauf? Sie schrieben rund tausend Kommentare, hier eine Auswahl:
- Die Redaktion ist zu empfindlich und politisch zu korrekt
Eine bedauerliche Entscheidung der NZZ-Verantwortlichen. Wer bloggt, muss etwas aushalten können, nicht wegen jedem Angriff aus den Socken kippen. Das gilt ja auch für Politiker. Nun ist also ein geschätztes Ventil zu. Die NZZ hätte es ja wie beim Tagi machen können: Unanständige Beiträge einfach nicht publizieren, aber ohne Meinungszensur.
Oliver Fuchs, Jahrgang 1990, Teamleiter Socialmedia der NZZ, begründet den Wegfall der direkten Kommentierung unter anderem mit einem „zufällig herausgegriffenen“ Kommentar auf NZZ.ch; es handelt sich um die Reaktion auf einen Artikel über Transsexualität.
Dies ist der Leserkommentar:
Transsexualität ist die Abart des modernen Menschen, seinen Körper über die natürlichen Grenzen hinweg zu schikanieren. Es gibt keine Frau, die im Körper eines Mannes geboren wurde (oder vice versa). Das ist kompletter Humbug. Es gibt körperlich bzw. hormonell beeinträchtigte Männer und Frauen. C’est tout!» Was ist der Wert dieses Kommentars? Ist er wirklich ein wertvoller Diskussionsbeitrag – und noch wichtiger: Signalisiert der Absender mit seinen Worten nicht deutlich, dass er einen Austausch gar nicht will? Kommentare wie dieser erreichen uns unterdessen jeden Tag.
Eine Leserin reagierte darauf:
Nehmen wir doch den „zufällig herausgegriffenen Kommentar“ über Transsexualität etwas näher unter die Lupe. Was findet die NZZ-Redation daran störend?
Erster Grund: Unhöflicher Schreibstil, insbesondere der Satz „Das ist kompletter Humbug“. Zugegeben, kein besonders respektvoller Ausdruck, aber immerhin sachbezogen und nicht personenbezogen. Müsste man noch verkraften können.
Zweiter Grund: Der Kommentator ist zu sehr von der Richtigkeit seiner eigenen Meinung überzeugt („Signalisiert der Absender mit seinen Worten nicht deutlich, dass er einen Austausch gar nicht will?“). Mit Verlaub: Ist sich die NZZ-Redaktion nicht im gleichen Masse der gegenteiligen Meinung gewiss? Ist es überhaupt ein Vergehen, an die Richtigkeit der eigenen Meinung zu glauben?
Es scheint viel wahrscheinlicher, dass die obigen Gründe eine willkommene Ausrede sind, um den wahren Grund zu vertuschen: Der Absender hat ganz einfach eine „falsche“ Meinung zum Ausdruck gebracht. Ja, in der „liberalen“ Weltanschauung, in welcher die NZZ wortführend ist, ist Political Correctness König, da gibt es die „richtigen“ und da gibt es die „falschen“ Ansichten. Die Worte der NZZ-Redaktion benützend, ist unverweigerlich deutlich zu signalisieren, dass man einen Austausch mit der „falschen“ Meinung gar nicht will. Daher braucht es niemanden zu wundern, dass man künftig nicht mehr alle Artikel kommentieren kann.
Der Schritt der NZZ-Redaktion mag als gutes Beispiel eines schlechten Liberalismus gelten.
Ein anderer Leser dazu:
Gut auf den Punkt gebracht. Es handelt sich m.E. bei diesem NZZ -Umbau der Kommentarspalte nicht nur um einen falschen Liberalismus, sondern um einen „pädagogisierenden Liberalismus“.
- Selbstherrliche Schreiberlinge (zu der Begründung des NZZ für den Umbau: Die Redakteure lesen die Online-Kommentare nicht mehr)
„Viele Journalisten lesen die Kommentarspalte nicht mehr“ – welche Diskrepanz zur gelebten Kommentarkultur der interessierten Leserinnen und Leser. Natürlich – nicht jeder Schreiber ist ein Gelehrter oder hat einen Hochschulabschluss. Es gibt auch einfach Leute, welche ihre Meinung mitteilen möchten. Die NZZ sollte froh sein, dass ihre Kommentarfunktion rege genutzt wird.
Tja, nun wird hier wohl bald Ruhe einkehren
**
Für ziemlich arrogant halte ich die Aussage, dass die NZZ-Redakteure diese Foren nicht mehr lesen. Sind sie zu selbstherrlichen Schreiberlingen mutiert? Wer nicht meiner Meinung ist, den beachte ich nicht?
- Was sind Leserkommentare? Speakers Corner oder gepflegte Konversation?
Die Katze (Umbau) ist aus dem Sack. So weit, so gut. Klar zeigt sich dabei, dass die Kommentarspalte VOR UMBAU nicht mit der Kommentarspalte NACH UMBAU vergleichbar ist.
Im Vergleich war Ersteres ein „Speakers corner“. Wo, frei ab der Leber, spontan der „offene Rede“ gehuldigt wurde. Ohne den Dissens zu scheuen. Zweiteres soll offenbar den gesitteten Meinungsaustausch, zu ausgewählten Themenbereiche, pflegen.
Bei Ersterem hatte des „Speakers opinion“ (die freie Rede!) oberste Priorität. Bei Zweiterem der gepflegte Meinungsaustausch (Konversation), auf der Suche nach Vertiefung und Konsens. Beide Kommunikationsformen haben ihre Berechtigung. Sind aber nicht gegeneinander austauschbar.
Da das Recht der freien Meinungsäusserung über allem steht, und die liberale NZZ sich seit ihren Anfängen diesem Recht verschrieben hat, wäre es doch eine Überlegung wert, ob nicht beiden Arten der Kommunikation (spontan / gepflegt) Raum gegeben werden sollte. Wer sich dabei vor den Gefahren der spontanen, offenen Rede (Fake-News, Populismus, rhetorische Flegeleien usw), trotz Netiquette-Filter, schützen will, hat so Option (jetzt nach Umbau) der „gepflegten Konversation“ hinzugeben. Alle anderen finden sich im Raum der „spontanen, offenen Rede“.
So könnte die NZZ die ganze Breite der Marktbedürfnisse abdecken. Denn immerhin handelt es sich bei (fast) allen um NZZ-Abonnenten / Leser. Zu denen doch Sorge zu
tragen ist. Zumindest hoffentlich.
Ein anderer Leser dazu:
Die beiden Forums-Arten, die Sie als „Speakers Corner“ und als „gesitteten Meinungsaustausch“ bezeichnen, möchte ich lieber als „Hochhalten von Plakaten“ und als „Gespräch“ bezeichnen. Das Hochhalten von Plakaten mag einigen Spaß machen, vor allem wenn sie damit die Gegenseite ärgern können.
Was es aber wirklich braucht, ist das Gespräch. Wie könnten wir uns ohne Gespräch auf Lösungen, die für alle akzeptierbar sind, einigen? Darum ist es verdienstvoll, wenn die NZZ die Gesprächskultur fördern will. Wenn sie das Hochhalten von Plakaten eindämmt, ist das keine Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Im Gespräch machen wir ebenso Gebrauch vom Recht auf freie Meinungsäußerung wie beim Hochhalten von Plakaten.
Wenn man vom Hochhalten der Plakate nicht zum Gespräch übergehen kann, wird man sich am Schluss die Plakate um die Ohren hauen oder noch härtere Gewalt ausüben.
Zudem scheint mir das Feld der Meinungsbildung eine zu ernste Sache, als dass man hier von einem „Markt“ sprechen dürfte. Wenn die NZZ es riskiert, um der Gesprächskultur willen zahlende Kunden zu verlieren, ist auch das verdienstvoll. Ich glaube allerdings, dass die neue Debattenform vielen Lesern bald mehr Spass macht als die früheren Pöbeleien. Das könnte sich für die NZZ auch finanziell positiv auswirken.
- Endlich keine Gerüchte mehr
Nun auf manche Dinge (oder Intrigen), wie z.B., dass H. Clinton an Parkinson leide (und Pizzagate und konkrete Schüsse aufgrund von Lügen- und Intrigendingen) oder Barack Obama nicht direkt auf US-Boden geboren wurde, könnte ich auch verzichten.
- Das Ende der freien Meinung
Ein Leser schreibt direkt an den NZZ-Redakteur:
Lieber Herr Fuchs
Auch wenn der Entscheid teilweise nachvollziehbar sein mag. Gerade die NZZ als liberales Medium sollte für die freie Meinungsäußerung einstehen. Diese wird nun ohne Not eingeschränkt.
Viel besser hätten Sie klarere Regeln aufgestellt, um so alle „unanständigen“ Meldungen zu löschen. Die ganze „Fake News Abteilung“ wurde bisher sowieso immer von den in grosser Mehrzahl vorhandenen, vernünftigen Kommentatoren zerzaust.
Jedenfalls glaube ich, dass Sie resp. das Entscheidungsgremium sich hier übernommen hat. Ein bedauerlicher Entscheid, der dem Anspruch ein liberales Medium zu sein, nicht gerecht wird.
**
Andere Leser:
Das ist ein bedenklicher Schritt. Offenbar verträgt sich das Konzept des Leserkommentars schlecht mit dem Konzept des Leitmediums. Wir kehren zurück zu einem geozentrischen Weltbild (um nicht zu sagen: egozentrischen Weltbild), oder anders ausgedrückt: Die NZZ ist wieder eine Scheibe.
**
Wo die Meinungen anderer mit dem eigenen Bild der Welt kollidieren, sind sie plötzlich nicht mehr gefragt. Drehen wir die Uhr der medialen Welt zurück und stellen die eingefärbten Nachrichten wieder unkommentiert und damit unkritisiert ins Netz.
Natürlich ist der Ton hinter der angenehmen Anonymität rauer. Natürlich gibt es immer ‚Trolle‘. Aber ein Mensch, der nichts zu befürchten hat, spricht am freiesten, oder?
Dies ist hier anscheinend nicht gewollt.**
Schade. Wenn man die Kommentare in Relation zum Artikel liest, weiss man oft erst, wie die Bevölkerung wirklich darüber denkt (im Gegensatz zum Autor). Dieser Realitätsabgleich fehlt dann eben, und es wird einseitig. Man kann das dann eben kritiklos lesen, oder Alternativen suchen.
Dazu ein anderer Leser:
Es ist ein Fehler anzunehmen, die Äusserungen in den Kommentarspalten würden „die Bevölkerung“ widerspiegeln.
- NZZ ist zu nachsichtig gegen Pöbler
Die NZZ hat die Chance verpasst, pöbelnde Kommentarschreiber auszuschließen oder deren Kommentare zu entfernen. Ein kleines Beispiel: Wie oft wurde mir unterstellt, ich sei ein Putin-Troll, bloß weil ich mich seit der Ukraine-Krise dagegen stemmte, dass Russland als neues Feindbild aufgebaut wird. Diese gegen die Person gerichteten Argumente wurden immer dreister.
Als das mit dem Putin-Troll nicht mehr reichte, wurde meine Religionszugehörigkeit als Waffe gegen meine Kommentare verwendet. Nichts passierte, kein Verweis gegen diese pöbelnden Kommentarschreiber seitens NZZ. Dies hinterließ natürlich den schalen Beigeschmack, dass die NZZ nicht unparteiisch agierte, da es um Artikel ging, die mehrheitlich gegen Russland gerichtet waren.
**
Ich bin da bei Ihnen. Letztlich gäbe es andere Mittel, um Pöbler auszubremsen. Meiner Meinung nach waren es die immer gleichen Kommentatoren, die grundsätzlich jede Meldung im Forum dann verhetzt haben mit ‚Lügenpresse‘-Vorwürfen oder völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Vergleichen – oder Wutreden. Beispiel Merkel: egal worüber bezüglich der deutschen Politik berichtet wird, in kürzester Zeit ist jedes offene Forum überschwemmt mit Kommentaren wie ‚Deutschland war früher super, heute ist alles Mist wegen Merkel‘.
Auf die eigentliche Meldung oder Fakten wird nicht eingegangen, eine Diskussion ist so einfach nicht möglich! Anstatt solche Pöbler, die letztlich gar nicht diskutieren wollen, die offensichtlich nur ‚brüllen‘ wollen, anstatt diese gezielt anzuzählen und notfalls eben zu sperren, sind wir nun alle betroffen. Ich finde den Weg des SRF da viel besser: Klarname muss genannt werden und Telefonnummer, das würde viele der unseriösen Trolle abschrecken – und dem Rest bliebe die Debatte erhalten….
**
Ich bleibe dabei: da trollen ganz wenige sehr lautstark und überfluten Foren, wollen eine Mehrheit vorgaukeln, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Es ist sehr schade, und ich hoffe auf bessere Lösungen wie diese nun, aber verstehen tue ich diesen Schritt der NZZ in jedem Fall.
- Oberlehrerhaft
Der „NACH UMBAU“, der erinnert an ein Klassenzimmer mit einem Pädagogen. Der das Thema bestimmt und die SchülerInnen dürfen dazu Stellung nehmen. Wenn die Meinung dem Lehrer nicht passt, kommt seine Korrektur. Mit Zeit werden alle wissen, wie die Meinung geäußert werden soll, damit es keinen Tadel gibt.
- Lob für die NZZ: Gut für die Demokratie
Ah tut das gut, nicht mehr all diese Hasskommentare lesen zu müssen. Danke NZZ!
**
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber sehr oft handelt es sich in solchen Kommentaren nicht um Meinungen, sondern um falsche Tatsachenbehauptungen. Dass jemand z. B. „meint“, die Erde sei eine Scheibe, ist nicht mitteilenswert und deshalb auch nicht publikationswürdig. Danke für die kluge Entscheidung!
**
Ich denke, der Schritt macht Sinn. Es ist tatsächlich müßig immer wieder denselben Verlauf von Diskussionen zu verfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass später ein schrittweiser Ausbau stattfindet zu wieder mehr Themen, die kommentiert werden können.
Wesentlich wichtiger fände ich aber den Zugang zur Kommentarfunktion von Klarnamen abhängig zu machen. Wer eine persönliche Meinung hat, der kann in der Schweiz auch dazu in seinem Namen stehen. Wir haben Meinungs- wie Pressefreiheit. Wer zu seiner Meinung nicht stehen kann und auf Fantasienamen ausweicht, dem sollte im NZZ Forum keine Plattform geboten werden. Alleine damit wären viele Trolle und Diskussionszersetzer Geschichte.
**
Die Demokratie lebt vom Niveau der Auseinandersetzungen. Je höher das Diskussionsniveau, desto besser für die Demokratie. Die neuen Regeln heben das Diskussionsniveau unter den Leserkommentatoren der NZZ. Darum ist der Umbau ein guter Weg für die Demokratie.
- Zu teuer für die NZZ
Warum soll man immer diskutieren müssen, statt einfach nur die eigene Meinung mitteilen zu können? Solange dies einigermaßen manierlich passiert, ist doch dagegen nichts einzuwenden! Wer die Meinung teilt, kann den Beitrag liken, andere können ihre abweichende Ansicht publizieren. Ich glaube, der NZZ sind einfach die Kosten für eine seriöse Triage der eingehenden Kommentare zu hoch geworden.
- Noch eine Echokammer
Die Entscheidung ist teilweise nachvollziehbar. Die Grenzen des guten Geschmacks wurden zuletzt gerade von politisch eindeutig voreingenommenen Kommentatoren regelmässig überschritten und Andersdenkende mit unflätigen Kampfbegriffen eingedeckt.
Vielen Dank an alle, denen es in den letzten Jahren an dieser Stelle nicht um Stimmungsmache, sondern um den Austausch von Argumenten gegangen ist.
Eins der besseren Foren verschwindet also. Das nachfolgende Konzept wird zu Recht mit einiger Skepsis betrachtet. Wohin geht die Reise?
Bereichernder Dialog oder nur eine weitere Echokammer? Alles Gute Ihnen allen.
- Selbstüberschätzung der Leser: Das Volk ist nicht Gott
Aus vielen Leserkommentaren zu diesem Artikel spricht eine maßlose Selbstüberschätzung. Viele glauben, für „das Volk“ zu sprechen und einer setzt „das Volk“ gar mit Gott gleich.
Es ist wichtig, als Leser die eigenen Grenzen zu erkennen. Die Journalisten haben ein einschlägiges Hochschulstudium absolviert. Die NZZ-Korrespondenten haben vor Ort Kontakt zu den verschiedenen Akteuren. Sie besuchen die Schauplätze des Geschehens. Sie studieren die aktuelle wissenschaftliche Fachliteratur. Sie können viel Zeit für die Beobachtung ihres Berichtsgebiets einsetzen. Im Gegensatz dazu scheinen viele Leserkommentatoren einfach am Feierabend im Internet nach Belegen für ihre vorgefassten Meinungen zu suchen. Die Qualität solcher Quellen können sie aber kaum beurteilen.
Kritisch zu sein ist immer gut, aber man sollte vor allem auch selbstkritisch sein.
- Besser als Leserbriefe
Weil ich die Leserbriefe in der Zeitung täglich prioritär anschaue, kann ich bei kontroversen Themen feststellen, dass es nur Leserbriefe schaffen, die meist nahe an der Meinung des Blattes orientiert sind, bzw. sich nur sehr gemäßigt kritisch äußern.
Dagegen habe ich, besonders hier in der NZZ, zahlreiche interessante Aspekte aus den sachlichen Diskussionen mitnehmen können, die in den redaktionellen Beiträgen keine oder nur randliche Erwähnung fanden, m.E. aber kritisch und problemrelevant waren.
Dazu ein anderer Leser:
Ihre Sorge kann ich nicht teilen. Ich bin seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Zeitungsleser und mein erster Blick galt den Leserbriefspalten. Dort standen oftmals zusätzliche Informationen, formuliert in höflicher Sprache und abgewogen in der Argumentation. Von Sterilität keine Spur. Diese Kultur ist durch Trolle und Hate-Speech fast völlig vernichtet worden. Der Hass und die Verachtung, die sich stattdessen breit machten, taten mir psychisch weh. Halten Sie das für erstrebenswert? Ich bin für höflichen Umgang; auf Pseudo-„Ärgernisse“ kann ich verzichten.
- Ein Leser-Rat
Liebe NZZ, ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es mit der Bildung eines ständig wechselnden und per Los bestimmten Gremiums von Kunden/Lesern, die an diesem Kommentarforum mitwirken? Das wäre im Sinne dieses Artikels (http://www.zeit.de/2017/04/rec… ), den ich absolut genial finde, doch mal eine basisdemokratische Beteiligung, an der wohl kaum jemand etwas Kritikwürdiges finden könnte. Natürlich sollten nur identifizierte Personen an dem Losverfahren teilnehmen können
Zum Ende: Orwell
Die Begründung „wir bauen nicht ab, sondern um“ ist Neusprech. Orwell lässt grüssen.
NZZ-Redakteur Fuchs antwortet:
Danke für Ihren Kommentar. Sie vergleichen meine Worte mit denen einer absoluten Diktatur. Ein gelungenes Beispiel für das, was wir nicht sonderlich konstruktiv finden.
**
Dazu auch meine Kress-Kolumne JOURNALISMUS!
Die Online-Sonntagszeitung der HNA: Nur Qualität wird den Journalismus retten
Guter Journalismus wird notwendig sein, um die Leser, gerade die jungen, anzuziehen. So denken Horst Seidenfaden und Jens Nähler von der HNA in Kassel, sie denken ihre Sonntagszeitung für Online-Leser, aber sie denken sie aus der Zeitung heraus – und starten Anfang Dezember Sieben, eine lokale Sonntagszeitung im Internet.
Qualität zählt, nicht Quantität wie in den billig gemachten 24er-Blaulicht-Portalen, in denen Leser die aktuellen Leichen zählen können: In der Tat werden diese Portale geklickt wie der Teufel, aber sie bringen nur Reichweite und keinen Gewinn – erst recht keinen Gewinn für den Journalismus. Sieben ist der journalistische Gegenentwurf, „Premium first“ nennt ihn Horst Seidenfaden.
Anfang Dezember wird Sieben das erste Mal erscheinen, ein Weihnachtsgeschenk für junge Nicht-Leser, die auf ihrem Tablet die Faszination des Lokaljournalismus erleben sollen. Was ist neu an dieser Zeitung im Netz?
- Sieben hat ein eigenes Design, das sich nicht an das HNA-Layout anlehnt.
- Die Ressorts sind nicht die Ressorts der Zeitung, das Menü ist übersichtlich: Heimat / Welten mit Politik und Kultur / Leben mit Garten, Wohnen, Reisen / Klartext mit exklusiver Meinung von starken Kommentatoren.
- Blogger aus der Region liefern Ratgeber-Themen wie Ernährung, Mode oder Fitness.
- Keine aktuelle Nachrichten, auch keine Sportergebnisse vom Wochenende; die finden die HNA-Leser weiter auf hna.de und Kassel-Live.
- Es gibt kein E-Paper; es ist zu teuer in der Produktion, zudem sind keine Verlinkungen oder Einbindungen von Videos möglich.
- Sieben ist strikt lokal: „Aus den Lokalausgaben fischen wir während der Produktionswoche die Themen heraus, die dann erst später im Blatt erscheinen“, erläutert Horst Seidenfaden, der die Idee hatte. Online-Chef Jens Nähler setzt das Konzept um: „Wir füttern die Artikel an, etwa mit Videos und Bildergalerien.“
Das sind mögliche Themen von Sieben, zu finden in der Nullnummer:
Porträts eines Discjockeys „Die Magie des Plattentellers“ und eines Extremläufers aus Baunatal oder eines Tätowierers aus Treysa; Recherchen wie „Was Verbraucher zu Bio lockt“; eine Bildergeschichte mit Fotos eines Paars aus Kaufungen, das durch Kanadas Natur gezogen war; eine Nachmach-Geschichte „So entsteht ein Schlüsseltäschchen in fünf Schritten“, aufgehängt an einer Patchwork-Gruppe.
Es gibt keine eigene Sieben-Redaktion, die Produktion bewältigt zunächst Jens Nählers kleine Online-Redaktion. Den Inhalt besorgen zum großen Teil die Lokalredaktionen. „Für die Redakteure bedeutet das keine Zusatzarbeit“, sagt Chefredakteur Seidenfaden, „sondern nur eine Verzögerung: Sie dürfen die Themen zeitversetzt, also in den Wochen nach der Sieben-Ausgabe, im Lokalteil mitnehmen.“
Sieben wird bis Ostern Sieben kostenlos sein – verbunden mit dem Hinweis, dass es ab April denen 4,90 Euro kosten wird, die es ausschließlich abonnieren wollen; für HNA-Abonnenten ist es inklusive. Auf die gut 130.000 Zeitungs-Abonnenten schielen die Chefredakteure nicht. Sie dürfte Sieben nicht übermäßig beeindrucken: Sie reagierten in einem „User-Test“ zurückhaltend, die siebte Ausgabe dürfte ihre Bindung an die Zeitung kaum stärken.
Je weniger die Testleser regelmäßig Zeitung lesen, je weniger sie an das Zeitungs-Layout gewöhnt sind, desto begeisterter waren sie. So werden die „Digital-Only“ zur lukrativen Zielgruppe, die sich durchaus für ein Abo, ähnlich wie bei Spotify oder Netflix, erwärmen können.
Mehr in der Kress-Kolumne JOURNALISMUS! – https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/136489-ein-kleiner-schluessel-zum-paid-content-hna-bringt-im-netz-ein-sonntags-lokalmagazin.html
Wie destruktiv ist die professionelle Medienkritik?
„Die professionelle Medienkritik gefällt sich bislang eher in der Rolle des destruktiven Beobachters – produktive Impulse sind Mangelware“, schreibt der Politikwissenschaftler Christoph Bieber (46), Mitglied des WDR-Rundfunkrats. Das ist allerdings nur ein Nebenaspekt im Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung, in dem Biber auf das neue Internet-Format „Funk“ eingeht – das öffentlich-rechtliche TV für junge Leute; er fragt, ob die Kontrolle noch so funktionieren solle wie beim klassischen TV und antwortet: Nein, dafür sind die Gremien kaum geeignet.
Der Essener Professor verweist auf die BBC, die Zuschauerräte (Audience councils) punktuell und themenbezogen mit den Verantwortlichen diskutieren lässt, und auf „Start-up-Labore“ der BBC; er erwähnt auch die Workshops, mit denen der NDR experimentiert.
**
Quelle: SZ 14. November 2016
Was muss ein Relaunch leisten? Das Beispiel der Südwest-Presse
Die Südwest-Presse in Ulm mit gut 300.000 Auflage hat im Oktober ihr Aussehen wie auch ihre Struktur verändert, radikal sogar. Ein Jahrzehnt oder länger blieb die Zeitung ihrer Gestaltung treu, schwäbisch gelassen, man könnte sogar von einer gewissen Betulichkeit sprechen. Die Zeitung war wie ihre Leser.
Doch Vorsicht! Leser ändern sich, die Gesellschaft ändert sich – und Redaktionen sind klug, wenn sie nicht von ihrer eigenen Abneigung gegen Veränderungen ausgehen und daraus schließen: Die Leute schätzen nur das Bewährte, schätzen die Zeitung als ruhenden Pol in einer unruhigen Welt.
Doch die Leser ändern sich, auch in Schwaben: Sie brauchen die Zeitung nicht mehr, um Nachrichten zu lesen. Das Rennen um die Aktualität haben die Zeitungen zudem schon lange vor dem Internet verloren. Über die Bürger zieht ein unendliches Nachrichten-Gewitter hinweg: Sie lesen und hören unentwegt, was passiert ist, aber sie verstehen nicht, warum es passiert. Darauf reagiert die Südwest Presse und bringt auf jeder Seite meist einen großen Artikel, der die Oberfläche der Nachrichten verlässt und in die Tiefe taucht. Fast völlig verschwunden sind die Artikel mit 20 oder 30 Zeilen, die zu lang sind für eine Nachricht und zu kurz für eine Analyse.
„Wir müssen mehr Mut haben, eigene Schwerpunkte zu entwickeln. Der Leser honoriert das!“, sagt Chefredakteur Ulrich Becker. „Ich höre nach dem Relaunch von den Lesern: Ich erfahre mehr als früher – oder: Das habe ich so nirgendwo anders gelesen.“
Die Zeitung ähnelt plötzlich einer Wochenzeitung, die täglich erscheint; die Zeitung beweist, dass Redakteure die Welt erklären können, die große und die lokale. Die moderne Zeitung ist mehr als eine Nachrichten-Sammlung, sie wird journalistisch in dem Sinne, dass sie stärker recherchiert und den Platz schafft, um Recherchen auch zu präsentieren, opulent und ausführlich.
Ein Nachteil der reformbedürftigen Südwest Presse war die einzeilige Überschrift: Sie war kurz, fasste meist nur drei, vier Wörter, sie verführte den Redakteur zum Griff in die Textbaustein-Sammlung wie „Streit um…“ oder ähnlichem mehr. Der Leser ärgerte sich, er konnte nicht erkennen, was ihn im Artikel erwartet; der Redakteur hätte sich auch ärgern müssen, denn der Leser, den die Überschrift nicht verführt, liest seinen Artikel nicht.
Die Gestaltung muss aber der Funktion folgen – wie im Relaunch: Die große, tiefschwarze Überschrift geht oft über zwei Zeilen, sie bietet genügend Raum für eine Inhaltsangabe, falls sich der Redakteur nicht in feuilletonistische Spielereien verlieren will. Die Überschrift nebst Unterzeile, die ausführlich ist wie ein Vorspann, hat ihre Funktion wieder erlangt: Den Leser zu informieren und zum Lesen zu verführen – oder zum Weiterblättern. Auf jeden Fall ärgert sich der Leser nicht mehr, wenn er erst im zweiten Absatz erfährt, dass ihn das Thema nicht interessiert.
Gerade im Lokalen haben kurze Meldungen, Service und Vereinsnachrichten noch einen hohen Wert für viele Leser. Das „Community-Building“ ist kein Online-Privileg, es ist genau so wichtig in der Lokalzeitung. Diese Nachrichten stehen am Fuß der Seite, blattbreit und rubriziert.
Norbert Küpper kritisiert die Meldungen am Fuß:
„Unten auf der Seite wird nichts Wichtiges mehr erwartet. Da sollte man eher eine größere mehrspaltige Überschrift als Blickfang platzieren. Es ist ja für die Redaktion auch ziemlich stupide, jeden Tag alle Meldungen auf die gleiche Höhe zu schreiben.“
Küpper verweist auf skandinavischen Zeitungen, die stilbildend in Europa sind: „Das ist man lockerer und würde die Meldungen unterschiedlich lang laufen lassen. Man nennt es auch Wäscheleinen-Umbruch. Oben stehen die Meldungen auf einer Linie, unten laufen sie unterschiedlich lang aus.“
Offenbar verwirrte die Meldungsleiste am Fuß der Seiten auch einige Leser, berichtet Ulrich Becker, der Chefredakteur: „Nach vier Wochen dreht sich das, es kommen überwiegend positive Rückmeldungen. Schnell, überraschend, mit spielerischen Elementen, das sagen nun die Leser.“
So reagieren Redaktionen in einem Relaunch am besten auf die Krise:
- Die Zeitung ist so übersichtlich wie der Küchenschrank ihrer Leser: Mit verbundenen Augen können morgens die Leser, noch schlaftrunken, ihren Kaffeebecher finden. So ordentlich muss auch eine Zeitung sein.
- Die Zeitung ist der beste Welterkunder, gerade in unruhigen Zeiten, in denen die Welt in unser ruhiges Land einbricht. Wer die Welt verstehen will, muss die Zeitung lesen: Das ist der Auftrag an die Redakteure, im Mantel und erst recht im Lokalen.
Die Zeitung bildet die lokale Gemeinschaft und öffnet sich den Debatten, Ein- und Widersprüchen.
**
https://kress.de/news/detail/beitrag/136304-der-relaunch-die-zeitung-muss-die-welt-erklaeren.html
Was wäre, wenn Google unsere Volontäre ausbildete?

Der Newsroom der Axel-Springer-Akademie, eine der vorbildlichen Journalistenschulen in Deutschland. Foto: Springer-Akademie
Volontäre kritisieren die Qualität ihrer Ausbildung, wie eine Studie der Universität Ilmenau in Thüringen belegt, an der gut zweihundert Volontäre teilgenommen haben. Diese Studie und die Charta der Journalistenschulen sind Thema der Kress-Kolumne JOURNALISMUS, die komplett hier zu lesen ist.
„Journalisten werden für eine Zukunft in der Vergangenheit ausgebildet“, schrieb ein Volontär in seinen Fragebogen. Kathrin Konyen aus dem Bundesvorstand des Deutschen-Journalisten-Verbands (DJV), der die Umfrage in Auftrag gegeben hat, kommentiert die Ilmenauer Studie:
Während die Vermittlung von klassischen journalistischen Fähigkeiten einigermaßen zufriedenstellend ist, hat die Ausbildung offenbar den Anschluss an die veränderten Anforderungen im Journalismus verpasst.
Selbst diese Interpretation, das Handwerk werde ausreichend vermittelt, ist reichlich optimistisch: Drei von zehn Volontären geben an, weder zu lernen, wie ein Journalist recherchiert, noch Recherche trainiert zu haben.
Nun mag man einwenden: Nicht die Volontärin soll bestimmen, was sie lernen muss, sondern Chefredakteur und Verleger – nach der alten Weisheit: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber diese Hybris kann sich keiner mehr erlauben: Die Volontäre sind heimisch in der digitalen Welt, während ihre Ausbilder noch elektrische Schreibmaschinen kennen und Klebe-Umbruch. So denken Volontäre offenbar intensiver an die Zukunft als viele ihrer Chefs, die eigentlich die Zukunft systematisch vordenken sollen. Eine Volontärin schreibt ihre Verwunderung in den Ilmenauer Fragebogen:
Die Journalistik hinkt Jahre hinter der Realität des Mediensystems hinterher.
Was die Thüringer Wissenschaftler herausgefunden haben, bestätigt der Hamburger Medienprofessor Weichert, der von der Arroganz der Ausbilder spricht, die sich vom alten Denken nicht lösen wollen. „Leider gibt es viele Kollegen, die noch nicht verstanden haben, dass journalistische Ausbildung neu gedacht werden muss.“
Journalismus muss allerdings nicht neu gedacht werden, aber er ist schwieriger geworden. In Zukunft muss ein Journalist das Handwerk beherrschen, so wie es Generationen vor ihm gelernt haben, aber er muss auch die sich stets wandelnde Technik beherrschen, muss immer wieder neu lernen, muss sich an den Lesern ausrichten, und er muss unternehmerisch denken, ohne die Unabhängigkeit seiner Profession zu gefährden. Das ist ein Dilemma, das ist das Dilemma der Ausbildung in den Verlagen:
- Es reicht nicht mehr, dass eine Volontärs-Mutter ihre Schützlinge behütet, ihnen das Porträt-Schreiben erklärt und oft vergeblich kämpft, wenn beim Engpass in einer Lokalredaktion die Volos nicht zu Kursen geschickt werden.
- Es reicht nicht, die Volontäre zu den Schulen zu schicken: Training und Theorie müssen verzahnt werden mit der Praxis in den Redaktionen. Das wird torpediert, wenn die Volontäre in ihrer Redaktion empfangen werden mit dem Schulterklopfen: Jetzt wird wieder richtig gearbeitet, vergiss lieber schnell das theoretische Gequassel-
- Es reicht nicht, die Volontäre ein paar Wochen in die Online-Redaktion zu schicken, sie Zeitungs-Artikel ins Netz transportieren oder der Polizei hinterherhecheln zu lassen.
Wie würde Google Journalisten ausbilden? Oder ein anderer der digitalen Konzerne? Dabei ist nicht entscheidend, was sie lehren, sondern vor allem wie sie lehren, wie sie miteinander arbeiten, wie sie führen, mit Fehlern umgehen – kurzum: wie sie mit Phantasie und Neugier die Welt neu erschaffen, ohne beliebig zu werden und nur nett zu sein (auch die digitale Welt ist eine harte Welt).
Ausbilden wie Google – das können Konzerne wie Springer, Gruner und Burda leisten, und sie tun es auch. Journalistenschulen, die nicht an Redaktionen angebunden sind, können es nur mühsam simulieren; Redaktionen könnten es leisten, wenn die Chefs es wollen und auch mal Geld in die Ausbildung und Ausbilder investieren, viel mehr Geld als heute.
Die meisten Volontäre müssen die Chefredakteure nicht zum Jagen tragen. Sie sind schon auf der Pirsch. Die Ilmenauer Studie belegt: Zwei von drei Volontäre wollen mehr über wirtschaftliches Handeln lernen und es auch trainieren, nicht zuletzt um im Überlebenskampf zu bestehen außerhalb einer Festanstellung. Die meisten Chefredakteure und Manager übersehen die Chance für die Verlage: Wer, wenn nicht die jungen Journalisten, wird in der Lage sein, neue Geschäfte auszudenken, auszuprobieren und zu verwirklichen?
In der Ilmenauer Volontärs-Studie beklagen die Volontäre:
- Wir werden nicht auf Management-Aufgaben vorbereitet.
- Wir trainieren nicht den Umgang mit Sozialen Medien.
- Wir wissen zu wenig über unsere Leser (und erst recht die Nicht-Leser).
- Wir lernen nicht, welche digitalen Werkzeuge es gibt und wie man sie nutzt.
Wenn Verlage nicht lernen, auszubilden wie Google es täte, wird es irgendwann Google selbst tun.
Regeln: Wie Journalisten mit Terroristen umgehen sollen
Die Presse lässt sich nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen
Dieser Satz müsste als Regel eigentlich ausreichen, wenn Journalisten über Terror und Gewalt berichten. Mit diesem Satz „aus den Leitlinien zur Berichterstattung über Gewalttaten“ beenden Georg Mascolo und der Terror-Experte Peter Neumann ihren Beitrag in der Süddeutschen Zeitung: „Die rohe Botschaft: Terroristen messen den Erfolg ihrer Anschläge auch am medialen Widerhall. Verschweigen ist keine Lösung, aber die neue Bedrohung erfordert neue Regeln“.
Diese Regeln schlagen Mascolo und Neumann vor (hier Zusammenfassung):
- Verschweigen kann keine Lösung sein, sonst verbreiten sich Verschwörungstheorien noch schneller.
- Größte Zurückhaltung ist geboten bei Fotos und Videos vom IS, anderen Terror-Organisationen oder Einzeltätern, nicht nur bei Bildern der Taten, sondern auch von marschierenden IS-Anhängern oder bei Bekenner-Botschaften von Attentätern.
- Ohne Kontext und Einordnung sollten Bilder überhaupt nicht verwendet werden.
- Bei der Sprache gilt Vorsicht wie bei den Bildern.
- Der Begriff „einsame Wölfe“ für Einzeltäter wird von Behörden und Wissenschaftler zwar benutzt, aber er heroisiert die Täter.
- Vorsicht bei Superlativen, die dem IS nutzen, um Angst zu steigern: „Eskalation“ usw.
- Pflicht zur Sorgfalt gilt auch für jeden, der in den Sozialen Medien Bilder verbreitet. „Solche Bilder haben das Potenzial zu traumatisieren“, so der Münchner Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. „Das ist eine Verantwortung, die man Hobbyjournalisten oder Freizeit-Filmern wirklich vor Augen führen muss.“
- Live-Übertragungen von Anti-Terror-Einsätzen gefährden die Arbeit und den Erfolg der Polizei, weil die Täter den Polizeieinsatz live im Fernsehen oder im Internet verfolgen können.
- Zurückhaltung bei der Beschreibung von Täter-Biografien: Es gibt keine klare Grenze mehr zwischen terroristischer Motivation und psychischer Erkrankung.
- Besondere Zurückhaltung bei Berichten über psychisch Kranke und Amokläufer; die von einigen französischen Medien wie Le Monde vertretene Linie ist richtig: keine Namen, keine Bilder. Die Gefahr von Nachahmern ist besonders hoch. Laut US-Studie steigt die Gefahr von weiteren Amokläufen direkt nach einer Tat um 22 Prozent.
Mascolo und Neumann verweisen auf die Regeln, die der IS zur Unterdrückung der Berichterstattung für sein eigenes Machtgebiet aufgestellt hat; er hat unabhängige Berichterstattung als Bedrohung erkannt: Zugelassen sind nur Journalisten, die dem selbsternannten Kalifen die Treue schwören.
Notwendig seien Fakten gegen die vom IS verbreiteten Mythen. Mascolo und Neumann:
Berichte über die massenhaften Desertionen etwa oder über die Korruption im Kalifat, die inzwischen so groß ist, dass sogar Mitgliederlisten der Terroristen verkauft werden. Oder Geschichten wie die in der Washington Post. Sie beschreibt, dass der IS Leute abgestellt hat, um gefallene Kämpfer zu bergen. Sie waschen ihnen das Blut ab, öffnen ihre Augen, verändern die starren Gesichtszüge so, dass ein Lächeln entsteht. Ganz so, als wären sie nicht unter Qualen gestorben, sondern freudig ins Paradies eingezogen.
**
Quelle: SZ 6. August 2016
Info: Presserat spricht Rügen aus wegen Fotos von Terroropfern
Unbenommen liegt ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung über das schreckliche Ereignis (in Brüssel) vor. Medien hatten jedoch eine oder mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen schwer verletzte Menschen identifizierbar zu sehen waren. Einige von ihnen sogar in Nahaufnahme. Diese Fotos verstoßen gegen den Schutz der Persönlichkeit. Presseethisch zulässig waren Fotos, die die dramatische Gesamtszenerie am Flughafen und an der Metro zeigten. Diese Bilder dokumentieren die schreckliche Realität dessen, was sich ereignet hat, überschreiten jedoch keine ethische Grenze. (aus einer Pressemitteilung des Presserats)
Namensnennung – ja oder nein? Verfassungsgericht stärkt die Meinungsfreiheit
Ein Mann verlässt seinen Laden, den er gemietet hatte, und zahlt die ausstehende Miete erst, als der Vermieter gegen ihn Strafanzeige stellt und Zwangsvollstreckung beantragt. Drei Jahre danach veröffentlicht der Mieter in einem Internet-Portal den Namen des Vermieters, der gegen ihn Strafanzeige gestellt hatte, und erzählt wahrheitsgemäß, was geschehen war.
Der Vermieter klagt wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte und seiner Sozialsphäre, er will den Eintrag gelöscht sehen: Land- und Oberlandesgericht geben ihm Recht. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet allerdings anders – für die Meinungsfreiheit. Das Urteil ist auch für Journalisten interessant, weil das Verfassungsgericht die Gründe aufzählt, die dafür sprechen, den Namen in einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung zu nennen:
- Die Fakten müssen stimmen.
- Die Behauptung wahrer Tatsachen über die Sozialsphäre müssen grundsätzlich hingenommen werden.
- Die Nennung des Namens berührt das Persönlichkeitsrecht
- Die Schwelle zur Persönlichkeitsrechts-Verletzung wird erst überschritten, wenn sie einen Persönlichkeitsschaden befürchten lässt, der unverhältnismäßig ist; das Gericht wörtlich: „außer Verhältnis zu dem Interesse an der Verbreitung der Wahrheit steht“.
- Die Nachteile für den Genannten müssen im rechten Verhältnis zur Schwere des geschilderten Verhaltens oder der Bedeutung für die Öffentlichkeit stehen.
- Droht kein unverhältnismäßiger Verlust an sozialer Achtung, muss einer die Veröffentlichung hinnehmen.
- Es ist unwesentlich, ob der Vorfall einige Jahre – im konkreten Fall drei – zurückliegt.
Dies ist kein Freibrief für Zeitungen und Nachrichten-Portale, stets einen Namen zu nennen. Im konkreten Fall ging es um Online-Portale, welche die Möglichkeit bieten, Firmen zu suchen und eine Bewertung abzugeben.
Das Urteil zeigt: Es kommt auf den Einzelfall an und die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Recht auf freie Meinungsäußerung. Wie schwierig diese Abwägung ist, zeigt die unterschiedliche Beurteilung von hohen Gerichten in dem konkreten Fall.
Bundesverfassungsgericht – Beschluss vom 29. Juni 2016: 1 BvR 3487/14
Amok, Terror & Gewalt (2): Immergleiches Muster, wie Netz und Medien reagieren
Nach den Eilmeldungen macht sich auf Facebook das Entsetzen breit, es folgen…
Die Medien reagieren – wie die sozialen Netzwerke – nach stets gleichem Muster, wenn Terroristen oder Amokläufer die Menschen aufwühlen. Den Teufelskreis beschreibt Lisa Altmeier im Jugendradio Puls; hier in Auszügen zusammengefasst:
- Entsetzen nach den Eilmeldungen: Entsetzen, Gerüchte, Falschmeldungen – und noch mehr Entsetzen.
- Solidarität, Mitgefühl: #JeSuisCharlie #PrayForMunich.
- Religionskritik: Muslim? Im vorauseilendem Ärger werden alle beschimpft, die sagen: Hat bestimmt nichts mit dem Islam zu tun
- Das muss ein Psycho sein!
- Deutungen und Religionskritik: „Der Islam ist eigentlich eine friedliche Religion“ oder Religionen sind überhaupt schlecht (siehe Kreuzzüge der Christen). „Ein Schauspiel, bei dem jeder seinen Text anhand der vielen vorangegangenen Vorführungen längst auswendig kann.“
- Medienkritik 1: Die Medien sind zu langsam! Wollen die etwa etwas verschweigen?
- Medienkritik 2: Die Medien sind zu schnell und machen dabei Fehler! Besser eine ausgewogene Analyse statt hektischer Live-Berichterstattung.
- Medienkritik 3: Warum berichten die Medien überhaupt?
- Anschläge gibt es, weil Täter sich Aufmerksamkeit erhoffen. Medien sind irgendwie mitverantwortlich. „Im Gegensatz zum Islam hat die Medienbranche kaum prominente Fürsprecher.“
- Solidaritätskritik: Scheinheilig! Überall im Internet dieselben Mitleidsbekundungen. Seltsamerweise passiert das nur bei Anschlägen im Westen. „Scheinheilig!“ finden die Solidaritätskritiker und attackieren die Mitleidigen.
- Politikerbashing: Merkel muss weg
- Verschwörungstheorie: Sagt mal, findet ihr es nicht auch komisch… Dass der Pass des Täters gleich gefunden wurde, ist nun merkwürdig. Sind wir alle Opfer einer Inszenierung.
**
Am Sonntag, 31. Juli 2016, um 18 Uhr auch im TV: „Puls“, ARD Alpha
Quelle: http://www.br.de/puls/themen/welt/zwoelf-phasen-der-reaktionen-nach-anschlaegen-und-terror-100.html
Selbstkritik nach dem Amok-Abend: Ich weiß nicht mehr, warum ich Falschmeldungen abgesetzt habe
„Lediglich BBC World und CNN berichteten, dass jemand vor den Schüssen im Olympia-Einkaufszentrum laut rief ,Allah ist groß‘, und zwar auf Arabisch“, mailt mir ein guter Freund, schickt ein Screenshot von CNN, vermutet bewusste Nachrichten-Unterdrückung bei deutschen Medien und argwöhnt: „Es bleibt eine merkwürdige Differenz zwischen nationalen und internationalen Medien in der Berichterstattung. Oder sehe ich da Spuren, die keine sind?“
Ja, sieht er. Christian Jakubetz beschreibt auf Twitter, auch mit bemerkenswerter Selbstkritik, wie Berichterstattung der ausländischen Medien funktioniert. Er habe so viel wie noch nie über Journalismus gelernt, schreibt er:
Ich war gestern Abend und heute Nacht für Stunden bei BBC World und Deutsche Welle TV on air. Jeden zweiten Satz musste ich mit „not confirmed“ beenden. Und obwohl ich mich natürlich bemüht habe, ausschließlich (vermeintliche) Fakten zu schildern, habe ich Falschmeldungen in die Welt gepustet: nämlich die, dass es auch am Stachus zu einer Schießerei gekommen ist und dass drei Männer am OEZ geschossen haben… Jetzt, mit dem Abstand von einer paar Stunden, weiß ich nicht mehr, warum ich diese Meldungen abgesetzt habe, ohne sie gegenzuchecken. Allerdings, ohne dass das eine Ausrede sein soll: Man steht da plötzlich mehr oder weniger unvorbereitet und Radio- und TV-Stationen aus der ganzen Welt wollen von dir im Minutentakt etwas Neues haben.
Jabubetz Erkenntnisse über die Sozialen Medien sind zwiespältig nach dem Münchner Amok-Abend:
Großartig! Der Hashtag #offeneTür, die unaufgeregten Informationen der Polizei und die Facebook-Funktion, mit der man markieren konnte: Ich bin in Sicherheit.
Hassenswert: All der Dreck, der ausgekotzt wird; Gerüchte (Bombenanschlag mit 250 Toten); die üblichen Hetzer; Journalisten wie vom Münchner Merkur, die kommentierten, wie perfide es sei, ausgerechnet München zum Ziel des bestialischen islamischen Terrorismus zu machen.
Ist das nicht ein Plädoyer für einen Journalismus, der recherchiert, einordnet und zum Auge des Orkans wird, zum Ruhepunkt?
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?









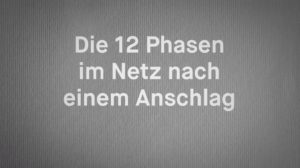



 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von