Vorsicht Schmähkritik! Ein wegweisendes Urteil des Verfassungsgerichts

Ist „Rabauken-Jäger“ Schmähkritik? Wegen dieses Artikels wurde ein Nordkurier-Redakteur von zwei Instanzen zu einer Geldstrafe verurteilt. (Foto: Nordkurier)
Wenn Richter und Staatsanwälte, Bürgermeister und Amtsträger jeder Art von Journalisten kritisiert werden, drohen sie bisweilen: Das ist Schmähkritik! Dann droht Gefahr: Bei einer Anklage wegen Schmähkritik, prüfen Richter nicht mehr, ob die Kritik unter die Meinungsfreiheit fällt. So können Richter den Artikel 5 des Grundgesetzes leicht aushebeln.
Aber offenbar macht das Bundesverfassungsgericht bei dieser Praxis nicht mehr mit, sieht sie nicht durch unser Grundgesetz gedeckt; es zieht neue Grenzen, die auch für Journalisten wichtig sind, und urteilt in einem kaum beachteten Fall:
Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit schützt nicht nur sachlich-differenzierte Äußerungen. Vielmehr darf Kritik auch pointiert, polemisch und überspitzt erfolgen.
Im Schmähkritik-Prozess vor dem Verfassungsgericht ging es um einen Rechtsanwalt in Berlin, den das Landgericht verurteilt hatte – wegen „Schmähkritik“ an einer Staatsanwältin. Das war der Fall:
Zwischen einem Strafverteidiger und einer Staatsanwältin kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung, als sein Mandant in Haft genommen wird. Beim Telefonat mit einem Journalisten tituliert der Anwalt die Staatsanwältin eine „dahergelaufene Staatsanwältin“ und „durchgeknallte Staatsanwältin“. Das Landgericht verurteilt den Anwalt zu einer Geldstrafe von 8400 Euro.
Das Verfassungsgericht kassierte das Urteil aus Berlin: Das war eine Beleidigung, aber keine Schmähkritik. Die Verfassungsrichter gaben eine wegweisende Begründung:
Wird eine Äußerung unzutreffend als Schmähkritik eingestuft, liegt darin ein eigenständiger verfassungsrechtlicher Fehler, auch wenn die Äußerung im Ergebnis durchaus als Beleidigung bestraft werden darf.
Jedes Gericht darf künftig nicht mehr automatisch und unbegründet von „Schmähkritik“ ausgehen, wenn beispielsweise eine Amtsperson kritisiert oder beleidigt wird. Gibt es einen sachlichen Grund für die Beleidigung – wie im vorliegenden Fall – kann ein Gericht nicht mehr auf Schmähkritik setzen.
Die Verfassungsrichter spekulieren ein wenig: Hätte der Anwalt die Staatsanwältin beleidigt ohne Zusammenhang mit dem Verfahren, hätte das Gericht von Schmähkritik ausgehen können; oder hätte der Anwalt das Verfahren „nur als mutwillig gesuchten Anlass oder Vorwand genutzt, um die Staatsanwältin als solche zu diffamieren“, dann wäre es Schmähkritik. Aber um eine „Abwägung zwischen seiner Meinungsfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht der Staatsanwältin“ kommt ein Gericht nicht herum, das nochmals den Fall verhandeln muss.
Einen Beleidigungs-Freibrief gibt es allerdings nicht:
Ein Anwalt ist grundsätzlich nicht berechtigt, aus Verärgerung über von ihm als falsch angesehene Maßnahmen einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts diese gerade gegenüber der Presse mit Beschimpfungen zu überziehen.
Wegweisend ist das Urteil auch für Journalisten, denen Richter und Staatsanwälte gerne mit einer „Schmähkritik“-Anklage drohen. Das Verfassungsgerichts-Urteil spielt schon die entscheidende Rolle im Prozess um die Rabauken-Affäre in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Verweis auf das Verfassungsgericht hob die dritte Instanz, das Oberlandesgericht, die Geldstrafe auf, zu der ein Reporter des Nordkurier in Neubrandenburg verurteilt worden war vom Amtsgericht Pasewalk und dem Landgericht Neubrandenburg.
In der umfangreichen Urteilsbegründung stellen die Rostocker Richter fest: Ja, „Rabaukenjäger“ ist ehrverletzend und herabsetzend – aber „feuilletonistisch-ironisierend“ gemeint und somit harmlos. Wer die Ehre eines anderen verletzt, macht sich erst strafbar, wenn er ihm die persönliche Würde abspricht, ihn als „unterwertiges Wesen“ beschreibt.
Erst recht sei der Bericht keine Schmähkritik, wie noch das Landgericht urteilte – mit der Folge, dass die Meinungsfreiheit hinter den Ehrenschutz zurücktreten musste. Die OLG-Richter beziehen sich auf das eingangs geschilderte Verfassungsgerichts-Urteil zur Schmähkritik und nennen als wesentliches Merkmal für Schmähung, „eine das sachliche Anliegen völlig in den Hintergrund drängende persönliche Kränkung. Sie wäre gegeben, wenn die Diffamierung der Person und ihre Herabsetzung im Vordergrund stünde“.
Die Richter, die sogar in Grimms Wörterbuch forschen, geben in der Begründung des Freispruchs allerdings auch zu erkennen, dass sie den Bericht nicht als gelungen ansehen: Er sei „umgangssprachlich“, Zitate stünden im Indikativ statt im Konjunktiv, „eine gewisse holzschnittartige Grobheit“ sei in der Darstellung zu entdecken ebenso wie „sprachliche Ungenauigkeit“.
Doch solch Kritik am journalistischen Stil spielt für das Urteil keine Rolle, zumal der Redakteur eines nicht versäumt hatte: Er wollte den Jäger in seiner Recherche telefonisch erreichen, aber vergeblich. Dass er nicht auf eine Stellungnahme warten konnte und aktuell berichten musste, verstehen die Richter – weil der Fall schon in den sozialen Netzwerken hochkochte.
Auf eine, gerade für Journalisten wichtige Unterscheidung weisen die Richter noch hin: Wer sich öffentlich daneben benimmt wie der Jäger, genieße weniger Schutz vor Kritik, als wenn er’s privat tue. Und eine Bundesstraße ist nun einmal öffentlich.
Das Schmähkritik-Urteil des Verfassungsgerichts dürfte auch im Fall Böhmermann eine Rolle spielen. Am 10. Februar will das Landgericht Hamburg über Erdogans Begehren entscheiden, das Royal-Gedicht komplett zu verbieten.
** Die komplette Kolumne:
Quellen:
- Bundesverfassungsgerichts-Beschluss vom 29. Juni 2016 zu Schmähkritik:1 BvR 2646/15
- OLG Rostock AZ 1 Ss 46/16 20 RR 66/16
Die Online-Sonntagszeitung der HNA: Nur Qualität wird den Journalismus retten
Guter Journalismus wird notwendig sein, um die Leser, gerade die jungen, anzuziehen. So denken Horst Seidenfaden und Jens Nähler von der HNA in Kassel, sie denken ihre Sonntagszeitung für Online-Leser, aber sie denken sie aus der Zeitung heraus – und starten Anfang Dezember Sieben, eine lokale Sonntagszeitung im Internet.
Qualität zählt, nicht Quantität wie in den billig gemachten 24er-Blaulicht-Portalen, in denen Leser die aktuellen Leichen zählen können: In der Tat werden diese Portale geklickt wie der Teufel, aber sie bringen nur Reichweite und keinen Gewinn – erst recht keinen Gewinn für den Journalismus. Sieben ist der journalistische Gegenentwurf, „Premium first“ nennt ihn Horst Seidenfaden.
Anfang Dezember wird Sieben das erste Mal erscheinen, ein Weihnachtsgeschenk für junge Nicht-Leser, die auf ihrem Tablet die Faszination des Lokaljournalismus erleben sollen. Was ist neu an dieser Zeitung im Netz?
- Sieben hat ein eigenes Design, das sich nicht an das HNA-Layout anlehnt.
- Die Ressorts sind nicht die Ressorts der Zeitung, das Menü ist übersichtlich: Heimat / Welten mit Politik und Kultur / Leben mit Garten, Wohnen, Reisen / Klartext mit exklusiver Meinung von starken Kommentatoren.
- Blogger aus der Region liefern Ratgeber-Themen wie Ernährung, Mode oder Fitness.
- Keine aktuelle Nachrichten, auch keine Sportergebnisse vom Wochenende; die finden die HNA-Leser weiter auf hna.de und Kassel-Live.
- Es gibt kein E-Paper; es ist zu teuer in der Produktion, zudem sind keine Verlinkungen oder Einbindungen von Videos möglich.
- Sieben ist strikt lokal: „Aus den Lokalausgaben fischen wir während der Produktionswoche die Themen heraus, die dann erst später im Blatt erscheinen“, erläutert Horst Seidenfaden, der die Idee hatte. Online-Chef Jens Nähler setzt das Konzept um: „Wir füttern die Artikel an, etwa mit Videos und Bildergalerien.“
Das sind mögliche Themen von Sieben, zu finden in der Nullnummer:
Porträts eines Discjockeys „Die Magie des Plattentellers“ und eines Extremläufers aus Baunatal oder eines Tätowierers aus Treysa; Recherchen wie „Was Verbraucher zu Bio lockt“; eine Bildergeschichte mit Fotos eines Paars aus Kaufungen, das durch Kanadas Natur gezogen war; eine Nachmach-Geschichte „So entsteht ein Schlüsseltäschchen in fünf Schritten“, aufgehängt an einer Patchwork-Gruppe.
Es gibt keine eigene Sieben-Redaktion, die Produktion bewältigt zunächst Jens Nählers kleine Online-Redaktion. Den Inhalt besorgen zum großen Teil die Lokalredaktionen. „Für die Redakteure bedeutet das keine Zusatzarbeit“, sagt Chefredakteur Seidenfaden, „sondern nur eine Verzögerung: Sie dürfen die Themen zeitversetzt, also in den Wochen nach der Sieben-Ausgabe, im Lokalteil mitnehmen.“
Sieben wird bis Ostern Sieben kostenlos sein – verbunden mit dem Hinweis, dass es ab April denen 4,90 Euro kosten wird, die es ausschließlich abonnieren wollen; für HNA-Abonnenten ist es inklusive. Auf die gut 130.000 Zeitungs-Abonnenten schielen die Chefredakteure nicht. Sie dürfte Sieben nicht übermäßig beeindrucken: Sie reagierten in einem „User-Test“ zurückhaltend, die siebte Ausgabe dürfte ihre Bindung an die Zeitung kaum stärken.
Je weniger die Testleser regelmäßig Zeitung lesen, je weniger sie an das Zeitungs-Layout gewöhnt sind, desto begeisterter waren sie. So werden die „Digital-Only“ zur lukrativen Zielgruppe, die sich durchaus für ein Abo, ähnlich wie bei Spotify oder Netflix, erwärmen können.
Mehr in der Kress-Kolumne JOURNALISMUS! – https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/136489-ein-kleiner-schluessel-zum-paid-content-hna-bringt-im-netz-ein-sonntags-lokalmagazin.html
Was wäre, wenn Google unsere Volontäre ausbildete?

Der Newsroom der Axel-Springer-Akademie, eine der vorbildlichen Journalistenschulen in Deutschland. Foto: Springer-Akademie
Volontäre kritisieren die Qualität ihrer Ausbildung, wie eine Studie der Universität Ilmenau in Thüringen belegt, an der gut zweihundert Volontäre teilgenommen haben. Diese Studie und die Charta der Journalistenschulen sind Thema der Kress-Kolumne JOURNALISMUS, die komplett hier zu lesen ist.
„Journalisten werden für eine Zukunft in der Vergangenheit ausgebildet“, schrieb ein Volontär in seinen Fragebogen. Kathrin Konyen aus dem Bundesvorstand des Deutschen-Journalisten-Verbands (DJV), der die Umfrage in Auftrag gegeben hat, kommentiert die Ilmenauer Studie:
Während die Vermittlung von klassischen journalistischen Fähigkeiten einigermaßen zufriedenstellend ist, hat die Ausbildung offenbar den Anschluss an die veränderten Anforderungen im Journalismus verpasst.
Selbst diese Interpretation, das Handwerk werde ausreichend vermittelt, ist reichlich optimistisch: Drei von zehn Volontären geben an, weder zu lernen, wie ein Journalist recherchiert, noch Recherche trainiert zu haben.
Nun mag man einwenden: Nicht die Volontärin soll bestimmen, was sie lernen muss, sondern Chefredakteur und Verleger – nach der alten Weisheit: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber diese Hybris kann sich keiner mehr erlauben: Die Volontäre sind heimisch in der digitalen Welt, während ihre Ausbilder noch elektrische Schreibmaschinen kennen und Klebe-Umbruch. So denken Volontäre offenbar intensiver an die Zukunft als viele ihrer Chefs, die eigentlich die Zukunft systematisch vordenken sollen. Eine Volontärin schreibt ihre Verwunderung in den Ilmenauer Fragebogen:
Die Journalistik hinkt Jahre hinter der Realität des Mediensystems hinterher.
Was die Thüringer Wissenschaftler herausgefunden haben, bestätigt der Hamburger Medienprofessor Weichert, der von der Arroganz der Ausbilder spricht, die sich vom alten Denken nicht lösen wollen. „Leider gibt es viele Kollegen, die noch nicht verstanden haben, dass journalistische Ausbildung neu gedacht werden muss.“
Journalismus muss allerdings nicht neu gedacht werden, aber er ist schwieriger geworden. In Zukunft muss ein Journalist das Handwerk beherrschen, so wie es Generationen vor ihm gelernt haben, aber er muss auch die sich stets wandelnde Technik beherrschen, muss immer wieder neu lernen, muss sich an den Lesern ausrichten, und er muss unternehmerisch denken, ohne die Unabhängigkeit seiner Profession zu gefährden. Das ist ein Dilemma, das ist das Dilemma der Ausbildung in den Verlagen:
- Es reicht nicht mehr, dass eine Volontärs-Mutter ihre Schützlinge behütet, ihnen das Porträt-Schreiben erklärt und oft vergeblich kämpft, wenn beim Engpass in einer Lokalredaktion die Volos nicht zu Kursen geschickt werden.
- Es reicht nicht, die Volontäre zu den Schulen zu schicken: Training und Theorie müssen verzahnt werden mit der Praxis in den Redaktionen. Das wird torpediert, wenn die Volontäre in ihrer Redaktion empfangen werden mit dem Schulterklopfen: Jetzt wird wieder richtig gearbeitet, vergiss lieber schnell das theoretische Gequassel-
- Es reicht nicht, die Volontäre ein paar Wochen in die Online-Redaktion zu schicken, sie Zeitungs-Artikel ins Netz transportieren oder der Polizei hinterherhecheln zu lassen.
Wie würde Google Journalisten ausbilden? Oder ein anderer der digitalen Konzerne? Dabei ist nicht entscheidend, was sie lehren, sondern vor allem wie sie lehren, wie sie miteinander arbeiten, wie sie führen, mit Fehlern umgehen – kurzum: wie sie mit Phantasie und Neugier die Welt neu erschaffen, ohne beliebig zu werden und nur nett zu sein (auch die digitale Welt ist eine harte Welt).
Ausbilden wie Google – das können Konzerne wie Springer, Gruner und Burda leisten, und sie tun es auch. Journalistenschulen, die nicht an Redaktionen angebunden sind, können es nur mühsam simulieren; Redaktionen könnten es leisten, wenn die Chefs es wollen und auch mal Geld in die Ausbildung und Ausbilder investieren, viel mehr Geld als heute.
Die meisten Volontäre müssen die Chefredakteure nicht zum Jagen tragen. Sie sind schon auf der Pirsch. Die Ilmenauer Studie belegt: Zwei von drei Volontäre wollen mehr über wirtschaftliches Handeln lernen und es auch trainieren, nicht zuletzt um im Überlebenskampf zu bestehen außerhalb einer Festanstellung. Die meisten Chefredakteure und Manager übersehen die Chance für die Verlage: Wer, wenn nicht die jungen Journalisten, wird in der Lage sein, neue Geschäfte auszudenken, auszuprobieren und zu verwirklichen?
In der Ilmenauer Volontärs-Studie beklagen die Volontäre:
- Wir werden nicht auf Management-Aufgaben vorbereitet.
- Wir trainieren nicht den Umgang mit Sozialen Medien.
- Wir wissen zu wenig über unsere Leser (und erst recht die Nicht-Leser).
- Wir lernen nicht, welche digitalen Werkzeuge es gibt und wie man sie nutzt.
Wenn Verlage nicht lernen, auszubilden wie Google es täte, wird es irgendwann Google selbst tun.
Verfassungsgericht zu Doping-Vorwürfen: Auch nicht bewiesene dürfen verbreitet werden
Was zählt mehr: Mein Persönlichkeitsrecht, durch unwahre Nachrichten verletzt zu werden – oder die Meinungsfreiheit, eine wichtige, aber nicht beweisbare Nachricht zu verbreiten? Land- und Oberlandesgericht gaben einer Leichtathletin Recht, die nicht mehr lesen wollte: Als Dreizehnjährige habe ihr DDR-Trainer ihr das Dopingmittel Oral-Turinabol verabreicht.
Die Gerichte urteilten im Sinne der Leichtathletin: Einen Vorwurf, der nicht bewiesen werden kann, werten wir als „prozessual unwahr“; also wiegt das Persönlichkeitsrecht der Sportlerin stärker als das Grundrecht der Meinungsfreiheit.
Die Gerichte haben es sich zu leicht gemacht und die Meinungsfreiheit nicht ausreichend gewürdigt, findet dagegen das Bundesverfassungsgericht. In einem gerade veröffentlichten Urteil gibt es die Kriterien an, nach denen Journalisten auch Unbewiesenes weiter behaupten dürfen:
-
Es muss ein Vorwurf sein, der für die Öffentlichkeit „wesentlich“ ist.
-
Der Vorwurf muss „hinreichend sorgfältig“ recherchiert werden. Je schwerer der Vorwurf, umso höher die Sorgfalt. Dabei müssen Journalisten intensiver recherchieren als Privatpersonen, die einen Vorwurf erheben.
-
Der Vorwurf kann stimmen, muss aber nicht stimmen: Ist so das Ergebnis der Recherche, steht die Wahrheit also nicht fest, kann die Meinungsfreiheit stärker wiegen als das Persönlichkeitsrecht. Das Gericht wörtlich:
„Sofern der Wahrheitsgehalt einer Tatsachenbehauptung nicht feststellbar ist, kann das Grundrecht der Meinungsfreiheit einem generellen Vorrang des Persönlichkeitsrechts entgegenstehen.“ -
Nach Abschluss umfassender Recherchen müssen Journalisten kenntlich machen: Der Vorwurf ist nicht gedeckt trotz intensiver Recherchen; oder: er ist umstritten.
**
Quelle: 1 BvR 3388/14
Selbstkritik nach dem Amok-Abend: Ich weiß nicht mehr, warum ich Falschmeldungen abgesetzt habe
„Lediglich BBC World und CNN berichteten, dass jemand vor den Schüssen im Olympia-Einkaufszentrum laut rief ,Allah ist groß‘, und zwar auf Arabisch“, mailt mir ein guter Freund, schickt ein Screenshot von CNN, vermutet bewusste Nachrichten-Unterdrückung bei deutschen Medien und argwöhnt: „Es bleibt eine merkwürdige Differenz zwischen nationalen und internationalen Medien in der Berichterstattung. Oder sehe ich da Spuren, die keine sind?“
Ja, sieht er. Christian Jakubetz beschreibt auf Twitter, auch mit bemerkenswerter Selbstkritik, wie Berichterstattung der ausländischen Medien funktioniert. Er habe so viel wie noch nie über Journalismus gelernt, schreibt er:
Ich war gestern Abend und heute Nacht für Stunden bei BBC World und Deutsche Welle TV on air. Jeden zweiten Satz musste ich mit „not confirmed“ beenden. Und obwohl ich mich natürlich bemüht habe, ausschließlich (vermeintliche) Fakten zu schildern, habe ich Falschmeldungen in die Welt gepustet: nämlich die, dass es auch am Stachus zu einer Schießerei gekommen ist und dass drei Männer am OEZ geschossen haben… Jetzt, mit dem Abstand von einer paar Stunden, weiß ich nicht mehr, warum ich diese Meldungen abgesetzt habe, ohne sie gegenzuchecken. Allerdings, ohne dass das eine Ausrede sein soll: Man steht da plötzlich mehr oder weniger unvorbereitet und Radio- und TV-Stationen aus der ganzen Welt wollen von dir im Minutentakt etwas Neues haben.
Jabubetz Erkenntnisse über die Sozialen Medien sind zwiespältig nach dem Münchner Amok-Abend:
Großartig! Der Hashtag #offeneTür, die unaufgeregten Informationen der Polizei und die Facebook-Funktion, mit der man markieren konnte: Ich bin in Sicherheit.
Hassenswert: All der Dreck, der ausgekotzt wird; Gerüchte (Bombenanschlag mit 250 Toten); die üblichen Hetzer; Journalisten wie vom Münchner Merkur, die kommentierten, wie perfide es sei, ausgerechnet München zum Ziel des bestialischen islamischen Terrorismus zu machen.
Ist das nicht ein Plädoyer für einen Journalismus, der recherchiert, einordnet und zum Auge des Orkans wird, zum Ruhepunkt?
Umfrage: Zeitungsleser sind besonders aufmerksam, aber weniger fröhlich
Thomas Koch berichtet in „Mr. Media“, seinem Blog auf W&V, von einer 6.000-Menschen-Befragung des Konsumentenbüros: Wann und in welcher Stimmung werden welche Medien genutzt?
Radiohören: „fröhlich, heiter“.
Zeitunglesen: „Weniger fröhlich, dafür besonders aufmerksam“.
Fernsehen: „gelöst, entspannt, aber stark überdurchschnittlich abgespannt, ausgelaugt“-
Online: „Besonders intensiv genervt, gestresst“.
Die Umfrage ist besonders für Werbetreibende gedacht: In welchem Medium kann ich die Menschen für meine Botschaft am besten erreichen?
SZ und Recherche-Journalismus: Investition in Investigativ wirtschaftlich erfolgreich
Die einen investieren in Zentralredaktionen, die Süddeutsche Zeitung investiert in Journalismus, in ein Recherche-Ressort, geleitet vom Investigativ-Papst Hans Leyendecker, sowie in Aus- und Weiterbildung von Redakteuren, die lernen, tief und tiefer zu recherchieren. SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach zu Horizont-Online:
Die SZ unterscheidet sich hier von allen anderen Zeitungen in Deutschland. Die Investition in die investigative Recherche zahlt sich für uns sowohl journalistisch als auch wirtschaftlich aus.
Konkret wird Gesamtvertriebsleiter Mario Lauer:
- Der Einzelverkauf stieg am Montag, als die „Panama Papers“ erstmals im Blatt standen, um das Doppelte an den Bahnhof-Kiosken und um 80 Prozent an den anderen Verkaufsstellen. An den ersten drei Tagen verkaufte die SZ über 30.000 Exemplare mehr als an vergleichbaren Wochentagen.
- Die Downloadzahlen stiegen um mehr als 30 Prozent gegenüber den Vorwochen, bei den Testzugängen über 50 Prozent.
- Das Interesse sank rasch: „Dies hat ganz sicherlich damit zu tun, dass sich Informationen rascher über das Netz verbreiten und zu jedem Zeitpunkt und über verschiedenste Kanäle verfügbar sind.“
Und Online?
Digitalchef Stefan Plöchinger:
Wir machen mit exklusiven Geschichten gerade auch im Netz klar, was der Wert von unabhängigem Journalismus ist und dass wir nicht zuletzt deshalb ein Bezahlmodell eingeführt haben.
Die Zahlen konkret:
- Der Gesamt-Traffic hatte am Sonntag und Montag des Erscheinens das Drei- bis Vierfache normaler Werktage erreicht, zwischen 3 und 4 Millionen Visits je Tag.
- In der ersten Woche 13 Prozent mehr Visits als in der Vorwoche, 10 Prozent mehr Nutzer und 7 Prozent mehr PI. Die Werte blieben auch in der zweiten Woche leicht höher.
- Mehr Zugriffszahlen aus dem englischsprachigen Raum. Der erfolgreichste Text insgesamt, die englische Variante des Erklärstücks „Das ist das Leak“, kam auf mehr als 2 Millionen PI. Die erfolgreichste Einzelgeschichte war mit mehr als 400.000 PI die Island-Geschichte auf Englisch.
- Aus dem Ausland kamen mit Abstand die meisten Zugriffe. Das ist ein Novum in der Geschichte von SZ.de: USA 36 Prozent, Deutschland 33 Prozent, Kanada 5 Prozent, Großbritannien 4 Prozent, China, Österreich, Australien, Schweiz und Niederlande je 2 Prozent. Die englischen Übersetzungen haben sich also zur internationalen Profilbildung bestens bezahlt gemacht.
Was ist ein gutes Porträt? Gedanken zur menschlichsten Form des Journalismus
Ich lese, höre nicht auf zu lesen, mag den Menschen, der schreibt, und noch mehr den, über den er schreibt: Das sind meine liebsten Porträts. Es gibt auch die anderen: Ich weiß nach der Lektüre, warum ich einen Menschen nicht mag. Oder ich verstehe, warum Schurken so sind und so geworden sind, wie sie sind. Porträts zeigen die Widersprüchlichkeit der Welt und den größten Widerspruch überhaupt: Die Menschen.
Am besten ist ein Porträt, wenn es mich verwandelt: Eigentlich mochte in den Menschen im Porträt nicht, nachher mochte ich ihn. Erzählen kann verwandeln.
Nehmen wir ein Porträt von Tobias Haberl und Matthias Ziegler, dem Fotografen. Die beiden haben Margot Käßmann zehn Tage lang auf einer Asien-Reise begleitet und im Süddeutsche Zeitung Magazin ein schönes Porträt geschrieben, einfach ein schönes. Ich mochte Margot Käßmann nicht, mochte nur einen einzige Satz von ihr, nach ihrem doppelten Rücktritt: „Man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“ (solch einen Satz kann man nicht einfach erfinden, er muss in dem Teil des Bewusstseins liegen, in dem der Sinn-Proviant fürs Leben aufbewahrt ist).
Eigentlich mochte ich Margot Käßmann nicht, nach dem Porträt mag ich sie.
Ermutigend ist, dass Chefredaktionen noch die 10-Tage-Reise zweier Mitarbeiter bezahlen wollen und können – also nicht husch-husch, ein bisschen googeln, ein Gespräch, vielleicht noch ein, zwei Vorträge hören und dann schnell schreiben. In zehn Tagen lernt ein Journalist einen Menschen kennen, zehn Tage kann sich selbst ein Schauspieler nicht verstellen oder in eine Porträt-affine Rolle schlüpfen.
Das geling erst recht nicht auf einer Asien-Reise, die auch für den Journalisten kein Vergnügen ist: Immer nahe der Frau, um die es geht, selbst wenn die nachts im Bademantel zum Hotel-Pool geht und zwanzig Bahnen dreht; immer die Hitze, Anti-Mücken-Sprays, die Fülle an Eindrücken und die stets bange Frage: Was kann ich von dem Vielen gebrauchen? Wer ist diese Frau wirklich?
Tobias Haberl beobachtet, beschreibt – und erzählt; er ist ein guter Erzähler, ein Märchen-Erzähler, weil Märchen wirklicher sind als die Wirklichkeit. Und dann rutscht ihm in der langen, gut 4000 Wörter umfassenden Reportage ein Satz durch, ein einziger Satz, der fast alles zerstört. Plötzlich hört er mittendrin auf zu erzählen und fällt in einen Laudatoren-Festton, schreibt das Zeugnis:
Margot Käßmann ist faszinierend… hat eine unglaubliche Energie und Lebenslust, viel Disziplin, ist eine ausgezeichnete Rednerin und charmante, kluge, selbstironische Gesprächspartnerin, aber ihre Ausstrahlung ist die einer ganz normalen Frau…
Da hat sich der Reporter überwältigt, liegt seiner Protagonistin zu Füßen, anstatt einfach zu erzählen und dem Leser das Urteil zu überlassen. In seiner selbst verschuldeten Überwältigung kommt er mit seiner Beobachtungen in Konflikt: „Viel Disziplin“ lobt er, Disziplin?, kurz zuvor hatte er geschrieben, sie rede oft schneller als sie denken kann, wäge nicht immer ab.
Überlass dem Leser das Urteil, das ist klüger!
Der Reporter ist eh der Stärkere: Er wählt aus seinen Beobachtungen aus, wählt die Worte, das Tempo, die Atmosphäre der Reportage. Also muss er dem Leser nicht alles vorkauen, erst recht nicht seine Begeisterung (oder auch das Gegenteil) überstülpen, er soll erzählen, das reicht.
Hat das kein Gegenleser in der Redaktion entdeckt?
Gegen Ende der Reportage rutscht noch so ein Satz durch:
Käßmann hat seit dieser einen dummen Nacht vor sechs Jahren ziemlich viel richtig gemacht. Als hätte sie…
Da hat sich der Leser schon längst ein Urteil gebildet, er will nicht den Reporter als Oberlehrer erleben, der noch schnell zeigen will, er sei der Klügere. Es ist oft ein Problem von Distanz und Nähe: Zu schnell gerät der Reporter zu nah an den Menschen heran. Spätestens beim Schreiben sollte er die professionelle Distanz wieder wahren, vor allem im Interesse der Leser.
Ob sich der Reporter zu viel Zeit beim Schreiben gelassen hat? Indirekt erzählt er von seinem langen Kampf: Sechs Wochen nach der Reise besucht er Margot Käßmann noch einmal auf Usedom, wo sie Kaffee kocht, Kuchen gebacken hat – und der Reporter fast seine Distanz verliert. Der Usedom-Schluss wirkt drangehängt, ist zu lang.
Dennoch: Es ist ein schönes Porträt, eines, das den Leser überraschen, gar verwandeln kann.
Vorschlag einer Wirtschafts-Professorin: Non Profit-Medien, um die Demokratie zu retten
Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?
Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.
Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.
Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.
Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.
Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.
Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.
Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.
Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:
-
Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.
-
Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.
Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:
-
Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)
-
und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).
In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.
Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?
Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“
Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.
Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:
-
Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?
-
Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?
-
Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?
**
Quellen:
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?











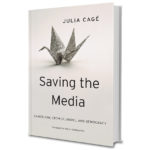


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von