#niceAttacks – „Nice“ ist Nizza und nett (Friedhof der Wörter)
„Nice“ ist nett, ist ein schönes englisches Wort, das viele kennen, auch wenn sie nur Bruchstücke des Englischen verstehen. „Nice“ ist aber auch das englische Wort für Nizza, die seit dieser Woche die Stadt des Terrors ist, die Stadt der fast hundert Menschen, die starben, als ein Lastwagen in die Menge gerast ist.
Bei Twitter lautet der Hashtag, also das Stichwort für den Terror in Nizza: #niceAttacks. Das kann man als Nizza-Anschlag lesen oder auch als netten Anschlag. Magdalena Taube (piqer) schreibt dazu:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht’s noch? Ja, ja. Nice ist die englischsprachige Variante von Nizza. Aber, was viele nun in all der Hektik lesen ist: „nett“. Das wertet die Aktion vielleicht zwingendermaßen auf. Doch es überhöht sie auf schrille Weise. Ist das nicht etwas zu viel des hochwertigen Sauerstoffs für Terror?
Tweet des Schweizers Ralph Lehner @RalphLehner
Die Verwendung des englischen Hashtags #NiceAttack ist in meinen Augen mehr als unglücklich…
Manfred Ruch antwortet:
Blickwinkel ändern
Und Ralph Lehner darauf:
Gut, ja, aus Sicht des Attentäters passts. Aber den Blickwinkel sollte keiner einnehmen…
„Die Welt geht doch nicht unter“: Ein Lob dem letzten Satz (Die Reportage)
Der erste Satz! Wie viele Dichter und Journalisten haben Angst vor ihm, denken stunden-, gar tagelang über ihn nach, bekommen Schreibblockaden, schrumpfen innerlich zusammen, wenn der Chef sagt: Wenn sie den ersten Satz vermasseln, liest keiner mehr den Rest. Reißen Sie sich zusammen!
Aber kaum einer bekommt eine Schreibblockade, wenn er an den letzten Satz denkt, den Rausschmeißer. Zwar steht in den Reportage-Ratgebern: Er ist wichtig, bleibt im Kopf, regt zum Weiterdenken an! Aber bei den meisten Reportern ist die Luft am Ende raus, alle Sprachbilder aufgebraucht, die wirklichen Bilder erst recht. Man stiehlt sich irgendwie aus der Reportage raus, feuilletonisiert ein wenig, öffnet das Fenster einen Spalt für den Weltgeist – Ende.
Holger Gertz‘ Reportage über Frankreich bei der Europameisterschaft beweist das Gegenteil: Ein müder Einstieg, ein umwerfender Schluss, dazwischen eine starke, weil nachdenkliche Reportage, die von Terror und Fußball, dem Lebensgefühl der Franzosen und Schweinsteigers Hand im Strafraum erzählt. Allein die Zwischentitel reizen zum Lesen, einer verführerischer als der andere – und stärker als „Am Ende der Tage“, einer langweiligen Überschrift aus dem Text-Baukasten:
-
Wie viel innere Stärke muss eine Stadt haben, die nach allem, was war, wieder so offen sein kann
-
Der Fußball erdrückt sich mit seinem immer pralleren Programm gerade selbst
-
Und in der Welt passiert so viel, dass manche gar nicht wissen, warum jetzt Schweigeminute ist
-
Deutsche Effizienz? Wir packen uns die Bälle im Strafraum neuerdings mit der Hand
Und dann der letzte Absatz, der sogar mit Assoziationen an Sieg-Heil spielen kann, ohne peinlich zu wirken; der an die Isländer und ihren derb-neckischen Schlachtruf erinnert und im letzten Satz mit dem Terror und unserer Angst ironisch ins Gericht geht:
Die deutschen Fußballfans haben die furchtbarsten Lieder und Rufe, aber vor einer Bar in einer warmen Nacht in Bordeaux brüllen sie nicht „Sieg!“, sie rufen „Hu!“ Ein Fortschritt. Und ein Hinweis darauf, dass die Welt doch noch nicht untergeht.
Killer-Sprache im Sportjournalismus – nicht nur zur EM: „Instinktlos“
Bei großen Sportereignissen kennen Sportjournalisten keine Freunde mehr, zumindest in der Sprache. „Kein Killerinstinkt“ titelte die FAZ, oft für den besten Sportjournalismus ausgezeichnet, einen Bericht über die Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ein Leser empörte sich – nicht nur über den „Killerinstinkt“, sondern auch über den Tag, an dem die Überschrift in seine Zeitung kam:
Instinktlos
Wer ist nicht entsetzt über die brutalen Hooligans bei der Europameisterschaft in Frankreich, und Sie überschreiben in Ihrer Ausgabe vom 15. Juni einen Artikel über die Schweizer Fußballmannschaft dick mit „Kein Killerinstinkt“. Welch unerhörte Instinkt- und Verantwortungslosigkeit!
Schon vor der Europameisterschaft war der „Killerinstinkt“ in die Sport-Sprachmode gekommen. „Kein Killerinstinkt“ überschrieb Sport-Bild einen Online-Bericht im Februar, nachdem sich Eintracht Frankfurt und der HSV in der Bundesliga torlos verabschiedet hatten.
Auch Trainer mögen „Kein Killerinstinkt“: Jose Mourinho klagte so medienwirksam, nachdem sein FC Chelsea nur 1:1 in Istanbul gespielt hatte; wenig später wurde er entlassen.
Auch Sportler mögen den „Killerinstinkt“. Die FAZ zitierte Roger Federer im März 2014 vor einem Tennismatch mit seinem Freund Tommy Haas: „Gegen einen Freund ist der Killerinstinkt nicht so da.“ NBA-Star Stephen Curry erzählt, wie er sich verwandelt: „Wenn ich spiele, bin ich eine ganz andere Persönlichkeit. Dann bin ich konzentriert, verbissen und hungrig nach Erfolg. Diesen Killerinstinkt brauchst du, dann respektieren dich deine Mitspieler und der Gegner.“
Selbst in solch friedlicher Sportart wie Volleyball vermisst der Bundestrainer den nötigen Killerinstinkt (vor wenigen Tagen in der FAZ).
Martialische Sprachbilder waren gebräuchlich im Sportjournalismus, aber sie sind weitgehend aus dem Wortschatz verschwunden. In diesem Blog war die Sprache des Sports beim vorletzten Großereignis, der WM in Brasilien, schon mal ein Thema:
Zur Ehrenrettung der Sportreporter sei angefügt: Vor einigen Jahrzehnten waren die Bilder vom Krieg und vom Lärm der Schlachten noch übermächtig; heute verschwinden sie gemächlich aus dem Wortschatz der Sportjournalisten, in deren Reihen sich offenbar mehr Friedensfreunde tummeln als Leutnants.
Heute suchen Sportreporter ihre Sprachbilder eher in der Bibel. „Griezmann erlöst Frankreich“, schrieb die Süddeutsche Zeitung nach dem EM-Sieg gegen Irland in der Vorrunde. Nach der Erlösung kam „Im Fegefeuer“: So titelte die SZ in derselben Ausgabe einen Bericht über die italienische Mannschaft.
Buße, um nicht ins Fegefeuer zu kommen, leistete die FAZ-Redaktion vorbildlich: Sie veröffentlichte den kritischen Leserbrief, und sie veröffentlichte ihn ungewöhnlich schnell.
Die Pressekodex-Verweigerer in Sachsen und auf der Alb und Artikel 3 des Grundgesetzes

Chefredakteur Uwe Vetterick nennt in der „Sächsischen Zeitung“ bei Straftätern die Nationalität – ob Ausländer oder Deutscher (Foto: Ronald Bonß für „Sächsische Zeitung“)
Der Tweet kam am Samstag kurz nach Mitternacht: „Warum die Sächsische Zeitung künftig die Nationalität von Straftätern nennt.“ Der Tweet verwies auf „Fakten gegen Gerüchte“, einem Online- Beitrag von Oliver Reinhard, Kulturredakteur der Sächsischen Zeitung. Darin stehen die provokanten Sätze:
Wir haben nach durchaus kontroversen Diskussionen beschlossen, uns bei der Berichterstattung über Ausländerkriminalität ab heute nicht mehr an die Richtlinie des Deutschen Presserates zu halten. Stattdessen werden wir künftig die Herkunft von Straftätern oder Verdächtigen in jedem Fall angeben. Egal, ob es sich dabei um Deutsche handelt, was die Regel ist, oder um Ausländer.
Weit entfernt von der Pegida-Hochburg Dresden, am anderen Ende der Republik, hatte die Schwäbische Post schon vor einem Jahr mit der Regel gebrochen. „Wir nennen die Nationalität auch bei Ladendiebstählen“, schrieb Chefredakteur Lars Reckermann in einem Beitrag für die Drehscheibe:
„In fast jeder Polizeimeldung bei Ladendiebstählen wurden Algerier von der Polizei benannt. Anfangs haben wir den Pressekodex noch eins zu eins umgesetzt. Dann haben wir aber entschieden, dass wir damit eigentlich eine Nachricht verschweigen. Ja, es gibt das Problem mit zunehmenden Ladendiebstählen – und das hatte auch einen Grund. Wir haben neben der Polizei auch mit einigen Ladenbesitzern gesprochen und bekamen den Eindruck bestätigt. Also nennen wir die Nationalität.“
Die kress.de-Kolumne „Journalismus!“ thematisiert in dieser Woche die Pressekodex-Richtlinie 12.1.und berichtet über eine Tagung der deutschen Ombudsleute im Sauerland, die auch über die Richtlinie debattierte. Dort wunderte sich Thorsten Spiegel über die Debatte; er ist für Recht und Sicherheit im Plettenberger Rathaus zuständig und war Gast der Runde. Er verwies auf den Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem noch schärfer und ausführlicher ein Verbot der Diskriminierung ausgesprochen wird:
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Dieser Verfassungs-Artikel binde, so Thorsten Spiegel, zwar erst einmal nur den Staat, aber: Warum sollten sich Redaktionen nicht an diese Norm halten?
RICHTLINIE 12.1 – BERICHTERSTATTUNG ÜBER STRAFTATEN
In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.
Wahrscheinlich hatten sich auch die Autoren des Pressekodex Anfang der siebziger Jahre am Grundgesetz orientiert und die wichtigen Regeln des Staates als die Regeln der Presse übernommen.
Mehr: Wir sind keine Anti-Pegida
Eine Chronik als Vorbild-Reportage: Das Elfmeterschießen als Drama in 18 Akten
Die Chronik passt weder zur Nachricht noch zur Reportage: Im ersten Satz fährt das Auto auf der Kreisstraße, im letzten Satz ist der Fahrer tot.
Eine Ausnahme ist nicht nur zulässig, sondern auch notwendig: Wenn die Spannung der Reportage im Ablauf liegt – wie beim Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien.
Die 280-Zeilen-Reportage von Michael Horeni in der FAZ ist eine vorbildliche Reportage: „Die Nacht des schwarzen Riesen. Ein Drama in 18 Akten“. Der Reporter folgt dem Ablauf des Dramas: Jeder Schuss ein Akt.
Viele haben das Elfmeterschießen gesehen – und sind trotzdem mitgerissen von Horenis Schilderung. Der Reporter schaut auf die Akteure: Wie gehen sie zum Punkt? Wie legen sie den Ball hin? Wie kehren sie zurück? Was sieht er in den Gesichtern der Torhüter, dem schwarzen Riesen und dem Mann in Rot? Der Reporter kennt die Geschichte der Spieler, er erzählt kleine Geschichten: Wie war es 1976, als Hoeneß den Ball in den Belgrader Himmel schoß? Wie beim deutschen Pokalfinale?
Ein Beispiel aus der Reportage:
Buffon tänzelt wieder wie ein Boxer, die Arme hängend wie Ali, der auf den Schlag des Gegners wartet. Müller will Buffon verladen, schießt nach rechts, nicht hart, nicht platziert. Das rote Trikot ist da, wo der Ball hinkommt. Müller irrt im Strafraum herum, einsam, mit gesenktem Kopf. Es ist nicht sein Turnier. Immer noch 1:1.
Das Elfmeterschießen läuft noch einmal wie ein Film vor dem Leser ab – mit neuen Szenen und mit Tiefenschärfe: Wir sehen etwas, was wir live nicht gesehen haben. Wir sehen mehr.
Der Reporter vertraut den Verben, fast drei Dutzend verschiedene allein in den ersten vier Akten. Es sind meist dynamische Verben: toben, schießen, anlaufen, hüpfen, (Hände) schlagen, fliegen, lahmlegen, wegdrehen, springen, hochjagen, tänzeln, herumirren. Die Substantive, meist Namen und Fußballjargon, sind die Pflicht, die Verben sind die Kür; Adjektive kommen kaum vor.
Besser kann Journalismus nicht sein: Wir sehen ein Spiel, das wir selber gesehen haben, mit anderen Augen – und wir staunen, und wir verstehen, was wirklich geschah.
Wie EM-Reporter die deutsche Sprache verhunzen: Ein Fall für die „medizinische Abteilung“ (Friedhof der Wörter)

Die Moderatoren-Stars bei der EM 2016: Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis. (Foto: ARD)
Seit drei Wochen schleichen Fußballer vom Rasen – mit „muskulären Problemen“. So näseln TV-Moderatoren, so äffen es Zeitungsreporter nach. Sogar Nachrichtenredakteure beugen sich: Mario Gomez, so schreibt die FAZ heute, war „mit muskulären Problemen vom Platz gehumpelt“.
Schleicht Euch!, möchte man den Journalisten zurufen, die solch einen Unsinn reden und schreiben. Das deutsche Wort für Adjektiv heißt „Eigenschaftswort“: Also ist „muskulär“ die Eigenschaft des Problems? Nein, das Problem hat keine Muskeln, aber die Muskeln haben ein Problem.
Problematische Muskeln wäre richtig, aber schräg. Adjektive sind die am meisten überschätzte Wortart: Auf sie in neun von zehn Fällen zu verzichten, ehrt den Journalisten. Als Alternative bietet sich fast immer das zusammengesetzte Substantiv an – ein Vorzug der deutschen Sprache im Vergleich zu den meisten anderen.
Aber in der Begeisterung, alles, auch Unsinn, aus der englischen Sprache zu nehmen, zertrümmern wir unsere Substantive: „Muscular problems“ sagt der englische Reporter, wenn einer der Stars dahinhumpelt. „Muskelprobleme“ ist das deutsche Wort, ohne Adjektiv, dafür sofort verständlich.
Im Kuppeln von Substantiven ist die deutsche Sprache der englischen überlegen. „In Fahrtrichtung rechts“, sagt der Schaffner im Zug, damit wir die richtige Tür wählen. „In the direction of travel“, wiederholt er: Drei Wörter statt einem.
Und wer kümmert sich um die Muskelprobleme? Der Arzt? Nein, die „medizinische Abteilung“, weiß der TV-Reporter. Schleicht Euch!
**
Quelle: FAZ 4. Juli 2016 („Deutschland im Halbfinale ohne Khedira“)
Deutschlands beste kleine Zeitung kommt aus Marburg (150 Jahre Oberhessische Presse)
Die Oberhessische Presse dürfte die bedeutendste kleine Zeitung in der deutschen Provinz sein: Dreimal empfahl sie sich für die Ruhmeshalle der Zeitungsgeschichte:
Es begann in den achtziger Jahren, als alle Zeitungen in Deutschland Generalanzeiger waren. Eine Zeitung galt als Generalanzeiger, wenn in ihm dieselben Nachrichten standen, wie am Abend zuvor in der Tagesschau zu sehen waren; wenn der Aufmacher auf der Titelseite derselbe war wie der Aufmacher der Tagesschau, sprach man von Qualität. Den Lokalteil nahm keiner ernst.
Die Oberhessische Presse hatte in diesem Sinne keine eigene Qualität: Die Universitätsstadt kaufte den Mantel aus dem ländlichen Wetzlar, der war preiswert, aber nicht gut. Die Entscheidung des Verlegers, Mitte der achtziger Jahre in Marburg selbst den Mantel zu produzieren, war einmalig und revolutionär – aber gar nicht so teuer. Der gerade entwickelte Ganzseiten-Umbruch, ganz schlicht mit XY-Koordinaten, half der Geschäftsführung, auf einen großen Teil der technischen Vorstufe zu verzichten und in die Redaktion zu verlagern: Die Rationalisierung brachte Geld, das zum Teil in die Erweiterung der Redaktion gesteckt wurde.
Die Redaktion dachte nach, wie eine moderne Zeitung auszusehen hat, sie brach mit der Tradition des Generalanzeigers und nahm die wichtigen lokalen und regionalen Nachrichten auf die Titelseite und in das erste Buch: Ein neuer Typus von Zeitung entstand (parallel auch bei der Emder Zeitung an der Nordsee), von der Branche als das „Ende der Qualitätszeitung“ verspottet. Der Erfolg gab und gibt der Redaktion Recht: Die Auflage stieg zweistellig – und ein Vierteljahrhundert später preist die Branche das Lokale als die Rettung der Zeitung, auf Papier wie im Netz.
Den zweiten Eintrag in die Ruhmeshalle der Zeitungen schaffte die selbstbewusste und starke Redaktion mit ungewöhnlichen Themen und Serien: Sie gewann damals zweimal den Deutschen Lokaljournalistenpreis, was zuvor erst einer Redaktion in Deutschland gelungen war. Wer diesen Preis bekommt, darf sich ein Jahr lang als beste deutsche Lokalzeitung rühmen. (Bis heute hat die OP den Preis sieben Mal gewonnen.)
Guntram Dörr, heute Chefredakteur in Nordhorn, holte den ersten Preis mit einer Serie über Selbsthilfegruppen – damals ein neues Phänomen in einer Gesellschaft, die sich zunehmend auf ihre eigenen Kräfte besann, Solidarität übte und den Staat beiseite schob. Zum zweiten Mal holte die Redaktion den Preis mit der kritischen und ungewöhnlich ausführlichen Berichterstattung über Wahlen – als Hochfest der Demokratie.
Für prominente CDU-Politiker in Marburg war die Wahl-Berichterstattung zu kritisch: Sie verlangten vergeblich von der Adenauer-Stiftung, den Preis der OP abzuerkennen, und blieben aus Protest der Verleihung im Marburger Schloss fern.
Zudem gab es einige Sonderpreise, herausragend darunter Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“, die einmalig blieb und die Dieter Golombek, der Jury-Vorsitzende, so pries: „Dieses Projekt sprengt jeden Rahmen, es ist der gelungene Großversuch, das kunstvoll geknüpfte Netz der Macht in einer 80 000-Einwohner-Stadt zu beschreiben.“
Solch großer Journalismus in der Provinz musste über den Tag hinaus bewahrt werden: So entstand die Buch-Reihe „OP Report“, die dreizehn Mal erschien, mit Titeln wie „Selbsthilfegruppen“, „Wählen gehen“, „Macht in Marburg“, aber auch „Die rote Uni“, „Aktuelles Arbeitsrecht“ – oder „Schüler lesen“ mit Dokumentationen des ersten Zeitungsprojekts in Deutschland, das Till Conrad gemeinsam mit der Lehrerfortbildung eines Kultusministeriums organisiert hatte.
In die deutsch-deutsche Geschichte eingeflochten ist der dritte Eintrag in die Ruhmeshalle: Die Gründung der Eisenacher Presse in Marburgs Partnerstadt – die erste deutsch-deutsche Zeitung im Januar 1990, noch zu DDR-Zeiten, im Eisenacher „Haus der Dienste“ produziert, in Marburg gedruckt und mit 30 000 Exemplaren in wenigen Stunden verkauft. Die abenteuerliche Geschichte der Redaktion, der Zeitung und der Einheit ist mehrfach beschrieben, so im Buch „Aufbrüche und Umbrüche“ von Andreas Apelt und in meiner deutsch-deutschen Geschichte „Die unvollendete Revolution“.
Es dürfte kaum eine aufregendere kleine Zeitung in Deutschland geben: Das Beste, was die Provinz zu bieten hat, ohne provinziell zu sein. Wahrscheinlich ist auch die aktuelle Entwicklung der OP einen Eintrag wert: Statt diesen Zeitungs-Kleinod in einem Konzern untergehen zu lassen, wie es einigen Zeitungen widerfuhr, kaufte der Verleger seine Zeitung zurück – zum Wohle Marburgs und der Region, zum Wohle der Leser und der Redakteure und zum Wohle der Demokratie, die eine kräftige Stimme gerade dort braucht, wo die Heimat der Bürger ist.
Die preisgekrönteste kleine Redaktion in Deutschland
- 2014 Deutscher Lokaljournalistenpreis in der Kategorie Foto für die crossmediale Serie „Ich und Ich“.
- 2014 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2014“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für das Jahresprojekt „Besser Esser“ (1. Platz).
- 2013 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2013“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „Das schaffe ich“ (2. Platz).
- 2012 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2012“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „100 Leute, 100 Leben“ (2. Platz).
- 2010 Hessischer Jungjournalistenpreis für Nadine Weigel (heute Foto- und Videoredaktion) für ihren Text- und Video-Beitrag „Pomade und Petticoat“.
- 2009 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmedia-Design und -Branding“ für die Gießener Zeitung – Deutschlands erste Mitmachzeitung.
- 2008 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmediale Kampagnen” für die Oberhessische Presse.
- 1999 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für die Zukunftsserie „Marburg 2010“.
- 1995 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“
- 1993 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Berichterstattung zu den Kommunal- und Bürgermeisterdirekt-Wahlen
- 1989 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für die Serie „Der Fall Löser“
- 1988 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für das Konzept
- 1986 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Serie „Selbsthilfegruppen“
**
Der Beitrag erschien in der Oberhessischen Presse am 16. Juni 2016 zum 150-Jahr-Jubiläum; hier leicht verändert und erweitert. Der Autor war von 1985 bis 1995 Chefredakteur der OP und von 1990 bis 1994 auch der Eisenacher Presse.
Kulturpessimismus? Soziale Netzwerke überholen Zeitungen (Zitat der Woche)
Aus Scheiße wird nicht Gold, nur weil es gedruckt steht – und andersherum genauso wenig. Ich dachte eigentlich, dass dieser Kulturpessimismus endlich abgehakt wäre.
Andreas Weck im Blog „Aufgeweckt“ zur Umfrage „Soziale Netzwerke überholen Zeitungen als Nachrichtenquelle“.
Wer ist der Mann auf dem Brexit-Foto? Ein Handelsblatt-Chef! Regeln für Fotografen und Redakteure

Dies Foto von Matthias Brüggmann sendete EPA/dpa mit der Zeile:„A man reacts to a vote count results screen at an ‚Leave.EU Referendum Party‘ in London, Britain, 23 June 2016. Britons await the results on whether they remain in, or leave the European Union (EU) after a referendum on 23 June.“ Das Foto ist mittlerweile gelöscht.
Journalisten gehen bisweilen recht seltsame Recherche-Wege: Matthias Brüggmann, Handelsblatt-Auslandschef, mischte sich in London unter jubelnde Brexit-Anhänger auf der Ukip-Wahlparty. Sein Porträtbild mit Nationalfarben-Papphut auf dem Kopf sendeten Reuters, AP und andere Agenturen rund um die Welt.
Brüggmann ließ offenbar Fotografen wie Reporter im Unklaren, wer er wirklich sei. Brüggmann auf Handelsblatt online:
Ich habe es sogar in den Aufmacher der Onlineausgabe des Londoner „Evening Standard“ geschafft – eine verrückte Geschichte. Und sie lässt tief blicken in Britanniens Medienlandschaft…
Fast alle Boulevard-Blätter und Gratis-Tabloids wollten ein Interview mit mir als vermeintlichem Brexit-Fan. Ungefragt nutzen sie nun die Bilder für ihre Geschichten…
Die britischen Medien fotografieren und filmen einfach, und veröffentlichen die Bilder mit ihren Geschichten dazu – ohne je gefragt zu haben, wer derjenige auf dem Bild ist. So bereut man dann angeblich, für Brexit gestimmt zu haben, ohne jemals auch nur in England stimmberechtigt gewesen zu sein.“
Drei Fragen zur journalistischen Moral schließen sich an:
- Darf sich ein Journalist in eine Wahlparty anonym einschleichen, um an Informationen zu kommen?
- Darf er anonym bleiben, wenn er selbst Objekt von Recherchen anderer Journalisten wird – oder muss er sie aufklären?
- Soll er sich über Fotografen und Reporter nachher lustig machen?
Die Antworten:
Zu 1) Ja
Zu 2) Nein, zumal der Ertrag der Recherche überaus dürftig war.
Zu 3) Das ist überheblich und hoffentlich nicht typisch deutsch.
Und wie gehen Redaktionen mit einem solchen Bild um? dpa war die einzige Agentur, die den unbekannten Mann auf dem Bild nicht als Brexit-Befürworter auswies, sondern geradezu britisch unterkühlt schrieb:
A man reacts to a vote count results screen at an ‚Leave.EU Referendum Party‘ in London, Britain, 23 June 2016. Britons await the results on whether they remain in, or leave the European Union (EU) after a referendum on 23 June.
Das Foto haben mittlerweile alle Agenturen gelöscht.
Dies sind die Regeln für Fotografen und Redakteure, denen auch dpa-Nachrichtenchef Froben Homburger folgt:
- Wer gezielt, quasi porträthaft, Personen oder kleinere Personengruppen fotografiert, gibt sich als Fotograf zu erkennen, der für Medien arbeitet.
- Er fragt nach den Namen und dem Grund, warum sie an diesem Ort sind.
- Es gibt Ausnahmen, etwa Großveranstaltungen wie die Fußball-Europameisterschaft: Dort kann man Fans, bisweilen bunt gekleidet, nicht jedes Mal fragen, ob sie tatsächlich Fußballfans des Landes sind, dessen Trikot sie tragen.
- In Zweifelsfällen steht in der Bildzeile präzise nur das, was die Redaktion ganz sicher weiß.
Bye-bye, Britain – Schlagzeilen nach dem Brexit: Wieviel Meinung verträgt der Titel?
So kennen wir die taz: Verspielt, ironisch bis leicht hämisch mit der Schlagzeile auf der Titelseite. Die taz? Am Tag nach dem Brexit titelte „Bye-bye, Britain“ die Süddeutsche Zeitung (Duden-affin) – um auf den folgenden Seiten zur Sache zurückzukehren. Die taz dagegen blieb für ihre Verhältnisse zurückhaltend: „Well done, little Britain“.
Ähnlich wie die Süddeutsche Zeitung spielte die Thüringische Landeszeitung (TLZ): „Bye, bye, Europa“ (nicht Duden-affin) – allerdings nicht in der Überschrift, sondern in einer Nel-Karikatur oben auf der Titelseite. Die Überschrift darunter war im Tagesschau-Stil, regional gewendet: „Brexit verunsichert die Thüringer Wirtschaft“.
Wieviel Kommentar verträgt eine Schlagzeile? Wieviel Spiel? Wieviel Ironie?
Der Boulevard braucht das Spiel, die Ironie, er will reizen, gar verletzen. Die Bildzeitung spielt nach dem Brexit mit der Sprache und schreibt in riesigen Lettern „OUTsch!“
Die taz hatte nie Probleme mit diesen Fragen. Als Weltanschauungs-Zeitung spielt und kommentiert sie in der Zeile, bis es dem Gegner weh tut – wie etwa der katholischen Kirche mit dem „Balken-Sepp“ nach dem Kruzifix-Urteil – und bis der Presserat die Rüge aus dem Sack holt.
Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und die FAZ machen es gelegentlich. Die FAZ hat sich ein neues Meinungs-Stilmittel oben auf der Titelseite einfallen lassen: Nachdem das Bilderverbot für Seite Eins gefallen war, spielt sie über der Aufmacher-Schlagzeile mit einem Bild oder einer Grafik, das kommentierend bis ironisch auf eine Geschichte im Innenteil verweist – ein grafisches Streiflicht.
Die nationalen Zeitungen, die sich „Qualitätszeitungen“ nennen, formulieren in der Regel sachliche Überschriften im Tagesschau-Stil – bis es staubt. Sie verstehen sich, wie auch die meisten Regionalzeitungen, als pädagogische Anstalt, die dem Leser ein historisches Ereignis markieren: Pass auf, so wird es auch in den Geschichtsbüchern stehen! Die Oberstudienrätin freut sich, alle anderen sind gelangweilt.
Das „Neue Handbuch des Journalismus“ postuliert es ähnlich und appelliert an den Redakteur:
- Er möge den Willen haben, politische Nachrichten mit strikt unparteiischen Überschriften zu versehen.
- Über der politischen Nachricht ist Ironie deplatziert.
Ist dieser Appell in digitalen Zeiten noch zeitgemäß, wenn jeder, auch wirklich jeder die Nachricht kennt und vieles dazu? Allerdings raten Online-Redakteure zu eher sachlichen Überschriften und nicht zu feuilletonistischem Überschwang, der den Leser und Google verstört.
Vielleicht sind grafische Lösungen zeitgemäß, wie sie skandinavische Zeitungen mögen – wie die dänische Jyllands-Posten nach dem Brexit: Nahezu die komplette Titelseite mit den EU-Sternen im Kreis; ein Stern fehlt:
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?






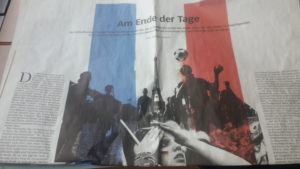
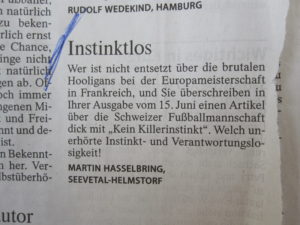





 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von