Interviewer bei Despoten: Stichwort-Kastraten oder Diplomaten, die mit dem Teufel lächeln?
Journalisten, die sich als Medienkritiker verstehen, gehen selten verständnisvoll mit Journalisten um, die keine Medienkritiker sind. Gespalten sind sie in der Einschätzung von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk, der mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan ein ARD-Interview führte:
- „Stichwort-Kastrat“ nennt ihn Tomas Avenarius in der Süddeutschen Zeitung: „Gottlieb plaudert sich einfühlsam nickend wie ein Psychotherapeut durch das halbstündige Interview. Avenarius beurteilt wie die Mehrheit der Kritiker den Interviewer als devot und unkritisch ein und reiht Gottlieb ein „mit anderen verständnisvollen Befragern ungezügelter Machtmenschen: Jürgen Todenhöfer bei Baschar al-Assad, Claus Kleber bei Mahmuf Ahmadineschad, Hubert Seipel bei Wladimir Putin“; er kommt zu dem Schluss: „Alles keine Sternstunden des deutschen Fernsehens.“
- „Die Taktik von Gottlieb war gar nicht schlecht“, kommentiert dagegen Michael Hanfeld in der FAZ. „Er trat schon fast übertrieben freundlich auf, fiel nicht mit der Tür ins Haus und fragte eher um die Ecke. Etwa durch den Hinweis, dass Erdogan auf den Putsch ja erstaunlich schnell reagiert habe – ganz so, als habe er nur auf ihn gewartet.“ Hanfeld gibt zu bedenken, dass nach drei Minuten das Interview zu Ende gewesen wäre, hätte Gottlieb mit den ersten Fragen „gleich klare Kante“ gezeigt.
- „Erdogan interessierte mich mehr als der Journalist“, schreibt Franz Josef Wagner in der Bildzeitung. „Die Person Erdogan ist so bestürzend sicher. Er hat überhaupt keine Vorstellung davon, nicht Erdogan zu sein.“ Wagner geht auch auf die Frage ein, ob man überhaupt einen Diktator interviewen solle. „Natürlich. Selbst den Teufel, wenn er in ein Interview einwilligt… Mit dem Teufel lächeln – Gott, für ein Interview lächelte ich selbst mit dem Teufel.“
Die Bildzeitung korrigierte auf derselben Seite Erdogans Irrtümer: „So führte der Türken-Präsident die deutschen TV-Zuschauer hinters Licht.“
**
Quellen: SZ, FAZ, Bild, alle vom 27. Juli 2016
Müssen Journalisten vor den Live-Bildern der sozialen Medien kapitulieren?
Die Funktion von Journalisten in Abgrenzung zu den sozialen Medien: Zu verifizieren, zu recherchieren, einzuordnen und auszuwählen.
Kai Gniffke, Chef von ARD-aktuell, im Interview mit Ursula Scheer (FAZ) gegen den Vorwurf, dass Live-Videos im Netz – bei dem Attentat in Nizza beispielsweise – einfach schneller seien und ARD und ZDF den Rang ablaufen. Müssen die Sender und Journalisten überhaupt ihre ethischen Standards brechen? Ein Problem, antwortet Gniffke:
Wir zeigen keine sterbenden Menschen, wir zeigen keine rohe Gewalt. Aber was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.
Kai Gniffke bleibt dennoch optimistisch:
Menschen suchen weiterhin Einordnung durch Institutionen, die sie kennen… Ich denke, dass das normale lineare Fernsehen stärker bleiben wird, als ich selbst das vor zehn Jahren geglaubt habe.
**
Quelle: FAZ 19. Juli 2016 „Wir dürfen nicht einfach draufhalten“
Killer-Sprache im Sportjournalismus – nicht nur zur EM: „Instinktlos“
Bei großen Sportereignissen kennen Sportjournalisten keine Freunde mehr, zumindest in der Sprache. „Kein Killerinstinkt“ titelte die FAZ, oft für den besten Sportjournalismus ausgezeichnet, einen Bericht über die Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ein Leser empörte sich – nicht nur über den „Killerinstinkt“, sondern auch über den Tag, an dem die Überschrift in seine Zeitung kam:
Instinktlos
Wer ist nicht entsetzt über die brutalen Hooligans bei der Europameisterschaft in Frankreich, und Sie überschreiben in Ihrer Ausgabe vom 15. Juni einen Artikel über die Schweizer Fußballmannschaft dick mit „Kein Killerinstinkt“. Welch unerhörte Instinkt- und Verantwortungslosigkeit!
Schon vor der Europameisterschaft war der „Killerinstinkt“ in die Sport-Sprachmode gekommen. „Kein Killerinstinkt“ überschrieb Sport-Bild einen Online-Bericht im Februar, nachdem sich Eintracht Frankfurt und der HSV in der Bundesliga torlos verabschiedet hatten.
Auch Trainer mögen „Kein Killerinstinkt“: Jose Mourinho klagte so medienwirksam, nachdem sein FC Chelsea nur 1:1 in Istanbul gespielt hatte; wenig später wurde er entlassen.
Auch Sportler mögen den „Killerinstinkt“. Die FAZ zitierte Roger Federer im März 2014 vor einem Tennismatch mit seinem Freund Tommy Haas: „Gegen einen Freund ist der Killerinstinkt nicht so da.“ NBA-Star Stephen Curry erzählt, wie er sich verwandelt: „Wenn ich spiele, bin ich eine ganz andere Persönlichkeit. Dann bin ich konzentriert, verbissen und hungrig nach Erfolg. Diesen Killerinstinkt brauchst du, dann respektieren dich deine Mitspieler und der Gegner.“
Selbst in solch friedlicher Sportart wie Volleyball vermisst der Bundestrainer den nötigen Killerinstinkt (vor wenigen Tagen in der FAZ).
Martialische Sprachbilder waren gebräuchlich im Sportjournalismus, aber sie sind weitgehend aus dem Wortschatz verschwunden. In diesem Blog war die Sprache des Sports beim vorletzten Großereignis, der WM in Brasilien, schon mal ein Thema:
Zur Ehrenrettung der Sportreporter sei angefügt: Vor einigen Jahrzehnten waren die Bilder vom Krieg und vom Lärm der Schlachten noch übermächtig; heute verschwinden sie gemächlich aus dem Wortschatz der Sportjournalisten, in deren Reihen sich offenbar mehr Friedensfreunde tummeln als Leutnants.
Heute suchen Sportreporter ihre Sprachbilder eher in der Bibel. „Griezmann erlöst Frankreich“, schrieb die Süddeutsche Zeitung nach dem EM-Sieg gegen Irland in der Vorrunde. Nach der Erlösung kam „Im Fegefeuer“: So titelte die SZ in derselben Ausgabe einen Bericht über die italienische Mannschaft.
Buße, um nicht ins Fegefeuer zu kommen, leistete die FAZ-Redaktion vorbildlich: Sie veröffentlichte den kritischen Leserbrief, und sie veröffentlichte ihn ungewöhnlich schnell.
Eine Chronik als Vorbild-Reportage: Das Elfmeterschießen als Drama in 18 Akten
Die Chronik passt weder zur Nachricht noch zur Reportage: Im ersten Satz fährt das Auto auf der Kreisstraße, im letzten Satz ist der Fahrer tot.
Eine Ausnahme ist nicht nur zulässig, sondern auch notwendig: Wenn die Spannung der Reportage im Ablauf liegt – wie beim Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien.
Die 280-Zeilen-Reportage von Michael Horeni in der FAZ ist eine vorbildliche Reportage: „Die Nacht des schwarzen Riesen. Ein Drama in 18 Akten“. Der Reporter folgt dem Ablauf des Dramas: Jeder Schuss ein Akt.
Viele haben das Elfmeterschießen gesehen – und sind trotzdem mitgerissen von Horenis Schilderung. Der Reporter schaut auf die Akteure: Wie gehen sie zum Punkt? Wie legen sie den Ball hin? Wie kehren sie zurück? Was sieht er in den Gesichtern der Torhüter, dem schwarzen Riesen und dem Mann in Rot? Der Reporter kennt die Geschichte der Spieler, er erzählt kleine Geschichten: Wie war es 1976, als Hoeneß den Ball in den Belgrader Himmel schoß? Wie beim deutschen Pokalfinale?
Ein Beispiel aus der Reportage:
Buffon tänzelt wieder wie ein Boxer, die Arme hängend wie Ali, der auf den Schlag des Gegners wartet. Müller will Buffon verladen, schießt nach rechts, nicht hart, nicht platziert. Das rote Trikot ist da, wo der Ball hinkommt. Müller irrt im Strafraum herum, einsam, mit gesenktem Kopf. Es ist nicht sein Turnier. Immer noch 1:1.
Das Elfmeterschießen läuft noch einmal wie ein Film vor dem Leser ab – mit neuen Szenen und mit Tiefenschärfe: Wir sehen etwas, was wir live nicht gesehen haben. Wir sehen mehr.
Der Reporter vertraut den Verben, fast drei Dutzend verschiedene allein in den ersten vier Akten. Es sind meist dynamische Verben: toben, schießen, anlaufen, hüpfen, (Hände) schlagen, fliegen, lahmlegen, wegdrehen, springen, hochjagen, tänzeln, herumirren. Die Substantive, meist Namen und Fußballjargon, sind die Pflicht, die Verben sind die Kür; Adjektive kommen kaum vor.
Besser kann Journalismus nicht sein: Wir sehen ein Spiel, das wir selber gesehen haben, mit anderen Augen – und wir staunen, und wir verstehen, was wirklich geschah.
Wie EM-Reporter die deutsche Sprache verhunzen: Ein Fall für die „medizinische Abteilung“ (Friedhof der Wörter)

Die Moderatoren-Stars bei der EM 2016: Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis. (Foto: ARD)
Seit drei Wochen schleichen Fußballer vom Rasen – mit „muskulären Problemen“. So näseln TV-Moderatoren, so äffen es Zeitungsreporter nach. Sogar Nachrichtenredakteure beugen sich: Mario Gomez, so schreibt die FAZ heute, war „mit muskulären Problemen vom Platz gehumpelt“.
Schleicht Euch!, möchte man den Journalisten zurufen, die solch einen Unsinn reden und schreiben. Das deutsche Wort für Adjektiv heißt „Eigenschaftswort“: Also ist „muskulär“ die Eigenschaft des Problems? Nein, das Problem hat keine Muskeln, aber die Muskeln haben ein Problem.
Problematische Muskeln wäre richtig, aber schräg. Adjektive sind die am meisten überschätzte Wortart: Auf sie in neun von zehn Fällen zu verzichten, ehrt den Journalisten. Als Alternative bietet sich fast immer das zusammengesetzte Substantiv an – ein Vorzug der deutschen Sprache im Vergleich zu den meisten anderen.
Aber in der Begeisterung, alles, auch Unsinn, aus der englischen Sprache zu nehmen, zertrümmern wir unsere Substantive: „Muscular problems“ sagt der englische Reporter, wenn einer der Stars dahinhumpelt. „Muskelprobleme“ ist das deutsche Wort, ohne Adjektiv, dafür sofort verständlich.
Im Kuppeln von Substantiven ist die deutsche Sprache der englischen überlegen. „In Fahrtrichtung rechts“, sagt der Schaffner im Zug, damit wir die richtige Tür wählen. „In the direction of travel“, wiederholt er: Drei Wörter statt einem.
Und wer kümmert sich um die Muskelprobleme? Der Arzt? Nein, die „medizinische Abteilung“, weiß der TV-Reporter. Schleicht Euch!
**
Quelle: FAZ 4. Juli 2016 („Deutschland im Halbfinale ohne Khedira“)
Bye-bye, Britain – Schlagzeilen nach dem Brexit: Wieviel Meinung verträgt der Titel?
So kennen wir die taz: Verspielt, ironisch bis leicht hämisch mit der Schlagzeile auf der Titelseite. Die taz? Am Tag nach dem Brexit titelte „Bye-bye, Britain“ die Süddeutsche Zeitung (Duden-affin) – um auf den folgenden Seiten zur Sache zurückzukehren. Die taz dagegen blieb für ihre Verhältnisse zurückhaltend: „Well done, little Britain“.
Ähnlich wie die Süddeutsche Zeitung spielte die Thüringische Landeszeitung (TLZ): „Bye, bye, Europa“ (nicht Duden-affin) – allerdings nicht in der Überschrift, sondern in einer Nel-Karikatur oben auf der Titelseite. Die Überschrift darunter war im Tagesschau-Stil, regional gewendet: „Brexit verunsichert die Thüringer Wirtschaft“.
Wieviel Kommentar verträgt eine Schlagzeile? Wieviel Spiel? Wieviel Ironie?
Der Boulevard braucht das Spiel, die Ironie, er will reizen, gar verletzen. Die Bildzeitung spielt nach dem Brexit mit der Sprache und schreibt in riesigen Lettern „OUTsch!“
Die taz hatte nie Probleme mit diesen Fragen. Als Weltanschauungs-Zeitung spielt und kommentiert sie in der Zeile, bis es dem Gegner weh tut – wie etwa der katholischen Kirche mit dem „Balken-Sepp“ nach dem Kruzifix-Urteil – und bis der Presserat die Rüge aus dem Sack holt.
Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und die FAZ machen es gelegentlich. Die FAZ hat sich ein neues Meinungs-Stilmittel oben auf der Titelseite einfallen lassen: Nachdem das Bilderverbot für Seite Eins gefallen war, spielt sie über der Aufmacher-Schlagzeile mit einem Bild oder einer Grafik, das kommentierend bis ironisch auf eine Geschichte im Innenteil verweist – ein grafisches Streiflicht.
Die nationalen Zeitungen, die sich „Qualitätszeitungen“ nennen, formulieren in der Regel sachliche Überschriften im Tagesschau-Stil – bis es staubt. Sie verstehen sich, wie auch die meisten Regionalzeitungen, als pädagogische Anstalt, die dem Leser ein historisches Ereignis markieren: Pass auf, so wird es auch in den Geschichtsbüchern stehen! Die Oberstudienrätin freut sich, alle anderen sind gelangweilt.
Das „Neue Handbuch des Journalismus“ postuliert es ähnlich und appelliert an den Redakteur:
- Er möge den Willen haben, politische Nachrichten mit strikt unparteiischen Überschriften zu versehen.
- Über der politischen Nachricht ist Ironie deplatziert.
Ist dieser Appell in digitalen Zeiten noch zeitgemäß, wenn jeder, auch wirklich jeder die Nachricht kennt und vieles dazu? Allerdings raten Online-Redakteure zu eher sachlichen Überschriften und nicht zu feuilletonistischem Überschwang, der den Leser und Google verstört.
Vielleicht sind grafische Lösungen zeitgemäß, wie sie skandinavische Zeitungen mögen – wie die dänische Jyllands-Posten nach dem Brexit: Nahezu die komplette Titelseite mit den EU-Sternen im Kreis; ein Stern fehlt:
Risse im Rechtsstaat und Schwäche in der Demokratie
Was tun Zeitungen und Magazine, wenn unsere Demokratie schwächelt? Was setzen Lokaljournalisten, Reporter und Korrespondenten dagegen, wenn der Staat in einer Sinnkrise steckt?
Die Diagnose stellt mit Peter M. Huber ein Verfassungsrichter, geschrieben in einem Essay zum 25-Jahr-Jubiläum der Einheit vor einem Jahr, noch einmal zitiert heute in einem FAZ-Huber-Porträt:
Ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung steckt der durch das Grundgesetz verfasste Nationalstaat in einer Sinnkrise, der Rechtsstaat zeigt Erosionstendenzen, die Demokratie schwächelt, das Gewaltenteilungsgefüge hat sich weiter zugunsten der Exekutive verschoben, und die Entwicklung des Bundesstaats lässt eine Orientierung vermissen.
Die Therapie in den Medien ist eine Debatte wert, auch jenseits von AfD und Pegida. Die Presse und ihre Freiheit zählen zu den Grundrechten, also zu den Pfeilern, auf denen Staat und Demokratie stehen: Wer durch ein Grundrecht privilegiert ist, hat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Zu den Pflichten eines Journalisten zählt, die Demokratie zu stärken.
**
Quelle: FAZ, 1.10.2015
Hintergrund-Gespräche und Journalisten: Gauland und die AfD lernen noch
Wenn Politiker zu einem Hintergrund-Gespräch einladen, wollen sie Journalisten einfach nur die Welt erklären oder ein Thema in die Welt setzen, aber auf keinen Fall zitiert werden: „Unter drei“ heißt es im Fachjargon, also nichts ist zitierbar. Dass man Hintergrund-Gespräche auch lernen muss, beweisen hochrangige AfD-Politiker:
Ein Trio, allesamt Gegner von Vorsitzender Petry, lud ein Dutzend Journalisten ins Berliner Café Einstein ein: Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen, Vize-Vorsitzender Alexander Gauland und Thüringens Landesvorsitzender Björn Höcke. Offenbar erzählten die drei von ihren Putschversuchen gegen die Vorsitzende. FAZ-Redakteure berichten von der anschließenden Konfusion:
Am Donnerstag (am Tag danach) wollten die drei Herren dann einzelne Äußerungen, die in diesem Gespräch gefallen waren, zur Veröffentlichung freigeben. Gauland tat das, wie vereinbart. Wenige Stunden später jedoch zog er die bereits autorisierten Äußerungen wieder zurück, weil Höcke und Meuthen, anders als angekündigt, nun doch nicht zur Freigabe von Zitaten bereit waren.
Erstaunlich ist: Die Gauland-Äußerungen, offenbar einige Stunden zitierbar, postete keiner der zwölf anwesenden Redakteure ins Netz. Sind Berliner Korrespondenten komplett analog gestimmt?
Erstaunlich ist auch: Die FAZ schreibt, es gab ein Hintergrundgespräch, aber lässt die Leser im Unklaren, worum es konkret ging.
Dies Hintergrundgespräch beweist das Dilemma, in dem Politiker wie Journalisten stecken: Man hört Brisantes, aber darf es nicht verwerten; sind mehr als drei Journalisten anwesend, steigt die Gefahr, dass einer schreibt – eben weil es brisant ist; die Gefahr steigt, wenn ein Korrespondent aus einer großen Redaktion plaudert: Wird er vom nächsten Hintergrund ausgeschlossen, kommt ein anderer.
Die Variante, dass Politiker nachher autorisieren, ist nicht ungewöhnlich, aber widerspricht dem Charakter des Hintergrunds und führt leicht zu Missverständnissen – wie Gauland beweist.
Die AfD hat überhaupt ihre Probleme mit Journalisten und Autorisierungen, sie muss auch ,Interview üben‘:
- Frauke Petry sprach mit dem Mannheimer Morgen, autorisierte das Interview, in dem sie einen Schießbefehl gegen Flüchtlinge erwog, distanzierte sich später und prangerte die „Lügenpresse“ an (siehe Blog).
- Alexander Gauland sagte zu FAS-Redakteuren: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ Später wollte er es nicht oder nicht so gesagt haben.
**
Quelle: FAZ „In der Hitze der Macht“, 21. Juni 2016
Kurze Sätze! Zwei Meister der Verständlichkeit: Martin Luther und Mark Twain (Journalismus der Zukunft 19)

Luther ist ein Meister der Verständlichkeit: Er hätte WhatsApp und Twitter geschätzt – gerade wegen der Kürze, die für Würze sorgt: „Mach’s Maul auf! Tritt fest auf! Hör bald auf!“ (Zeichnung: Anke Krakow/TBM)
Keine langen Sätze, keine überflüssige Paranthesen – wie diese hier – und nur wenige Wörter zwischen dem ersten und zweiten Teil eines Verbs: Um die Verständlichkeit geht es im 19.und vorletzten Teil der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“. Zwei Meister der Verständlichkeit stehen im Mittelpunkt: Martin Luther und Mark Twain.
Luthers Rat ist oft zitiert, aber wenig beherzigt und immer noch gültig nach einem halben Jahrtausend:
Man muss die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt fragen und auf das Maul sehen: Wie reden sie?
Also – raus aus der Redaktion! Raus aus dem Elfenbeinturm! Raus aus dem Rotary-Klub und der abendlichen Rotwein-Runde mit Gleichgesinnten! Nur wer seine Leser respektiert, der bekommt die Chance, dass sie mit ihm reden. Nur wer mit den Lesern redet, der weiß, wie sie ihn verstehen und wie „sie es merken, dass man deutsch mit ihnen redet“.
Luther würde heute keine Kirche, sondern eine Zeitung gründen, mit den Mächtigen hart ins Gericht gehen und dem Volk aufs Maul schauen – aber nicht nach dem Munde reden. Luther fühlte sich auch im Netz wohl, hätte einen Blog, in dem er nicht nur von seinen Blähungen erzählte, sondern die Mächtigen beleidigte wie seinerzeit den Herzog Heinrich von Braunschweig:
Unsinniger, wütender Tyrann, der sich voll Teufel gefressen und gesoffen hat und stinkt wie ein Teufelsdreck.
Wer diesen Satz liest, entdeckt im Detail Luthers Rezept: Er wählt kurze Wörter, keines hat mehr als drei Silben; er meidet Synonyme, schreibt zweimal Teufel und denkt nicht daran, den „Teufelsdreck“ in einen Satansdreck zu verwandeln; er schafft eine Balance zwischen Substantiven und Verben: auf drei Substantive kommen drei Verben; er wählt starke Verben, die die Sinne reizen: fressen, saufen, stinken.
Bewege den Leser! Bringe Wörter und Sätze zum Tanzen! Das ist Luther: So wie er schrieb, so wollen die Leser lesen.
Vor 120 Jahren hielt Mark Twain als „der treueste Freund der deutschen Sprache“ vor dem Wiener Presse-Club eine Rede: „Die Schrecken der deutschen Sprache“. Twains Schrecken erschrecken uns ein gutes Jahrhundert später immer noch, sie schreiben das Schwarzbuch der Unverständlichkeit:
- „Die üppige, weitschweifige Konstruktion“ eines Satzes: Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Verbs verrätseln viele Wörter den Sinn. Als Beispiel dient eine Meldung auf der „FAZ“-Titelseite:
Der Bundestag hat einen für diesen Donnerstag angesetzten Beschluss über die Neuregelung von Arzneimitteltests an Demenzkranken abgesetzt.
Dreizehn Wörter zwischen „hat“ und „abgesetzt“ lassen den Leser im Unklaren, ob der Beschluss umgesetzt wird, konkretisiert, verschoben oder abgesetzt.
- Auch die üppige, weitschweifige Konstruktion zwischen Subjekt und Prädikat erschwert das Verstehen eines Satzes.
- Keine langen Sätze: Mark Twain muss an Wiener Brücken denken, wenn er einen Bandwurm-Satz liest:
Meine häufige Anwesenheit auf den Brücken hat einen ganz unschuldigen Grund. Dort gibt’s den nötigen Raum. Dort kann man einen edlen, langen, deutschen Satz ausdehnen, die Brückengeländer entlang, und seinen ganzen Inhalt mit einem Blick übersehen. Auf das eine Ende des Geländers klebe ich das erste Glied eines trennbaren Zeitwortes und das Schlussglied klebe ich ans andere Ende.“
- „Die ewige Parenthese“ geißelt Twain, die meist überflüssigen Einschübe zwischen zwei Gedankenstrichen:
Vor mehreren Tagen hat der Korrespondent einer hiesigen Zeitung einen Satz zustande gebracht welcher hundertundzwölf Worte enthielt und darin waren sieben Parenthese eingeschachtelt, und es wurde das Subjekt siebenmal gewechselt. Denken Sie nur, meine Herren, im Laufe der Reise eines einzigen Satzes muss das arme, verfolgte, ermüdete Subjekt siebenmal umsteigen.
„Unterdrücken, abschaffen, vernichten!“ empfiehlt der amerikanische Dichter. Sätze mit mehr als dreizehn Subjekten in einen Satz will er verbieten lassen; das Zeitwort will er im Satz so weit nach vorne rücken, bis man es ohne Fernrohr entdecken kann. So spricht Twain mit leichtem Spott:
Mit einem Wort, meine Herren, ich möchte Ihre geliebte Sprache vereinfachen, auf dass, meine Herren, wenn Sie sie zum Gebet brauchen, man sie dort oben versteht. Ich flehe Sie an, von mir sich beraten zu lassen, führen Sie diese erwähnten Reformen aus. Dann werden Sie eine prachtvolle Sprache besitzen und nachher, wenn Sie Etwas sagen wollen, werden Sie wenigstens selber verstehen, was Sie gesagt haben.
Gabriele Goettle zum Siebzigsten: Reportagen, die aus dem Rahmen fallen
Was ist eine Reportage?
Der Nachlass eines Lehrers, eine Liste mit Positionen wie „Kleidung: 27 Oberhemden, 20 Unterhemden, 26 Unterhosen…“ oder wie „Möbel: 1 Wanduhr (Gründerzeit, defekt), 1 Etagere für Pflanzen (50er Jahre)“?
Kein einziger Satz von der Reporterin ist zu lesen, nur eine ellenlange Aufzählung nebst „Leichenschauschein“, auf dem der Grund für den Nachlass geschrieben steht: „Verkehrsunfall mit dem KFZ Aufprall auf Brückenpfeiler mit ca. 140 kmh (laut Polizeibericht)“.
Eine Reportage? Ja, eine der besten sogar. Es gibt keine umfassende Definition für eine Reportage: Sie kann alles, sie darf alles – außer zu langweilen. Mit dem „Nachlass eines Lehrers“ wurde Gabriele Goettle bekannt, ja berühmt. Heute vor siebzig Jahren, am 31. Mai 1946, wurde sie in Aschaffenburg geboren; heute schreibt sie, meistens für die taz.
Spätestens als der „Nachlass eines Lehrers“ in ihrem ersten Buch erschien – ein Sammelband mit taz-Reportagen – war die Reporterin in der Literatur angekommen. Hans Magnus Enzensberger nahm sie in seine Edition „Die andere Bibliothek“ auf, in der prunkvoll gemachte Bücher erscheinen und die eine Ruhmeshalle für wenig bekannte, aber exzellente Schriftsteller ist.
Für Schirrmacher begründete sie mit dem Erstling „Deutsche Sitten“ ihren Ruhm „als eine der wichtigsten Stimmen unserer Zeit“. Der verstorbene FAZ-Herausgeber Schirrmacher machte in seiner Hymne klar, was eine gute Reportage ist und eine gute Reporterin:
Sie schreibt auf, was sie gehört und gesehen hat. Doch was sie schreibt hat eine Suggestion, die sich kaum aus den Gegenständen – dem Igelschutzverein etwa, dem Kaufhaus oder einer Butterfahrt – ableiten lässt. Kein Kunstaufwand, keine geglätteten oder ästhetisch aufgemöbelten Passagen erzeugen diese Wirkung. Gefragt, was diesen Bann ausmacht, ließe sich feststellen: Erstens, die Autorin lügt nicht. Zweitens, die Autorin erfindet nicht. Drittens, die Autorin denunziert nicht.
Was macht eine Reporterin, der nicht erfindet, nichts hinzufügt?
Sie lauscht den Menschen die Sprache ab. Die Sprache, die sie aufzeichnet, verrät das Geheimnis, das die Menschen haben, ohne es je zu kennen… Plötzlich wird dem Leser bewusst, wie irrsinnig das trügerische Selbstgespräch ist, das die Gesellschaft mit sich selber führt.
Schirrmacher zeigte auch, wie eine gute Reporterin scheitern kann: Sie verlässt ihre eigenen Regeln, unterwirft sich einer Ideologie. Daran scheitern immer noch viele, nicht nur junge Reporter, die das Moralisieren nicht lassen können:
Immer dort, wo sie sich von moralischer Empörung leiten lässt, verlieren die Texte sofort an Spannung und Suggestivität. Die moralische Emphase wirkt im schlimmsten Fall wie ein Zugeständnis an das Publikum.
Der FAZ-Feuilletonist Andreas Platthaus beschreibt in der heutigen FAZ, wie Goettle arbeitet: Sie schneidet die Gespräche mit, aber schreibt danach alles aus dem Gedächtnis auf – weil es ihr Text ist, der Text der Zuhörenden.
**
Quellen:
- FAZ 31. Mai 2016 „Win-win-Situation für mehr als zwei“
- FAZ 8. Oktober 1991 „Aus dem Nachtgebet der Genoveva Kraus“
- Goettle: Deutsche Sitten (Eichborn Verlag, Frankfurt 1991)
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?







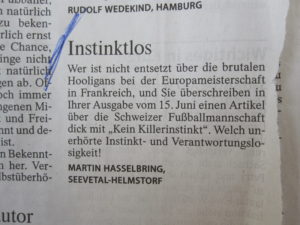



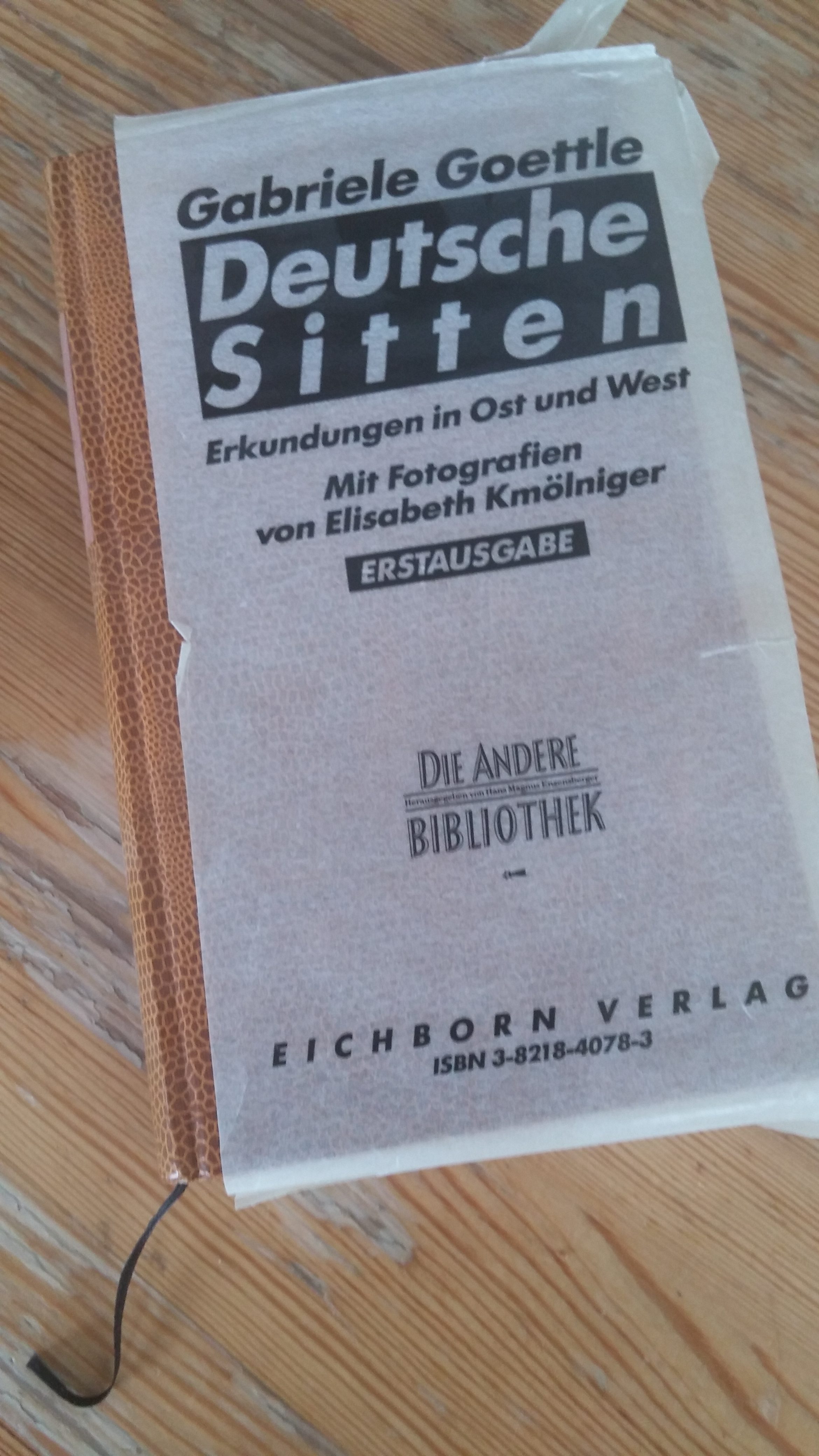


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von