Online-Kommentare: Nicht nur die Bösen verlieren den kühlen Kopf (Panter-Interview)
Der Mensch ist nicht ein sanftes liebebedürftiges Wesen… Infolgedessen ist ihm der Nächste auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen… ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten.
Was Sigmund Freud 1930 in „Das Unbehagen in der Kultur“ schrieb, ist täglich in Internet-Foren zu beobachten. Jeder, so Freud, benimmt sich „in irgendeinem Punkte ähnlich wie der Paranoiker“ und trägt diesen Wahn in die Realität ein. Heißt dieser Wahn: Internet?

Roland Panter ist Kommunikationsvorstand des Bundesverbands der Community Manager (Foto: Bundesverband)
Wie ein aktueller Kommentar zu Freuds Unbehagen liest sich ein Interview, dass Andreas Weck vom t3n-Magazin mit Roland Panter geführt hat, Kommunikationsvorstand des Bundesverbands der Community Manager. Der Profi erzählt, wie man mit dem Hass im Netz umgeht und mit den Trollen, in die wir uns alle mal verwandeln können. Hier Auszüge aus dem Interview:
Emotionen statt Reflektion: Abschied vom kühlen Kopf
Hass breitet sich über digitale Kanäle genau so schnell und dynamisch aus wie Liebe oder der Glaube an die positive Kraft der Kommunikation. Und das sogar so sehr, dass wir zwischenzeitlich das Gefühl hatten, uns würde eine Welle des Hasses überrollen.
Hier treten vor allem Mechanismen auf, die sich in der Unvollständigkeit der Kommunikation begründen – wir können viele Dinge schlichtweg nicht richtig lesen. Ist mein Gegenüber freudig oder verärgert, macht er oder sie vielleicht gerade einen ironischen Kommentar?
Je höher die Emotionalität, desto weniger reflektiert gehen wir als Mensch manchmal vor, und lassen uns ab und an zu Äußerungen verführen, die wir mit kühlem Kopf vielleicht nie getroffen hätten.
Wer verliert den kühlen Kopf? Der Wettbewerb der Zermürbung
Das betrifft wohl uns alle, nicht nur die vermeintlich Bösen. Dazu kommt die ganz klassische Gruppendynamik mit ihrer fatalen Wirkung. Menschen fangen an, sich zu verbünden oder wollen Aussagen gezielt in eine gewisse Richtung stoßen. Das wird in so einem Fall schnell zu einem Zermürbungswettbewerb, in dem die Lager immer mal wieder den Pfad des Anstands verlassen – übrigens bis hin zu Repressalien im realen Leben. Alles schon vorgekommen.
Der internationale Siegeszug der Gerüchte
Wir konnten wir in den vergangenen Monaten beobachten, das Gerüchte auch das Zeug zur internationalen Verschwörung haben. Es ist nicht immer so einfach, den wirklichen Treiber einer gewissen Themenpolitik auf Anhieb zu erkennen – hier sei beispielhaft auch Putins sogenannte „Troll Armee“ genannt.
Wie sollen wir mit Gerüchten umgehen?
Die alte These, dass Trolle nicht gefüttert werden sollen, gilt heute nur noch bedingt. Wir haben von der Facebook-Fanpage der Bundesregierung gelernt, dass mit geschickter Gegenrede oftmals mehr erreicht werden kann. Manche Beiträge sind allerdings so krude, dass sie für sich selbst sprechen und keine weiteren Kommentare benötigen. Viel lässt sich auch mit feinem Humor erreichen.
Hass-Prediger einfach rauswerfen, ganz oder teilweise
Früher befürchtet man noch eine Welle der Empörung nach Löschungen. Heute haben Nutzer hingegen akzeptiert, dass es diese Maßnahme gibt und sie ab und zu auch ein notwendiges Werkzeug ist. Ganz oft reicht auch eine temporäre Sperre, um dem Nutzer eine Möglichkeit zum Abkühlen zu geben.
Kommentar-Spalten einfach schließen? Nein, semantische Software einsetzen
Hier sieht man häufig, dass eine Unterscheidung zwischen Fakten und Überzeugungen durch die jeweiligen Nutzer scheinbar nicht mehr möglich ist. Das bedeutet in der Folge, dass man denen mit guten Worten nicht mehr beikommen kann. Da geht es um Verschwörungstheorien, arge Beleidigungen, völlig unreflektierte Behauptungen und dies in unglaublich großer Anzahl.
Ich würde mir eher wünschen, dass diese Medien mehr Ressourcen für ein besseres Community-Management zur Verfügung stellen. Das geht aufgrund der Masse an Kommentaren aber oft schon nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Hier gibt es erste erfolgreiche Ansätze mit semantischer Software, die automatisierte Moderation ermöglicht und zumindest die ganz schlimmen Fälle aussiebt – mit erstaunlich geringer Fehlerquote übrigens. Als gutes Beispiel sei an dieser Stelle das Community-Management von „Die Welt“ genannt, die ihre Kommentare auch dadurch gut in den Griff bekommen.
**
Quelle:
http://t3n.de/news/community-management-trolle-hass-interview-699024/?utm_source=t3n-Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=So+machen%27s+die+anderen!
„Die schlimmsten Feinde des Journalismus sind die aus den eigenen Reihen“ (Zitat der Woche)
„Erschüttert haben mich einige Reaktionen von Kollegen“, schreibt Ulrike Simon im „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ über das Echo auf die Panama-Papers.:
Mal ziehen sie die Veröffentlichungen in Zweifel, da die Motive des Whistleblowers nicht nur hehre sein könnten. Als ob das etwas an den Datensätzen änderte. Dann wieder glaubten welche, unter ihnen übrigens besonders Medienjournalisten, mal eben so urteilen zu können, der Erkenntnisgewinn der „Panama-Papers“ sei dünn und bleibe folgenlos. Razzien? Ermittlungen? Rücktritte? Eine ausgewachsene Regierungskrise in Island? Egal!
Am erbärmlichsten seien die, die eine Übergabe der Daten an die Justiz gefordert hätten. Ulrike Simon schließt mit dem Zitat der Woche:
Die schlimmsten Feinde des Journalismus sind die aus den eigenen Reihen.
Ist Böhmermann wirklich das wichtigste Thema?
Böhmermann, Böhmermann und noch mal Böhmermann. Gestern war der Satiriker sogar Aufmacher in der 20-Uhr-Tagesschau. Stimmt noch, wie wir die Nachrichten und Themen öffentlich gewichten? Es lohnt jedenfalls, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Wie reagiert beispielsweise ein Syrer, der heute ein neues Parlament wählen soll oder auf der Flucht ist?
Jan Jessen, im Hauptberuf NRZ-Redakteur, ist oft im Nahen Osten unterwegs, vornehmlich in Erbil und Kurdistan. Er hat auf Facebook schon einiges zu Erdogan und Böhmermann gepostet, aber erzählt auch eine Geschichte aus Bagdad 2011:
Diese ganze Böhmermann-Debatte zeigt auch, was wir für ein glückliches Völkchen sind. Wenn wir tagelang über Grenzen von Meinungsfreiheit anhand eines pubertären und wenig witzigen Gedichts streiten und darüber zehntausende Zeilen schreiben können, haben wir offenbar keine anderen Probleme, was uns von weiten Teilen der Welt unterscheidet.
Erinnert mich an einen Besuch in Bagdad im Jahr 2011. Damals saß ich dort mit irakischen Parlamentariern zusammen, wir diskutierten über den Krieg, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dann habe ich mir ne kurze Auszeit genommen und mir via Satellit das Heute-Journal angeschaut. Aufmacher war die Nachricht, dass zu Guttenberg eventuell bei seiner Doktorarbeit gepfuscht haben könnte. War etwas schwierig, den Irakern zu erklären, warum das für uns ein wirkliches Thema ist. Sie waren ziemlich neidisch.
Es ist sinnvoll, ab und zu die Perspektive zu wechseln.
Was ist Qualität? Auch im digitalen Zeitalter gelten die journalistischen Grundprinzipien
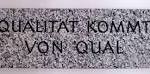
Wolf Schneiders Lieblingsspruch hängt in der Henri-Nannen-Journalistenschule, in Stein gemeißelt: Qualität kommt von Qual.
Über Qualität können sich Journalisten stundenlang erbittert streiten. Gibt es einen eigenen Qualitäts-Journalismus? Oder ist eine Qualitätszeitung nur ein Marketing-Gag? Geht vielleicht sogar ein Riss quer durch den Journalismus: Im Olymp die Edlen, in der Provinz der Rest?
In den abschließenden Kapiteln der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“ geht es um die Qualität, genauer: um die journalistischen Grundprinzipien oder die acht Pfeiler, auf denen der Journalismus ruht. Aber verändern sich die nicht im digitalen Zeitalter?
Nein, sagt auch Google-Chef Chinnappa :
Zwar stehen uns so viele Informationen wie noch nie zur Verfügung, aber dadurch wird es umso wichtiger, an den journalistischen Grundprinzipien festzuhalten.
Nachrichten bleiben Nachrichten, ob auf Twitter oder Facebook, in der Zeitung oder Online; nur die Präsentation ändert sich – ebenso wie die Technik, Nachrichten zu verbreiten.
Am Rande geht es auch um die beliebte Ausrede, man könne ja bessere Zeitungen oder Online-Auftritte schaffen, wenn man nur bessere Redakteure hätte. Nein, sagt Rainer Wagner, Psychologe und einer der Top-Berater für Verlage und Redaktionen:
Verändere die Umstände, nicht die Menschen. Management als ein Reparaturdienst des Verhaltens von Mitarbeitern und Führungskräften ist vergebliche Mühe.
**
Jan Böhmermann und Mathias Döpfner: Es geht um Freiheit, nicht um guten Geschmack
Ohne einen scharfäugigen Wächter, der Missstände des öffentlichen Lebens aufspürt, liefe die Demokratie Gefahr, der Korruption oder der Verführung durch Scharlartane zu erliegen.
So schrieb der Presserechts-Anwalt Martin Löffler 1963, als die deutsche Demokratie noch im Dornröschenschlaf verharrte und Politiker wie Öffentlichkeit die Pressefreiheit als eher lästig betrachteten. Löffler erstritt vor dem Verfassungsgericht das „Spiegel-Urteil“ und schrieb „Der Verfassungsauftrag der Presse“, aus dem das Eingangs-Zitat genommen ist.
Karl-Hermann Flach aus der Chefredaktion der Frankfurter Rundschau zitierte in seinem „Macht und Elend der Presse“ eifrig aus Löfflers Buch und schrieb:
Ein hartes Wort erscheint in einer Zeit und Gesellschaft häufig geboten, in der man die zarten Töne und rücksichtsvollen Andeutungen geflissentlich überhört oder übersieht.
Das ist kein Kommentar zu Jan Böhmermann, sondern einem Buch von 1967 entnommen.
Es geht nicht darum, ob man Böhmermanns Gedicht gelungen findet oder gräßlich, es geht um das Prinzip: Darf einer harte Worte finden zur Türkei, ihrem Führer und den Verletzungen der Menschenrechte, wenn unsere Kanzlerin die zarten Töne bevorzugt?
Natürlich wird ein Teil der Kritik intellektuelle Kritik sein müssen, nicht nur in der Presse, mehr noch beim Kabarett und in der Literatur… Nur in einem provinziellen geistigen Klima können jene Vorstellungen entstehen, nach denen ein scharfer Kritiker uferlos hasst, ein Nihilist außerhalb der Gesellschaft ist.
Auch dies ist kein aktueller Kommentar, sondern 1967 geschrieben, mit Pathos geschrieben: „Es gibt eine Pflicht zur Kritik – aus Liebe zum Volk und aus Treue zum Grundgesetz des Staates.“
Mathias Döpfner, der Springer-Chef, argumentiert ähnlich in einem offenen Brief an Jan Böhmermann und seine „Maximal-Provokation“:
Dass Ihr Gedicht geschmacklos, primitiv und beleidigend war, war ja – wenn ich es richtig verstanden habe – der Sinn der Sache. Sie haben doch einfach alle beleidigenden, insbesondere alle in der muslimischen Welt beleidigenden Stereotype zusammengerafft, um in grotesker Übertreibung eine Satire über den Umgang mit geschmackloser Satire zu machen.
Döpfner bietet indirekt seine Hilfe vor Gericht an:
Ich möchte mich, Herr Böhmermann, vorsichtshalber allen Ihren Formulierungen und Schmähungen inhaltlich voll und ganz anschließen und sie mir in jeder juristischen Form zu eigen machen. Vielleicht lernen wir uns auf diese Weise vor Gericht kennen. Mit Präsident Erdogan als Fachgutachter für die Grenzen satirischer Geschmacklosigkeit.
Es wäre zu wünschen, wenn die Klage vor Gericht kommt – durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht. Ab und zu muss jede demokratische Gesellschaft die Grenze der Freiheit austesten und klären lassen, das reinigt die Luft.
Offenbar ist es zur Zeit einfacher, Journalisten zu beleidigen und generell als „Lügenpresse“ zu diffamieren als die Wahrheit über einen Präsidenten zu sagen, der zum Diktator aufsteigt: Erdogan – so Döpfner –
kontrolliert in seinem Land etwa 90 Prozent der Zeitungsauflage und lässt Demonstranten, die anderer Meinung sind, gewaltsam von öffentlichen Plätzen entfernen. Oppositionelle bezeichnet er als „Atheisten und Terroristen“. Studenten, die demonstrieren, riskieren Exmatrikulation. Universitätsprofessoren, Journalisten oder Blogger, die Kritik äußern, werden willkürlich verhaftet, teils gefoltert, Redaktionen werden durchkämmt. Eine friedliche Kundgebung für die Rechte Homosexueller wird mit Wasserwerfern und Tränengas niedergeschmettert. Die Gleichstellung von Männern und Frauen lehnt der türkische Präsident ab: Der Islam lehre, dass Frauen vor allem Mütter seien. Und auch gegenüber den Kurden ist exzessive und rücksichtslose Gewalt der türkischen Armee an der Tagesordnung, sagt Amnesty International. Die Gewalt gegen Kurden habe allein seit dem vergangenen Sommer Hunderte Todesopfer gefordert.
Und wer bezahlt Böhmermanns Gang durch die Instanzen? Da wird er sich wohl keine Gedanken machen müssen.
Also: Soll die Kanzlerin dem türkischen Drängen bitte nachgeben und der deutschen und europäischen Öffentlichkeit einen Prozess schenken, in dem es um die Freiheit geht und nichts anderes.
**
Quelle: Offener Brief Döpfners in der Welt
Kollegenschelte: FAZ gegen SZ und die Panama-Papers
Die Süddeutsche Zeitung landete mit den Panama-Papers einen Coup. Wie reagierten die anderen, etwa die FAZ? . „Auf der Empörungswelle“ überschreibt Joachim Jahn den Leitartikel der FAZ am Samstag (9. April) gegen die „Aufgeregtheit“, den die Süddeutsche Zeitung mit der Veröffentlichung der Panama-Papers entfacht habe. Jahn wirft den Redakteuren der SZ vor: „Die breitangelegte Selbstvermarktung der ,Enthüllungen‘ ist fragwürdig“ – und er nennt folgende Gründe:
- Deutsche Bürger subventionieren mit Zwangsgebühren für die ARD die Kampagne privater Zeitungshäuser. (Die SZ arbeitet bei den Recherchen zu den Papers mit ARD-Redaktionen von WDR und NDR zusammen).
- Die SZ unterstellt, die Einschaltung von Briefkastenfirmen ist generell verwerflich.
- Sie stellt Prominente aus Politik, Sport und Wirtschaft unter Generalverdacht.
- Sie stellt die Dokumente den Ermittlungsbehörden nicht zur Verfügung, so dass sich die Anschuldigungen nicht überprüfen lassen oder gar widerlegen (Die SZ dazu: „Die SZ wird die Daten nicht der Allgemeinheit und auch nicht den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen. Denn die SZ ist nicht der verlängerte Arm der Staatsanwaltschaft oder der Steuerfahndung. Staatliche Ermittlungsbehörden haben in Deutschland wie im Ausland bereits jetzt, bei entsprechendem Verdacht, die Möglichkeit, die Unterlagen bei den Betroffenen zu beschlagnahmen.“
- Zu Recht Beschuldigte würden gewarnt und schaffen Beweise noch schnell beiseite.
**
Quelle: FAZ Titelseite 9. April 2016
Jan Böhmermann kann austeilen, nicht einstecken. Empfindlich eben wie die meisten Journalisten
Sind Journalisten empfindsam? Oder empfindlich? Jan Böhmermann zum Beispiel: Der ZDF-Moderator beleidigte den türkischen Staatschef, nannte das Satire und wollte – bestenfalls – mal testen, wie weit Satire gehen darf bei einem demokratisch gewählten Staatschef, der auf seinem Weg zu einem autoritären Führer schon eine beachtliche Strecke zurückgelegt hat.
Als die Kanzlerin sich für ihn in der Türkei entschuldigte, als Thomas Bellut, der ZDF-Intendant, erst die Satire aus dem Netz entfernen ließ und sich dann beim türkischen Botschafter entschuldigte, da verließen Böhmermann die Nerven. Er sagte seine Teilnahme beim Grimme-Preis ab, wollte den Preis aber behalten: „Ich fühle mich erschüttert in allem, an das ich je geglaubt habe. Mein Team von der Bildundtonfabrik und ich bitten um Verständnis, dass wir heute Abend nicht in Marl feiern können“, schrieb er.
Dabei hätte ihn das empfindsame Publikum in Marl auf den Händen getragen. Selbst die, die sein Schmähgedicht gruselig finden, hätten ihm applaudiert, um die Freiheit – irgendwie – zu verteidigen. Aber er kam nicht.
Die meisten Journalisten sind empfindliche Menschen: Sie können austeilen, aber nicht einstecken.
Der Schah-Paragraf: Staatsoberhäupter darf keiner beleidigen – auch nicht Jan Böhmermann. Oder?
Der Spiegel erschien 1949 zwei Wochen lang nicht, er war verboten – weil er das Königshaus in Holland beleidigt haben soll. Davon erzählt Heribert Prantl, der Jurist in der SZ-Chefredaktion, auf der SZ-Titelseite von Freitag (8. März 2016) – im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann, der ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten vorgetragen hatte.
Das Verbot 1949 erließen laut Prantl die britischen Besatzer; das Gesetz, das heute angewandt wird, wurde erst 1953 bundesdeutsches Recht. Vorläufer war ein Gesetz aus dem Kaiserreich, das allerdings nur die Beleidigung von Monarchen unter Strafe stellte.
Ende der sechziger Jahre verlangte der Schah von Persien eine Bestrafung der Studenten, die ein Plakat „Persien – ein KZ“ gezeigt hatten. Heribert Prantl: „Als Ermittler meinten, man müsse sich in diesem Rahmen auch mit den Zuständen in Persien beschäftigen, wurde das dem Bundesinnenminister Paul Lücke zu heikel. Er reiste eigens nach Teheran und bewegte den Schah zu einem Verzicht auf die Strafverfolgung.“
Gleichwohl heißt der Paragraf 103 bisher in der juristischen Umgangssprache „Schah-Paragraf“. Endet bei ihm die Presse- und Kunstfreiheit?
**
Grimme-Preis-Jury findet Synonym für Gutmenschen: Gefühlsduselige Sozialromantiker
Für „Marhaba – Ankommen in Deutschland“ bekommt der Moderator Constantin Schreiber vom Privatsender n-tv heute einen der Grimme-Preise. Schreiber erklärt in seiner Sendung jede Woche Flüchtlingen aus Arabien in ihrer Sprache fünf Minuten lang, wie die Deutschen und ihr Land ticken: Essgewohnheiten, Freizeit, Weihnachtslieder, Grundgesetz, Religionsfreiheit die Rolle der Frau und anderes mehr.
In der Begründung schreibt die Jury:
Ohne moralischen Überlegenheitssound, aber auch ohne gefühlsduselige Sozialromantik erklärt Constantin Schreiber in klarem Arabisch unsere Werte, Gesetze und Regeln des Miteinanders.
Wer Pathos und Sptach-Klischees von Jury-Begründungen kennt oder sie selber schon mal benutzt hat, dem sei die komplette Begründung der Jury empfohlen –die sich in eine ntv-Programm-Sitzung hineingedacht hat:
Jetzt stellen wir uns einmal kurz eine Sitzung bei einem deutschen Privatsender vor. Geschäftsführer und Vermarkter lassen sich vom Programm-Macher berieseln. „Hey, wir machen ein Dutzend Fünf-Minuten-Beiträge und erklären Flüchtlingen auf Arabisch unser Land. Themen sind Sex, Religion und Gleichberechtigung. Wir machen das erst lässig im Netz und später old school im Fernsehen, ach ja, und der Titel ist arabisch…“
Ein Blick des Geschäftsführers zum Werbezeitenchef. Dessen Kopf schlägt bedächtig auf die Tischplatte. Zwei Sekunden betretenes Schweigen. Dann hat sich der Geschäftsführer gefasst: „Eine dufte Idee fürs Erste oder ZDF. Haben wir nicht noch eine schöne Weltkriegsdoku? Oder was mit schweren Baumaschinen?“
Beim kleinen Sender n-tv muss es anders gelaufen sein. Der Nachrichtenanbieter hat einem jungen Team um Constantin Schreiber das Budget, die Website und später Programm-Slots für „Marhaba TV“ zur Verfügung gestellt. Schnell und pragmatisch haben die Redakteure klassisches Aufklärungsfernsehen umgesetzt.
Journalist Schreiber hat viele Jahre im arabischen Raum gelebt – ein großer Vorteil für die Umsetzung und Glaubwürdigkeit des Formats. Für die Migranten, die im vergangenen Jahr nach Deutschland kamen, war „Marhaba TV“ eine perfekte Hilfestellung – und das auch noch auf kurzweilige Art und Weise. Das Spektrum der Themen reicht von Parteiprogrammen bis hin zum putzigen Übersetzen deutscher Weihnachtsgedichte ins Arabische.
„Marhaba TV“ hat aber immer auch zu aktuellen Fragen Stellung bezogen. Die sogenannten „Ereignisse von Köln“ wurden thematisiert, ebenso der deutsche Karneval – immer schön auch auf Deutsch untertitelt. Denn auch der eine oder andere Biodeutsche könnte Neues über Demokratie und Toleranz erfahren. Klar, die üblichen Pöbeleien von besorgten Bürgern im Netz ließen nicht auf sich warten. Aber das ließ die Kölner kalt. Sie sendeten weiter und legten sogar mit einer deutsch-arabischen Talkshow nach.
Der Erfolg gab ihnen Recht. Hundertausende klickten das Angebot im Netz an. Ohne moralischen Überlegenheitssound, aber auch ohne gefühlsduselige Sozialromantik erklärt Constantin Schreiber in klarem Arabisch unsere Werte, Gesetze und Regeln des Miteinanders, während andere „wurzeldeutsche“ Moderatoren gerne schon einmal an ihrer Muttersprache scheitern.
Schreiber interviewt junge MigrantInnen, lässt ihre Sicht auf unsere Gesellschaft zu Wort kommen. Zudem stellt „Marhaba TV“ eine kluge Verbindung der Verbreitungswege dar, denn mobile Dienste sind die ersten Informationsquellen der Migranten. Fernsehen soll zudem bilden – das ist eine der Grundideen des Grimme-Instituts. Constantin Schreiber und n-tv haben es verstanden, diese Maxime modern und ohne großes Medien-Tamtam umzusetzen. Sie sind damit auch Vorbild für andere Privatsender, aber sicher nicht nur für diese.
Der kategorische Imperativ der Mediengesellschaft: „Was ist, wenn es rauskommt?“
Ein guter Reporter recherchiert nicht, um einen Mächtigen zum Rücktritt zu zwingen oder ins Gefängnis zu bringen. Auch wenn eine Portion Jagdfieber dabei sein sollte: Ein guter Reporter kontrolliert die Macht und schaut genau hin, wo und wie sich die Mächtigen um jeden Preis – oder fast jeden Preis – die Macht sichern.
Ein Gerichtsverfahren oder gar einen Rücktritt können die Leitartikler fordern. Nicht von ungefähr ist im angelsächsischen Journalismus klar unterschieden: Recherche ist die Sache der Reporter, der Kommentar und die Linie des Blattes ist Sache der Editoren, die in den klimatisierten Etagen der Zentrale sitzen.
Der Rücktritt eines Regierungschefs ist Sache des Parlaments oder des Präsidenten oder – wie in Island in Folge der Panama-Papers – Sache des Volks, das auf die Straße geht. Ein solcher Rücktritt ist sozusagen der Kollateralschaden einer Recherche.
Ziel einer Recherche ist durchaus, die Mächtigen zu warnen und gar in Furcht vor dem Herrn zu halten, dem Volk also und seinen recherchierenden Treuhändern, den Journalisten. Im Handbuch des Journalismus* loben wir den Willen zur Wahrhaftigkeit bei Journalisten wie Politikern und zitieren Bodo Hombach, der Politiker war, dann Verleger der WAZ und heute zweifacher Honorarprofessor: Er deutete Kants kategorischen Imperativ „Was ist, wenn es alle tun?“ um in den kategorischen Imperativ der Mediengesellschaft: „Was ist, wenn es rauskommt?“
An diesen kategorischen Imperativ haben die Panama-Papers die Mächtigen wieder erinnert – übrigens nicht nur die in westlichen Ländern, sondern auch die Diktatoren und Kriegsherren dieser Welt.
Zudem sind die Panama-Papers eine Antwort auf die „Lügenpresse“-Prediger und –Anhänger.
*Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus, Seite 293 (Rowohlt 2016)
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?












 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von