Je suis Charlie – Vor 81 Jahren zerstörten Nazis den Simplicissimus (Friedhof der Wörter)
„Das ist simpel“, sagen wir und meinen: Eine Aufgabe ist einfach, ist unkompliziert. Das Wort haben wir dem Lateinischen „simplex“ entlehnt.
Berühmt machte Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen den Simplicius, einen einfachen Mann, der im dreißigjährigen Krieg Gewalt erlebte, Folter und Mord. Vor gut 350 Jahren erschien der Roman „Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch“, der zur Weltliteratur zählt.
Das lateinische Wort machte Karriere in der deutschen Literatur: Den Simplicissimus, den Einfältigen, wählten Journalisten 1896 zum Titel ihres Satire-Magazins, das alte Motto des Grimmelshausen aufnehmend: „Es hat mir so wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen.“
Es wurde Deutschlands berühmtestes und bestes Satire-Magazin, laut Tucholsky das „A und O der politischen deutschen Satire“, vergleichbar dem „Charlie“ in Paris. Tucholsky erhob das Magazin zum Maßstab für gute Satire: „Vorbildlich in der Form, rücksichtslos im Inhalt“. Was ist der ideale Satiriker: „Er schlägt, und die Getroffenen stehen nicht wieder auf. Er lacht, und der Blamierte kann sich in den Erdboden verkriechen.“
Die Gewalt, die „Charlie“ am Mittwoch erlitt, erfuhr der Berliner Simplicissimus in der Nacht zum 11. März 1933. Die SA zerstörte erst die Redaktions-Räume und dann die Pressefreiheit in Deutschland; einige Redakteure flohen oder tauchten unter.
Die Nazis zwangen die Eigentümer der Zeitschrift, das Magazin „in streng nationalem Geiste“ zu führen. Klaus Mann, einer der Söhne von Thomas Mann, schämte sich im Exil für die Journalisten und nannte ihre Arbeiten „degoutante Gesinnungslumpereien“.
Wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt: Wir zerstören nie wieder die Freiheit der Presse, auch wenn wir uns ärgern, empören und uns in den Erdboden verkriechen wollen. Wir sagen – auch mit Lachen – die Wahrheit.
Und so bekennt auch der Kolumnist des „Friedhofs der Wörter“: Je suis Charlie – ich bin Charlie.
**
Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“ 12. Januar 2015
BILD und Süddeutsche gegen den Spiegel: Mit ein bisschen Spott ins neue Jahr
Sensation beim SPIEGEL
1. Print-Redakteur geht ins InternetAuch wenn 90 Prozent der BILD-Leser die Häme nicht verstehen: Auf der letzten Seite der Silvester-Ausgabe pflegt die Redaktion ihre Abneigung gegen die Kollegen aus Hamburg, deren Abneigung allerdings noch ungleich größer sein dürfte. Immerhin begann der dramatische Abgang des Spiegel-Chefredakteurs Büchner mit der Berufung eines BILD-Manns als stellvertretendem Chefredakteur. Es gibt übrigens Scherze, die dürftiger sind als der Spiegel-Spott, etwa: „Statt Soli! Westen schenkt Osten SOLIngen“
Silvester ist wohl der Tag der Spottlust: Auch bei der Süddeutschen fällt Willi Winkler über den Spiegel her. In einem fiktiven Gespräch lässt sich Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel als Nachfolger für den Spiegel-Chefredakteur einfallen und präsentieren:
Gniabor Steingart, Henryk M. Broder, Miriam Meckel, Margot Käßmann (Warum nicht? Der Papst hat gerade verkündet: Die Welt braucht mehr Zärtlichkeit.), Johannes B. Kerner, Giovanni di Lorenzo, Helene Fischer („Sie kommt aus Sibirien, damit kontern wir die ganzen Putin-Versteher aus“), Markus Lanz – aber nicht Ulrich Wickert, ihren Ehemann, der am Ende auftaucht und aus seinem Buch liest: Was uns Werte wert sein müssen.
Was für ein Jahresrückblick! Neun Nachrufe, neun Mal deutsches Leben
Die Zeit bringt einen beeindruckenden Jahresrückblick: Neun Nachrufe auf unbekannte Menschen, starke Geschichten über das normale und weniger normale Leben:
> eine Frau, die ihr Leben lang auf der Hallig Hooge morgens um fünf die Kühe gemolken hat, dann die Post sortiert und die Telefone mit dem Festland verbunden und ab und an der Flut und dem Orkan getrotzt. Stark der erste Satz von Nadine Ahr: „Am Ende wäre Ilse Mextorf beinahe doch noch ertrunken.“
> ein Sechzehnjähriger aus Ottensen, der zum Islam konvertierte und in Syrien für die IS kämpfte und starb. Der Mutter brachten zwei junge Leute die Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch. Ihr Sohn ist jetzt im Paradies.“ Der zentrale Satz des Nachrufs von Amrai Coen und Marc Widmann:“Er findet eine Heimat im Islam. Er, der Suchende, hat einfache Antworten gefunden auf seine komplizierten Fragen: Im Koran steht, was richtig und was falsch ist.“ Der unauffällige Junge aus Ottensen ist der einzige ohne Namen: Alfons R.
> und Nachrufe auf Francis Kwame aus der Elfenbeinküste, der in Deutschland nicht sein Glück fand und sich zu Tode trank;
> Uwe Heldt, der als Literaturagent Wolfgang Herrndorf entdeckte und ein Jahr nach ihm starb, auch an Krebs;
> den Arzt Hans Wokeck, der Kinder in indischen Slums behandelte und in Indien einsam starb;
> den Husumer Lokalpolitiker Lothar Knoll, ein FDP-Politiker, der Stellvertretender Bürgermeister werden wollte und in fünf Wahlgängen scheiterte;
> Karl-Heinz Gohlke, der 42 Jahre im Gefängnis saß und nach anderthalb Jahren Freiheit starb;
> Olga Ioppa, die auf Flug MH 17 abgeschossen wurde;
> Frieda Szwillus aus Oschatz, die älteste Frau Deutschlands: Sie starb mit 111 Jahren.
Vorbild dürfte die Reihe im Tagesspiegel sein mit Nachrufen auf das normale Leben von normalen Berlinern, jedenfalls von Menschen, die nicht in die Schlagzeilen kamen. Bülend Ürük weist darauf hin: Erfunden hat es die Berliner BZ.
**
Die Zeit 1/2015‚ 30. Dezember 2014
Ein Leser schaut zurück auf die Leserbriefe des Jahres: Das ist gelebte Demokratie!
Wolfgang Jörgens, Leser der Thüringer Allgemeine, liest jeden Leserbrief und notiert ihn in seiner Statistik: Welche Themen interessieren die Leser am meisten? In einer der letzten Ausgaben des Jahres schreibt Jörgens auf der „Leser-Seite“, was ihm aufgefallen ist – und tadelt die Redaktion, dass sie nicht jeden Brief der Leser auch beantwortet:
Da findet in Kürze ein Symposium in Erfurt statt, wo u. a. die Frage aufgeworfen und möglicherweise eine Antwort gesucht wird, die da lautet: „Was wollen die Leser?“ – „Und was bekommen Sie“ . . .von ihrer Heimatzeitung, der Thüringer Allgemeinen? Meine Antwort, als interessierter Leser: Sie, die Leser, wollen gehört und ernst genommen werden. Sie bekommen seit nunmehr fünf Jahren „Ihre“ Leserseite!
An dieser Stelle wiederhole ich mich gern und sehr bewusst: Das ist gelebte Demokratie. Kritiker an dieser Aussage mögen die Frage beantworten, welche regionale Tageszeitung bringt es in fünf Jahren fertig, über 6800 Meinungen von Lesern, ob zustimmende oder ablehnende, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich denke, da gibt es nicht viele vergleichbare Beispiele.
Auch das abgelaufene, sehr turbulente Jahr 2014 belegt dies sehr deutlich. Immerhin wurden 1933 Leserbeiträge in Gedichtform, als Bildunterschrift oder als Textbeitrag zu den unterschiedlichsten Tagesthemen veröffentlicht. Mit der großen Politik, der Bundespolitik, befassten sich 732 Beiträge. Mit der Landespolitik des Freistaates 369. Auch mit 195 Beiträgen zum Thema DDR und einem Anteil von rd. 10 Prozent wurde sich befasst und schließlich 637 Beiträge, das sind rd. 33 Prozent aller Beiträge, brachten u. a. Meinungen zum Sport, der Kultur, dem Umweltschutz, der Landwirtschaft und dem Jagdwesen zum Ausdruck.
Sicher haben sich manche Leserbriefschreiber darüber geärgert, oder gewundert, dass ihr Beitrag nicht veröffentlicht wurde. Ich bin mir sicher, dass alle eingegangenen Leserbriefe von der Redaktion gesichtet, gelesen und in die redaktionelle Arbeit einbezogen wurden. Durch Lesergedichte und Fotos mit Bildunterschrift stand möglicherweise weniger Platz zur Verfügung. Aber, diese Beiträge bringen ebenfalls Emotionen und Meinungen und das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Heimatzeitung zum Ausdruck.
Also haben sie einen berechtigten Platz auf der Leserseite. Ich erspare mir einen näheren Blick auf die „große“ und „kleine“ Politik. Hier würde ich möglicherweise zu viel Subjektivismus rein formulieren. Da mag sich jeder Leser seine eigene Meinung bilden. Etwas erstaunt bin ich jedoch darüber, dass man auf Anfragen an einzelne Redakteure zu bedeutsamen Themen, die die Menschen in unserem Land bewegen, keine Antwort erhält. Lobenswert hierbei sind die rund 50 Beiträge des Chefredakteurs Paul-Josef Raue auf gestellte Fragen, die teilweise unter die „Gürtellinie“ gegangen sind. Respekt vor soviel Mut. Aber Mut zur Wahrheit gehört eben auch zu einem guten Journalismus und einer dynamischen Redaktion im Land und in den Landkreisen. Hier beziehe ich mich gern auf den Landkreis Nordhausen.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Leserbeiträge, da diese nicht anonym bleiben, einen gewissen Mut zur Wahrheit belegen. Alles in allem eine gute Kombination von Professionalität, Sachkenntnis, auch im Ehrenamt, und Leidenschaft auf beiden Seiten. Das führt letztlich zu einer guten Tageszeitung, unserer Thüringer Allgemeinen.
In diesem Sinn allen Beteiligten ein glückliches neues Jahr, hoffentlich in Frieden und dem Willen, aufeinander zuzugehen, dem anderen zuzuhören und möglichst miteinander unser schönes Land weiter zu entwickeln und zu gestalten.
**
Das Symposium, das Jörgens eingangs erwähnt, findet am 12. Januar zum 25-Jahr-Jubiläum der Thüringer Allgemeine statt: „25 Jahre Einheit – 25 Jahre Demokratie im Osten – 25 Jahre TA“
Thüringer Allgemeine, 30. Dezember 2014
Muss nicht jede Zeitung eine Debatten-Zeitung sein? Das neue FAZ-Feuilleton
Der neue FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube:
Das Debattenfeuilleton hat sich bewährt. Die Frage ist, ob die Themenbreite dieser Diskussionen nicht breiter ist, als sie manchmal bei uns war. Über längere Strecken wurden jeweils die Genetik, die Demografie oder die Probleme mit der Internetökonomie behandelt, andere Themen wie Migration oder soziale Ungleichheit blieben im Hintergrund. Ich strebe einen ausgeglicheneren Stil an. Und im Feuilleton dürfen die klassischen Künste und ästhetischen Fragen nicht zu kurz kommen. Die Entscheidung zwischen Debatte und Ästhetik wäre eine schlechte Alternative.
Kaube auf die Frage von Martin Eich „Was werden Sie anders machen als Frank Schirrrmacher?“ (Mainz, Allgemeine-Zeitung vom 17.12.2014)
Die Frage muss sich jede Zeitung, erst recht Regional- und Lokalzeitung stellen:
> Erkennen wir die Themen, die die Menschen umtreiben?
> Recherchen wir sie tief genug?
> Bieten wir die Themen an, die zur Debatte taugen?
> Vernachlässigen wir Themen?
> Drängen wir den Politiker die Themen auf, wenn wir erkennen, dass die Bürger auf eine große Debatte oder Entscheidung drängen?
Wer meint, dies sei nicht Aufgabe einer Zeitung, der lese im Spiegel-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom August 1966, zu lesen im Handbuch auf Seite 21:
Die Presse fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran.
Jeder Dritte liest auf dem Smartphone aktuelle Politik-Nachrichten
Immer mehr Deutsche nutzen das Internet auf dem Smartphone, genau sind es 31 Millionen (44 Prozent der Bevölkerung über 14). Um ein Viertel ist die Nutzung in nur einem Jahr gestiegen, wie die neue Internet-Studie, die Acta 2014, von Allensbach belegt. Das sind die Favoriten der Mobile-Nutzer:
1. Wetter (60 Prozent)
2. Soziale Netzwerke / Chatten (52)
3. Karten / Routenplaner (47)
4. You Tube / Videos schauen (42)
5. Wikipedia / Nachschlagewerke (40)
6. Veranstaltungen suchen (40)
7. Musik hören (38)
8. Aktuelle Politik-Nachrichten (32)
9. Sport (29)
Mittlerweile sind online auch zwei Drittel der Älteren über 60; in der Altersgruppe zwischen 50 und 60 sind es über achtzig Prozent. Seit Jahren sind fast alle der unter 29jährigen täglich online.
**
Quelle: Acta 2014 (Allensbacher Computer- und Technikanalyse), wird seit 1997 jährlich erhoben.
Warum ist „Maria durch ein Dornwald ging“ eines der erfolgreichsten Adventslieder? (Friedhof der Wörter)
Wer sich durch ein Dornen-Gestrüpp schlängelt, muss sich tief bücken – sonst verhakt sich die Mütze im Strauch, bekommt die Jacke einen Riss und das Gesicht eine Ratsche. Vor rund zweihundert Jahren mag sich ein unbekannter Dichter durch ein Gestrüpp im Eichsfeld gequält haben, es dürfte frostig gewesen sein. Er schrieb danach ein Lied, das heute zu den bekanntesten im Advent zählt – weil es, im Gegensatz zur stillen und heiligen Nacht, unsentimental ist und schwer daherkommt: „Maria durch ein Dornwald ging“.
Es gibt bei uns keinen Dornwald, er ist typisch für tropische Gebiete, in denen es fast nie regnet. Aber wir können ihn uns vorstellen: Ein mystischer Ort während der kalten Tage vor Weihnachten.
Die Hauptwörter in dem Lied sind kurz, meist zweisilbig, und von Vokalen durchdrungen – wie alle Wörter, die uns berühren, von Herz bis zu Schmerz; es gibt keine überflüssigen Adjektive, abgesehen vom „kleinen Kindlein“. Unserem Drang, kein Wort zu wiederholen, verweigert sich der Dichter: Maria wird nicht zur Jungfrau oder Gottesmutter, sie bleibt Maria – sieben Mal; das Kindlein bleibt Kindlein, die Dornen bleiben Dornen, alles wiederholt sich und reimt sich und prägt sich ein wie in der dritten Strophe:
Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.
**
Thüringer Allgemeine 15. Dezember 2014
Das Lied mit den drei Strophen, wie sie heute gesungen werden:
Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen.
Jesus und Maria.Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.
Was ist ein Gastbeitrag? Muss man dafür bezahlen? (Leser fragen)
Wissen wir eigentlich, was unsere Leser unter unseren Fachbegriffen verstehen? Was ist etwa ein „Gastbeitrag“?
Wer meint, das sei doch klar, der schaue in den Brief eines Lesers; er hatte einen langen, mit der Hand geschriebenen Brief geschickt, in dem er sich über den Gastbeitrag von Klaus von Dohnanyi zum Mauerfall und zur Rot-Rot-Grünen Koalition in der Thüringer Allgemeine ärgert. Am Ende seines Briefs fragt der Leser an Dohnanyi gewandt:
„Ich weiß nicht, ob Sie Geld dafür bekommen haben. Mussten Ihre Zeilen in der Zeitung von Ihnen bezahlt werden? Wer kann Gastbeiträge in der ,Freien Presse‘ drucken lassen?“ Der Chefredakteur antwortet in seiner Samstag-Kolumne „Leser fragen“:
Gastbeiträge werden nicht honoriert, auch müssen die Autoren dafür nicht bezahlen. Gastbeiträge werden von der Redaktion erbeten, um ein schwieriges oder umstrittenes Thema ausführlich zu ergründen und zur Diskussion zu stellen. Einige Beispiele:
- Klaus von Dohnanyi war Minister, Hamburger Bürgermeister und arbeitete in Thüringen für die Treuhand; er ist ein Politiker, der weiß, wovon er spricht – und wem er widerspricht. Sein Beitrag hat polarisiert – und das sollte er auch bewirken.
- Der Erfurter Carsten Schneider ist ein wichtiger Thüringer Abgeordneter im Bundestag, oft in der Tagesschau zu sehen. Er schrieb aus SPD-Sicht über die Rot-Rot-Grüne-Koalition und setzte sich mit der Geschichte von SPD und SED in der DDR auseinander.
- Ralf-Uwe Beck ist Pfarrer und Sprecher des „Bündnisses für Mehr Demokratie in Thüringen“: Wir dokumentierten in Auszügen eine beeindruckende Rede, die er vor Managern und Unternehmern auf der Wartburg gehalten hatte.
- Udo Reiter war Intendant des MDR und seit Jahren an den Rollstuhl gebunden. Er schrieb über Sterbehilfe und die persönlichen Gründe, warum er sein Leben selbst beenden könnte.
Gastbeiträge geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, sie sollen zur Debatte anregen oder sogar anstacheln – so wie es auch jeder gute Kommentar und Leserbrief tun sollte. Wenn ich mich über eine Meinung errege, werde ich gezwungen, meine Gründe zu formulieren: Warum bin ich anderer Meinung?
Das Bundesverfassungsgericht schrieb in einem Urteil: „Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen, die andere sich gebildet haben.“ Eine gute Zeitung reizt also zur Debatte – und trägt diese auch aus.
***
Thüringer Allgemeine 13. Dezember 2014
Wer ist ein guter Journalist?
Wenn zur richtigen Haltung gutes Handwerk dazukommt.
Die Macher des erfolgreichsten Lieds der DDR „Über sieben Brücken musst du gehn“ in einem MDR Feature vom Dezember 2014.
Richtige Haltung im Journalismus ist die Leidenschaft, die Bürger in einer Demokratie umfassend, verständlich und wahrhaftig zu informieren und das Wichtige vom Unwichtigen zu unterschieden. Zur Haltung gehören fünf Eigenschaften: Neugier, Streitlust, Rückgrat, Misstrauen und die Abneigung gegen Hochmut.
Gutes Handwerk ist neben der Beherrschung unserer Sprache die Fähigkeit, eine Nachricht und Reportage schreiben und vorurteilsfrei recherchieren zu können sowie die Grundlagen unserer Ethik zu kennen.
Vom Irrsinn der Anglizismen: Warum darf das „Nordlicht“ nicht Nordlicht heißen? (Friedhof der Wörter)
Die Zeit vor Weihnachten ist Lichterzeit – vor allem im Norden, wo die Sonne selten scheint, in manchen Gegenden gar nicht, und die Nebel die Welt verhüllen. Es ist kalt, und wir brauchen das Licht, um nicht in Schwermut zu fallen.
Das hat sich auch das Rundfunkt-Sinfonieorchester des MDR gedacht und ein Lichter-Festival gestartet. Wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet, schickt sie in den Norden ihre Winde und elektrisch geladene Teilchen zaubern am Himmel ein Spektakel in grün und rot und violett und blau: Das Nordlicht.
Doch die Verächter der deutschen Sprache im MDR scheuen das schöne Wort, wollen kein Licht ins Dunkel bringen und nennen ihr Festival: „Northern Lights“. Nun ist das Nordlicht in England recht selten zu sehen, so dass – logisch gesehen – das norwegische Wort, ein schönes zudem, sinnvoll wäre: Nordlys; oder das zungenbrecherische finnländische: Revontulet.
Überhaupt schämt sich das Orchester der deutschen Sprache, wie sie in Erfurt und Bitterfeld geschätzt wird. „Go North“, gen Norden, ist das Motto über die vier Jahreszeiten-Festivals; den „Northern Lights“ folgt das eisige „Ice Festival“, im Frühjahr das „Spring Festival“ und im Sommer das „Midsummer Festival“.
Ein englischer Rundfunk-Moderator käme nie auf die Idee, ein deutsches Orchester oder Musikstück mit seinem deutschen Namen zu nennen: Aus München wird „Munich“, aus Bachs Leipziger Orgel-Chorälen werden „Organ Chorales from the Leipzig Manuscripts“.
Bei „MDR-Figaro“, dem Sender für die besseren Hörer, brechen sich die Moderatoren fast die Zunge, wenn sie das Londoner „Orchestra of the Age of Enlightenment“ ankündigen. Ich möchte wetten: Mindestens zwei Drittel der Hörer versteht nicht, dass das „Orchester der Zeit der Aufklärung“ zu hören ist, übrigens meist mit Musik deutscher Komponisten.
Und für unsere jungen Leser sei die sächsische Musikgruppe Silbermond erwähnt: Sie singt deutsche Texte – wie die „Krieges des Lichts“ – aber nennt ihre neue CD: „Das Best of“. Wie wäre es mit „Das Beste“ – oder gleich „Aufgewärmt“, weil doch nur zu hören ist, was längst bekannt.
**
Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 8. Dezember 2014
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?





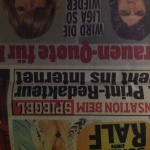


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von