Vom Leben und Leiden in einer DDR-Redaktion: Eine Redakteurin erinnert sich (25 Jahre Thüringer Allgemeine)
Am 15. Januar 1990 erschien die erste unabhängige Tageszeitung in der DDR: Die Redaktion der Bezirkszeitung Das Volk in Erfurt warf die SED raus, ließ die Freiheit rein und gab der unabhängigen Zeitung einen neuen Titel – Thüringer Allgemeine. Zum Jubiläum lud die TA zu einem ganztägigen Symposium: Zu Beginn erzählten vier Redakteure über die Unfreiheit vor der Revolution, von den Revolutionstagen und den Wochen danach.
Angelika Reiser-Fischer ist heute Redakteurin der Lokalausgabe „Erfurt Land“; sie erzählte (leicht gekürzt):
Am Morgen des 13. Januar 1990 fand in der Kantine der Druckerei Fortschritt Erfurt jene denkwürdige Versammlung statt, bei der sich die Redaktion der Zeitung Das Volk für parteiunabhängig erklärte. Hitzige Diskussionen hatten in den Wochen zuvor in der Redaktion stattgefunden.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich an jenem Morgen in das Zeitungshaus unterwegs war. Im Trabant, ohne Winterreifen, über von Reif glitzernden Straßen.
Ich war pünktlich. Und ich hatte keine Ahnung, wie die Sache ausgehen würde. Ich wusste aber: So ging es nicht weiter. Man überlegt in solchen Umbrüchen wohl immer: Wann hat es angefangen? Was waren die Zeichen? Was haben sie mit mir gemacht?Ja, ich war in der SED. Ohne Zwang bin ich als Volontärin eingetreten. Ich wollte Journalistin werden – weil ich neugierig war, weil mich das Bunte und Spannende interessierte; weil ich meinte, als Journalistin der Wahrheit zumindest nahe zu kommen; weil man da die Dinge selbst erleben, hinterfragen, begutachten, auch beurteilen könnte. Und das wollte ich bei einer großen Zeitung lernen. Die allerdings waren Mitte der 1970er Jahre alle in der Hand der SED. Meine Vorstellungen waren ziemlich naiv. Zunächst beim Journalistik-Studium in Leipzig: Schockiert erlebte ich ein Partei-Verfahren gegen einen Wissenschaftler. Er hatte aus einem Urlaub in Ungarn ein Buch mit in die DDR gebracht: „Die Revolution entlässt ihre Kinder“, von Wolfgang Leonhard. Ich konnte nicht fassen, was sich vor meinen Augen abspielte: demütigende Verhöre vor den Studenten im 2. Studienjahr, das Durchdrücken einer Abstimmung, Drohungen an uns junge Leute und anschließender Rauswurf des Wissenschaftlers.
Aber ich wollte Journalistin werden. Wenn ich nur erst in der Redaktion wäre, dachte ich, da würde bestimmt alles besser.
1978 begann ich in der Redaktion Das Volk, und lernte die Spielregeln, hatte bald die Schere im Kopf, fragte Dinge erst gar nicht, überhörte Bemerkungen.
Meine Gesprächspartner wussten meist auch selbst, dass ich manches gar nicht schreiben würde: fehlendes Gemüse, verbotene Bücher, nicht genehmigte Westreisen. In der sozialistischen Presse hatte so etwas nichts zu suchen. Es waren peinliche Momente. In der Redaktion drechselte ich an meinen Sätzen. Und glaube noch immer, dass jeder mitreden durfte, auch wenn es bald Ansagen gab, dass manche Wörter oder Formulierungen nicht verwendet werden durften; „Umgestaltung“ war ab Mitte der 1980er Jahre so ein verbotenes Wort.Wenn manche heute meinen, sie hätten Widerstand geleistet – ich nicht. Um anzuecken, war dies auch gar nötig. Eines Tages kam ein Leserbrief in die Redaktion über eine rollende Fleischerei, in der die Leute Schnitzel und Wurst kaufen konnten. Plötzlich blieb es weg. Warum?, wollte jemand wissen. Ich ging der Sache nach, fragte, und es hieß, da sei etwas kaputt, das Auto sei zur Reparatur, es fehle ein Ersatzteil. Das schrieb ich auf. Ich hielt das für einen völlig normalen journalistischen Vorgang. Der Beitrag wurde aus der Zeitung kurz vor dem Andruck entfernt. Ich bekam Ärger und eine Verwarnung.
Im Sommer 1983 erschien ein Artikel aus der Feder meines Kollegen Heinz aus dem Kulturressort. Es ging, eigentlich völlig harmlos, um ein Erfurter Ehepaar, das als Dauercamper am Stausee Hohenfelden lebte. Was weder in dem Artikel stand noch dem Autor bekannt war: das Ehepaar hatte einen Ausreiseantrag gestellt.Dem Kollegen wurde unterstellt, bewusst dem Klassenfeind Raum in der Parteizeitung gegeben zu haben. Zunächst wurden alle Redakteure angewiesen, niemanden in der Zeitung mit Namen zu nennen oder im Foto zu zeigen, von dem nicht klar war, dass er keinen Ausreiseantrag gestellt hatte. Ein Akt des Misstrauens gegen jedermann. Und für eine Tageszeitung ein unsägliches Verfahren.
Gegen Heinz wurde nun ein Parteiverfahren angestrengt. Artikel von ihm durften nicht mehr erscheinen. Wie sollte ich mich verhalten? Diskussionen unter den Kollegen waren schwierig. Mit wem konnte man offen reden? Wie würden sich die anderen in einer Abstimmung verhalten? Und wenn sie einer Bestrafung zustimmen würden, dann aus Überzeugung – oder um die eigene Haut zu retten? Angst und Zweifel bestimmten die Tage in der Redaktion. Die Parteileitung ließ keinen Zweifel: Wer dem Rauswurf von Heinz widerspricht, fliegt auch. Das Urteil gegen ihn stand eh fest. Klar war: Hier sollte ein Exempel statuiert werden.
Die außerordentliche Parteiversammlung im September 1983 war eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte dieser Zeitung. Mir völlig unbekannte Leute saßen in der Versammlung und zitierten plötzlich aus einem Brief, den Heinz an seine Schwester in den Westen geschrieben haben sollte. Ich war wie versteinert. Wie kamen sie überhaupt zu dieser Post? Eine einzige Kollegin hob nicht die Hand, als es um den Rauswurf von Heinz ging. Ich war das nicht, auch ich hob die Hand. Und auch diese Kollegin soll im Nachhinein ihre Gegenstimme, ihren Widerstand zurück genommen haben. Heinz musste die Redaktion danach sofort verlassen.
Es war nur ein paar Monate später. Eines Abends klingelte es an meiner Wohnungstür. Davor stand der stellvertretende Chefredakteur Heiner Oette. „Bis du allein in der Wohnung?“, fragte er mich. Ich nickte, bat ihn herein. Ich war in diesen Tagen allein in der Lokalredaktion gewesen und hatte über einen neuen Kosmetiksalon berichtet. Eine schöne lokale Geschichte, dachte ich, die ich sofort mit einem Foto einrückte. Was mir der Vize-Chef an jenem Abend mitzuteilen hatte: Auch jene Kosmetikerin hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Das hatte ich nicht gewusst, nicht vermutet und – nicht prüfen lassen. Ich wusste, was mir bevorstehen würde.
Als ich am nächsten Morgen die Redaktion betrat, kam ich nicht mal bis zu meinem Schreibtisch. Ich wurde auf der Treppe abgefangen und musste mit zur SED-Kreisleitung. Dort saß ich dann stundenlang auf dem Gang, wurde immer wieder verhört und befragt und zu Stellungnahmen aufgefordert: Warum habe ich diesen Beitrag geschrieben? Wer hat gesagt, dass ich diese Frau interviewen und fotografieren sollte? Wer wusste, dass ich darüber schreiben würde? Wer hat den Artikel vorher gelesen? Nach zwei Tagen durfte ich wieder in die Redaktion. Aber: Auch ich bekam ein Verfahren. Auch gegen mich waren sich alle einig. Dabei: Ich war kein Widerstandskämpfer. Es war einfach eine Panne, die offenbar auf einen schwachen Klassenstandpunkt schließen ließ.Ich kam mit einer Parteistrafe davon. Es wurde mir wohl zugute gehalten, dass zufälligerweise niemand im Umkreis dieser Frau von ihrem Ausreiseantrag wusste.
Am 23. Oktober 1989 wurde in der Redaktionskonferenz angekündigt, dass nun nach Leipzig, Dresden und anderen Orten auch in Erfurt demonstriert würde. Was macht die Redaktion? Schweigen am Tisch. „Ich gehe da hin“, habe ich heraus geplatzt. Das wollte ich sehen, hören. Und davon wollte ich etwas für die Zeitung schreiben, zusammen mit meiner Kollegin Esther Goldberg. Wir waren uns einig. Ich fuhr zunächst nach Hause (Telefon hatte ich nicht). Dort saß mein neunjähriger Sohn über den Hausaufgaben. Ich erklärte ihm, dass es heute später werden würde. Für den Fall, dass ich bis 21 Uhr nicht zu Hause wäre, sollte er zu seiner Oma gehen. Falls mir etwas zustoßen würde, ich vielleicht verhaftet oder verletzt wäre, wollte ich verhindern, dass er – allein zu Hause – ahnungslos die Tür aufmachte. Womöglich dem Jugendamt.
Nach den Friedensgebeten in den Kirchen der Stadt strömten die Massen zum Domplatz. Dort verabredete man sich für Samstag zum „Dialog“ in der Thüringenhalle. Anschließend führte der Zug durch die Innenstadt von Erfurt. Auch vor das Zeitungshochhaus. Das lag im Dunkeln. Alle Lichter waren gelöscht. Aufgeregte, hitzige junge Leute stürmten die Treppe hoch zur Eingangstür. Vertreter vom „Neuen Forum“ und den Kirchen griffen ein, beruhigten. „Schreibt die Wahrheit“, riefen die Demonstranten immer wieder. Das wollte ich gern tun. Als Esther und ich zur Redaktion kamen, riefen wir glücklich und aufgekratzt: „Wir sind das Volk“ und „Wir sind vom Volk“ – beides stimmte ja. Uns wurde ein Platz auf Seite 2 zugewiesen. Nicht sehr groß, aber immerhin. Wir wollten nun schreiben, was wirklich geschehen war. Und lieferten unser Manuskript ab. Warteten dann, wie das Urteil des Chefredakteurs ausfiel. Wir warteten. Und warteten. Irgendwann kam jemand an uns vorbei: Geht heim, sagte er, und dass Werner Hermann, der damalige Chefredakteur, seit Stunden mit der SED-Bezirksleitung telefoniere. Ausgang: unklar.
Am nächsten Morgen konnte ich es kaum erwarten, die Zeitung in der Hand zu halten. Ich schlug auf, Seite 2? Wo war unser Bericht? War er unverändert?
Er war – gar nicht. Er war nicht gedruckt worden. Dafür erschien an diesem Platz, der unserer sein sollte, ein Pamphlet mit der Überschrift: Offizielle Mitteilung. Da war die Rede von einer „propagierten Aktivität“, von „Losungen mit demagogischem Inhalt“, von einer „nicht genehmigten Demonstration“. Ich war fassungslos, wütend. Wollte den Hergang erfahren. Der Chefredakteur erklärte zerknirscht, dass die Überschrift „Offizielle Mitteilung“ das Äußerste war, wodurch sich die Redaktion von dem Text distanzieren konnte. Auch unter Lesern brach ein Sturm der Entrüstung los.Zwei Tage später fand in der Thüringenhalle der auf dem Domplatz verabredete „Dialog“ statt. Während sich vor der Halle Hunderte drängten, hieß es an den Türen: Alles besetzt. Die Hälfte der Halle war reserviert, für Funktionäre und Studenten der Parteischule. Die Debatte wurde mit Mikrofonen nach draußen übertragen.
Trotzdem drängten sich stundenlang die Leute an den Mikrofonen im Saal, verlangten von Partei und Regierung, teils aufgebracht, Rechenschaft. Und die Leute wollten auch wissen, wer für die „Offizielle Mitteilung“ in der Zeitung verantwortlich sei, sie verfasst hätte. Der stellvertretende Chefredakteur Hartmut Peters stand auf und sagte, dass die Redaktion diesen Text nicht geschrieben hatte und nur unter Zwang den Text eingerückt hätte. Damit war dann aber auch sein Abgang besiegelt.In den folgenden Tagen und Wochen brach in der Redaktion immer heftiger eine Debatte los, ob und wie der Schritt zur Unabhängigkeit gegangen werde sollte. Etwa ein Viertel der Kollegen sagten auch klar, dass sie diesen nicht mitgehen wollten und in solch einem Fall die Redaktion verlassen würden. Was dann auch geschah.
An jenem 13. Januar wurde der Schritt vollzogen. Mit allen Unwägbarkeiten. Unser Kapital waren allein die Leser der Zeitung und ihr Vertrauen und unsere Verwurzelung in Thüringen. Die Zeitung erhielt einen neuen Namen Thüringer Allgemeine. Ich habe in den darauf folgenden Monaten und Jahren endlich über vieles schreiben können, wovon ich zuvor nur hätte träumen können: Über die ersten freien Wahlen im Frühjahr 1990, die Öffnung des Rennsteiges nach Bayern, die Einführung der D-Mark, die Wiedergründung des Landes Thüringen und den ersten Thüringer Landtag und vieles mehr.
Es waren für mich gute Jahre.
Thüringer Allgemeine, 16. Januar 2014 (gekürzte Fassung in der Extra-Ausgabe).
Weitere Reden und Debatten aus dem Symposium folgen in diesem Blog.
Charlie und „Satire im Kreuzfeuer“: Erfurter Kabarettist Ulf Annel über Tucholskys Aufsatz
„Satire darf alles. Gewissermaßen ist es der Luxemburg-Satz von der Freiheit, die immer auch die Freiheit des Andersdenkenden ist. Aber denken muss man schon.“ In einem Gastbeitrag der Thüringer Allgemeine schreibt der Erfurter Kabarettist Ulf Annel über Kurt Tucholskys Aufsatz und Menschen mit Haltung:
Kurt Tucholskys Geburtstag jährte sich gestern zum 125. Mal. Das allgemeine (Des)Interesse am Pazifisten und Antifaschisten Tucholsky und die aktuellen Ereignisse in Frankreich ließen den Ehrentag medial klein, machten aber ein Zitat riesengroß: „Was darf die Satire? Alles.“ Ein Fragesatz, eine Antwort, Punkt.
Aber dieses Zitat ist nur das Ende eines längeren Artikels, den Tucholsky im Januar 1919 für das „Berliner Tageblatt“ schrieb. Ein großer Krieg war vorbei, nicht jedoch der Kampf um die Deutungshoheit, was dieser Krieg für Deutschland war und was man für die Zukunft daraus lernen könne.
Wirklich neu war allerdings, dass die Zensur aufgehoben war und man nun gegen diesen Krieg, seine Verursacher und Profiteure anschreiben konnte. Man lese den ganzen Artikel. Es geht darin nicht nur um den Krieg allein, es geht vor allem um die Befreiung des Denkens, um Aufklärung, um das Recht, alles, aber auch wirklich alles sagen zu dürfen. Aber dieses Recht schließt ein, dass man ein Mensch – gibt es ein genaueres Wort, als das so oft missbrauchte? – mit einem Standpunkt sein muss. „Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier“, schrieb Tucholsky, „nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hanswurst ist, einer, der heute den angreift und morgen den.“
Satire darf alles. Gewissermaßen ist es der Luxemburg-Satz von der Freiheit, die immer auch die Freiheit des Andersdenkenden ist. Aber denken muss man schon. Insofern bedeutet „Alles“ eben nicht alles. Der Satz ist gleichsam wahrhaftig, aber auch satirisch überspitzt. Oder will man allen Ernstes behaupten, Satire dürfe und würde ernsthaft zu Mord, Totschlag, zu Intoleranz und Rassismus, zu Lug und Betrug aufrufen?
Aber nichts und niemand darf für sich in Anspruch nehmen, Satire dürfe sich nicht mit ihm und seinem Tun und Denken beschäftigen. In diesem Sinne gibt es kein Tabu. Keines!
Wenn auch das die Satire beschreibende Wortmaterial nicht ohne Waffen auskommt – wie oft wurde das feine Florett beschworen, mit dem Dieter Hildebrandt umgegangen sein soll -, so ist es doch nur ein Wortbild. Nie sah ich Hildebrandt mit umgeschnallter Hieb- oder Stichwaffe. Aber seine Hiebe und Stiche saßen. Der Grund ist ganz einfach: Er hatte eine Haltung. In seinem Kopf gab es immer diesen Widerspruch zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Ideal und Realität. Er nahm die Fakten und kommentierte kabarettistisch. Hildebrandt wusste genau, dass dabei immer der Zeigefinger des lehrhaften Aufklärers nach oben zuckte. Nie war es ihm genug, was die Medien an Fakten und Zusammenhängen brachten, vor allem vermisste er immer wieder die Fragen: Warum? Und: Wem nützt es? Bei der Beantwortung dieser Fragen nahm er kein Blatt vor den Mund. Alles wurde gesagt. Erinnert man sich heute noch daran, dass seine Sendung einmal von Bayern ausgeschaltet wurde? Ausgeschaltet. Was für ein Wort, gibt man es Mördern in den Mund. Satiriker sind keine Mörder. Satiriker sterben, wenn Mörder sie mundtot machen wollen.
Und nun? Noch ein Zitat. Bertolt Brecht: „Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse“. Diesen Satz hat er der Hauptfigur seines Theater-Stückes „Leben des Galilei“ in den Mund gelegt. In der Realität wurde Galileo Galilei von Religionsvertretern mit dem Tode bedroht.
Thüringer Allgemeine 10. Januar 2015
***
Was darf Satire?
Auszüge aus dem Artikel Kurt Tucholskys für das Berliner Tageblatt vom 27. Januar 1919
Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel.
Satire scheint eine durchaus negative Sache. Sie sagt: „Nein!“ Eine Satire, die zur Zeichnung einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine. Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große, bunte Landsknechtstrommel gegen alles, was stockt und träge ist.
Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier, nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hanswurst ist, einer, der heute den angreift und morgen den. (…)
Übertreibt die Satire? Die Satire muß übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird, und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort: Es leiden die Gerechten mit den Ungerechten.
Aber nun sitzt zutiefst im Deutschen die leidige Angewohnheit, nicht in Individuen, sondern in Ständen, in Korporationen zu denken und aufzutreten, und wehe, wenn du einer dieser zu nahe trittst. Warum sind unsere Witzblätter, unsere Lustspiele, unsere Komödien und unsere Filme so mager? Weil keiner wagt, dem dicken Kraken an den Leib zu gehen, der das ganze Land bedrückt und dahockt: fett, faul und lebenstötend. (…)
Der deutsche Satiriker tanzt zwischen Berufsständen, Klassen, Konfessionen und Lokaleinrichtungen einen ständigen Eiertanz. Das ist gewiß recht graziös, aber auf die Dauer etwas ermüdend. Die echte Satire ist blutreinigend: und wer gesundes Blut hat, der hat auch einen reinen Teint.
Was darf die Satire?
Alles.
Ein Lob der Hauptsätze (Zitat der Woche)
Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze.
Aus dem Newsletter von Wolfram Kiwitt, Chefredakteur der Ruhr-Nachrichten , der Tucholskys „Ratschläge für einen guten Redner“ von 1930 zitiert. Der kostenlose Newsletter von Kiwitt, der jeden Morgen erscheint, ist vorbildlich, unterhaltsam und selbst für einen Nicht-Dortmunder lesenswert; zudem enthält er für jeden Lokalredakteur immer wieder Anregungen. Tipp: Unbedingt abonnieren!
Je suis Charlie – Vor 81 Jahren zerstörten Nazis den Simplicissimus (Friedhof der Wörter)
„Das ist simpel“, sagen wir und meinen: Eine Aufgabe ist einfach, ist unkompliziert. Das Wort haben wir dem Lateinischen „simplex“ entlehnt.
Berühmt machte Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen den Simplicius, einen einfachen Mann, der im dreißigjährigen Krieg Gewalt erlebte, Folter und Mord. Vor gut 350 Jahren erschien der Roman „Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch“, der zur Weltliteratur zählt.
Das lateinische Wort machte Karriere in der deutschen Literatur: Den Simplicissimus, den Einfältigen, wählten Journalisten 1896 zum Titel ihres Satire-Magazins, das alte Motto des Grimmelshausen aufnehmend: „Es hat mir so wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen.“
Es wurde Deutschlands berühmtestes und bestes Satire-Magazin, laut Tucholsky das „A und O der politischen deutschen Satire“, vergleichbar dem „Charlie“ in Paris. Tucholsky erhob das Magazin zum Maßstab für gute Satire: „Vorbildlich in der Form, rücksichtslos im Inhalt“. Was ist der ideale Satiriker: „Er schlägt, und die Getroffenen stehen nicht wieder auf. Er lacht, und der Blamierte kann sich in den Erdboden verkriechen.“
Die Gewalt, die „Charlie“ am Mittwoch erlitt, erfuhr der Berliner Simplicissimus in der Nacht zum 11. März 1933. Die SA zerstörte erst die Redaktions-Räume und dann die Pressefreiheit in Deutschland; einige Redakteure flohen oder tauchten unter.
Die Nazis zwangen die Eigentümer der Zeitschrift, das Magazin „in streng nationalem Geiste“ zu führen. Klaus Mann, einer der Söhne von Thomas Mann, schämte sich im Exil für die Journalisten und nannte ihre Arbeiten „degoutante Gesinnungslumpereien“.
Wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt: Wir zerstören nie wieder die Freiheit der Presse, auch wenn wir uns ärgern, empören und uns in den Erdboden verkriechen wollen. Wir sagen – auch mit Lachen – die Wahrheit.
Und so bekennt auch der Kolumnist des „Friedhofs der Wörter“: Je suis Charlie – ich bin Charlie.
**
Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“ 12. Januar 2015
Goethe erdachte Facebook
Das sicherste Mittel, ein freundschaftliches Verhältnis zu hegen und zu erhalten, finde ich darin, dass man sich wechselweise mitteile, was man tut. Denn die Menschen treffen viel mehr zusammen in dem, was sie tun, als in dem, was sie denken.
Johann Wolfgang von Goethe im Dezember 1798 an Wolfgang Herder, gelesen auf der Weihnachtskarte der „Klassik Stiftung Weimar“
Und Mario Schattney dreht weiter und schreibt auf Facebook:
… und Nietzsche hat mit seinen aphoristischen Prosa und Philosophie Twitter vorweggenommen 😉
Danke!
Wie Wörter die Gefühle verwirren können – und deshalb nicht als Wort des Jahres taugen (Friedhof der Wörter)
Lichtgrenze? Das Wort des Jahres 2014? Ja, aber noch nie stieß die Wahl des Wortes auf so viel Unverständnis.
Wer hat nur die „Lichtgrenze“ erfunden? Gemeint sind die Ballons, die in Berlin am Jubiläums-Tag des Mauerfalls in den Himmel stiegen. „Das Wort spiegelt in besonderer Weise die großen Emotionen wider“, begründet die Jury ihre Wahl.
Genau das geschieht eben nicht. „Lichtgrenze“ provoziert ein Gefühls-Wirrwarr, weil es ein schönes Gefühl, das Licht, verbindet mit einem unschönen, der Grenze, der Mauer, dem Todesstreifen.
Wer Freude an unserer Sprache hat, kann sich seinen Favoriten aus denen wählen, welche die Jury in die engere Auswahl genommen hatte:
-
schwarze Null
-
Götzseidank
-
Russlandversteher
-
bahnsinnig
-
Willkommenskultur
-
Social Freezing
-
Terror-Tourismus
-
Freistoßspray
-
Generation Kopf unten
Da sind einige Wörter dabei, die auch für das Unwort des Jahres taugten: „Russlandversteher“, „Terror-Tourismus“ – oder „Generation Kopf unten“, auf die Jugend von heute bezogen, die unentwegt auf ihr Smartphone schaut, eben „Kopf unten“.
**
Thüringer Allgemeine, 5. Januar 2015
BILD und Süddeutsche gegen den Spiegel: Mit ein bisschen Spott ins neue Jahr
Sensation beim SPIEGEL
1. Print-Redakteur geht ins InternetAuch wenn 90 Prozent der BILD-Leser die Häme nicht verstehen: Auf der letzten Seite der Silvester-Ausgabe pflegt die Redaktion ihre Abneigung gegen die Kollegen aus Hamburg, deren Abneigung allerdings noch ungleich größer sein dürfte. Immerhin begann der dramatische Abgang des Spiegel-Chefredakteurs Büchner mit der Berufung eines BILD-Manns als stellvertretendem Chefredakteur. Es gibt übrigens Scherze, die dürftiger sind als der Spiegel-Spott, etwa: „Statt Soli! Westen schenkt Osten SOLIngen“
Silvester ist wohl der Tag der Spottlust: Auch bei der Süddeutschen fällt Willi Winkler über den Spiegel her. In einem fiktiven Gespräch lässt sich Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel als Nachfolger für den Spiegel-Chefredakteur einfallen und präsentieren:
Gniabor Steingart, Henryk M. Broder, Miriam Meckel, Margot Käßmann (Warum nicht? Der Papst hat gerade verkündet: Die Welt braucht mehr Zärtlichkeit.), Johannes B. Kerner, Giovanni di Lorenzo, Helene Fischer („Sie kommt aus Sibirien, damit kontern wir die ganzen Putin-Versteher aus“), Markus Lanz – aber nicht Ulrich Wickert, ihren Ehemann, der am Ende auftaucht und aus seinem Buch liest: Was uns Werte wert sein müssen.
Udo Jürgens in der DDR: Einer, der zwischen den Zeilen singen konnte (Friedhof der Wörter)
Udo Jürgens war in der DDR beliebt, trat vier Mal auf – er war ja Österreicher, war „neutral“ – und hatte am Ende eine dicke Stasi-Akte. Der Sänger galt in Ostberlin zwar als einer, der sein Publikum mit leichten Texten unterhielt, aber trotzdem als unberechenbar galt – als einer, der zwischen den Zeilen singen konnte.
Zwischen den Zeilen singen – das mochte Udo Jürgens, wenn er nicht gerade „Aber bitte mit Sahne“ anstimmte. Am liebsten komponierte er Lieder mit Botschaften, leisen Botschaften. „Wie finde ich eine geniale Zeile, ohne verletzend zu sein“, fragte er sich, als er im September 1976, kurz nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann, in den Friedrichstadt-Palast kam.
Die Stasi setzte 25 Leute auf ihn an und wollte nach einer „politischen Provokation“ sofort „Ein Kessel Buntes“ stoppen. Udo Jürgens wusste, dass nur ausgewählte Leute der Partei im Saal saßen – aber auch die wollte er einfangen mit den Liedern, die leicht daherkamen, aber die Köpfe bewegten.
Er bewegte sie, erst mit dem scheinbar harmlosen „Und immer, immer wieder geht die Sonne auf“, was im Friedrichstadt-Palast nicht harmlos klang; dann mit „Es war einmal ein Luftballon“, ein Lied an der Grenze zur Provokation mit den Zeilen:
Er flog wie die Gedanken
die niemand hemmt und hält.
Sie kennen keine Schranken
die Luftballons der Welt…Wir singen für dich,
wenn dir die Freiheit auf den Nägeln brennt.
Wir singen für dich,wenn man die eig’ne Meinung dir nicht gönnt!
Mit Wörtern und Liedern kann auch ein Udo Jürgens keine Revolution bewirken, aber Köpfe bewegen, das konnte er. Deswegen haben die Mächtigen auch Angst vor den Wörtern und Liedern, die zwischen den Zeilen ihre Botschaften verstecken und provozieren – ohne dass gleich ein Kessel Buntes explodiert.
Udo Jürgens starb am Sonntag vor Weihnachten.
**
Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, Erscheinungstermin noch offen
Was für ein Jahresrückblick! Neun Nachrufe, neun Mal deutsches Leben
Die Zeit bringt einen beeindruckenden Jahresrückblick: Neun Nachrufe auf unbekannte Menschen, starke Geschichten über das normale und weniger normale Leben:
> eine Frau, die ihr Leben lang auf der Hallig Hooge morgens um fünf die Kühe gemolken hat, dann die Post sortiert und die Telefone mit dem Festland verbunden und ab und an der Flut und dem Orkan getrotzt. Stark der erste Satz von Nadine Ahr: „Am Ende wäre Ilse Mextorf beinahe doch noch ertrunken.“
> ein Sechzehnjähriger aus Ottensen, der zum Islam konvertierte und in Syrien für die IS kämpfte und starb. Der Mutter brachten zwei junge Leute die Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch. Ihr Sohn ist jetzt im Paradies.“ Der zentrale Satz des Nachrufs von Amrai Coen und Marc Widmann:“Er findet eine Heimat im Islam. Er, der Suchende, hat einfache Antworten gefunden auf seine komplizierten Fragen: Im Koran steht, was richtig und was falsch ist.“ Der unauffällige Junge aus Ottensen ist der einzige ohne Namen: Alfons R.
> und Nachrufe auf Francis Kwame aus der Elfenbeinküste, der in Deutschland nicht sein Glück fand und sich zu Tode trank;
> Uwe Heldt, der als Literaturagent Wolfgang Herrndorf entdeckte und ein Jahr nach ihm starb, auch an Krebs;
> den Arzt Hans Wokeck, der Kinder in indischen Slums behandelte und in Indien einsam starb;
> den Husumer Lokalpolitiker Lothar Knoll, ein FDP-Politiker, der Stellvertretender Bürgermeister werden wollte und in fünf Wahlgängen scheiterte;
> Karl-Heinz Gohlke, der 42 Jahre im Gefängnis saß und nach anderthalb Jahren Freiheit starb;
> Olga Ioppa, die auf Flug MH 17 abgeschossen wurde;
> Frieda Szwillus aus Oschatz, die älteste Frau Deutschlands: Sie starb mit 111 Jahren.
Vorbild dürfte die Reihe im Tagesspiegel sein mit Nachrufen auf das normale Leben von normalen Berlinern, jedenfalls von Menschen, die nicht in die Schlagzeilen kamen. Bülend Ürük weist darauf hin: Erfunden hat es die Berliner BZ.
**
Die Zeit 1/2015‚ 30. Dezember 2014
Ein Leser schaut zurück auf die Leserbriefe des Jahres: Das ist gelebte Demokratie!
Wolfgang Jörgens, Leser der Thüringer Allgemeine, liest jeden Leserbrief und notiert ihn in seiner Statistik: Welche Themen interessieren die Leser am meisten? In einer der letzten Ausgaben des Jahres schreibt Jörgens auf der „Leser-Seite“, was ihm aufgefallen ist – und tadelt die Redaktion, dass sie nicht jeden Brief der Leser auch beantwortet:
Da findet in Kürze ein Symposium in Erfurt statt, wo u. a. die Frage aufgeworfen und möglicherweise eine Antwort gesucht wird, die da lautet: „Was wollen die Leser?“ – „Und was bekommen Sie“ . . .von ihrer Heimatzeitung, der Thüringer Allgemeinen? Meine Antwort, als interessierter Leser: Sie, die Leser, wollen gehört und ernst genommen werden. Sie bekommen seit nunmehr fünf Jahren „Ihre“ Leserseite!
An dieser Stelle wiederhole ich mich gern und sehr bewusst: Das ist gelebte Demokratie. Kritiker an dieser Aussage mögen die Frage beantworten, welche regionale Tageszeitung bringt es in fünf Jahren fertig, über 6800 Meinungen von Lesern, ob zustimmende oder ablehnende, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich denke, da gibt es nicht viele vergleichbare Beispiele.
Auch das abgelaufene, sehr turbulente Jahr 2014 belegt dies sehr deutlich. Immerhin wurden 1933 Leserbeiträge in Gedichtform, als Bildunterschrift oder als Textbeitrag zu den unterschiedlichsten Tagesthemen veröffentlicht. Mit der großen Politik, der Bundespolitik, befassten sich 732 Beiträge. Mit der Landespolitik des Freistaates 369. Auch mit 195 Beiträgen zum Thema DDR und einem Anteil von rd. 10 Prozent wurde sich befasst und schließlich 637 Beiträge, das sind rd. 33 Prozent aller Beiträge, brachten u. a. Meinungen zum Sport, der Kultur, dem Umweltschutz, der Landwirtschaft und dem Jagdwesen zum Ausdruck.
Sicher haben sich manche Leserbriefschreiber darüber geärgert, oder gewundert, dass ihr Beitrag nicht veröffentlicht wurde. Ich bin mir sicher, dass alle eingegangenen Leserbriefe von der Redaktion gesichtet, gelesen und in die redaktionelle Arbeit einbezogen wurden. Durch Lesergedichte und Fotos mit Bildunterschrift stand möglicherweise weniger Platz zur Verfügung. Aber, diese Beiträge bringen ebenfalls Emotionen und Meinungen und das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Heimatzeitung zum Ausdruck.
Also haben sie einen berechtigten Platz auf der Leserseite. Ich erspare mir einen näheren Blick auf die „große“ und „kleine“ Politik. Hier würde ich möglicherweise zu viel Subjektivismus rein formulieren. Da mag sich jeder Leser seine eigene Meinung bilden. Etwas erstaunt bin ich jedoch darüber, dass man auf Anfragen an einzelne Redakteure zu bedeutsamen Themen, die die Menschen in unserem Land bewegen, keine Antwort erhält. Lobenswert hierbei sind die rund 50 Beiträge des Chefredakteurs Paul-Josef Raue auf gestellte Fragen, die teilweise unter die „Gürtellinie“ gegangen sind. Respekt vor soviel Mut. Aber Mut zur Wahrheit gehört eben auch zu einem guten Journalismus und einer dynamischen Redaktion im Land und in den Landkreisen. Hier beziehe ich mich gern auf den Landkreis Nordhausen.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Leserbeiträge, da diese nicht anonym bleiben, einen gewissen Mut zur Wahrheit belegen. Alles in allem eine gute Kombination von Professionalität, Sachkenntnis, auch im Ehrenamt, und Leidenschaft auf beiden Seiten. Das führt letztlich zu einer guten Tageszeitung, unserer Thüringer Allgemeinen.
In diesem Sinn allen Beteiligten ein glückliches neues Jahr, hoffentlich in Frieden und dem Willen, aufeinander zuzugehen, dem anderen zuzuhören und möglichst miteinander unser schönes Land weiter zu entwickeln und zu gestalten.
**
Das Symposium, das Jörgens eingangs erwähnt, findet am 12. Januar zum 25-Jahr-Jubiläum der Thüringer Allgemeine statt: „25 Jahre Einheit – 25 Jahre Demokratie im Osten – 25 Jahre TA“
Thüringer Allgemeine, 30. Dezember 2014
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?





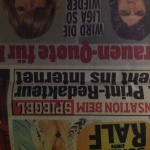


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von