Schäubles Flüchtlings-Lawine: Hütet Euch vor Sprachbildern aus der Natur!
Der „Fallstrick“ steht im Duden, aber kaum einer weiß noch, was ein „Fallstrick“ war: Mehrere Stricke flocht man zu einer Falle, um Ratten und Füchse zu fangen. Wenn ich heute einen Fallstrick lege, will ich einen Menschen täuschen, ihn in eine Falle locken: Die Bedeutung ist geblieben, aber es ist eines der Sprachbilder, das wir noch nutzen, ohne das Bild vor Augen zu haben.
Martin Luther kannte noch den Fallstrick und nutzte das Bild, als er die Bibel übersetzte: „Der Jüngste Tag wird wie ein Fallstrick kommen über alle auf Erden.“ Luther konnte sich darauf verlassen, dass seine Zuhörer ihn verstanden: So wie die Stricke über den Fuchs fallen, so werden sie über Dich fallen, wenn die Welt untergeht.
Journalisten und Politiker nutzen gerne Sprachbilder, um Kompliziertes verständlich zu machen.
„Lawinen kann man auslösen, wenn ein etwas unvorsichtiger Skifahrer an den Hang geht und ein bisschen Schnee bewegt. Nur wo sich die Lawine befindet, ob im Tal oder noch am Hang, das weiß ich nicht.“
Die „Berliner Zeitung“ fand die Sprachbild „schief“. Der Korrespondent des Südwestrundfunks meinte, der „Vergleich von Flüchtlingen mit einer Lawine ist daneben“ und fügte den „unpassendsten Vergleich“ hinzu: Jörg Meuthen, Co-Vorsitzender der AfD, verglich Flüchtlinge mit einem Tsunami.
Die meisten Sprachbilder aus der Natur scheitern: Lawine oder Tsunami – wie jede Naturkatastrophe – können wir nicht stoppen, ihr sind wir schutzlos ausgeliefert. Das Sprachbild suggeriert Ohnmacht. Im Gegensatz dazu steht alles, was Menschen anrichten, verändern oder dulden, in ihrer Macht: Sie müssen nur handeln wollen.
Ein Politiker, der für sein Handeln und Durchgreifen bekannt ist, sollte seinen Redenschreibern die Sprachbilder aus der Natur verbieten – und sich selbst erst recht.
**
Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 23. November 2015
**
Kommentare zu Schäubles Lawinen-Vergleich:
> Neue Osnabrücker Zeitung: Bild unpassend, Sache richtig
Wolfgang Schäuble hat den Flüchtlingszustrom mit einer Lawine verglichen. Das ist zwar im Ton unpassend, in der Sache aber richtig.
> Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), Tweet: „Menschen in Not sind keine Naturkatastrophe.“
> Roland Nelles in Spiegel Online: Gefährliches Bild
Wie bitte? Wolfgang Schäuble vergleicht die Zuwanderung von Flüchtlingen mit einer Lawine? Das sind fiese Worte – aus mehreren Gründen.Wer schon einmal in den Alpen eine Lawine gesehen hat, weiß um deren zerstörerische Kraft. Lawinen wälzen alles nieder, Bäume, Häuser. Sie begraben Menschen unter sich, sie töten.
Das ist ein falsches, ein gefährliches Bild – und das sollte er als langjähriger Minister wissen. Das ist die Sprache der Aufwiegler und Fremdenfeinde. Das ist schlicht: eine Entgleisung.
> Melanie Reinisch im Kölner Stadtanzeiger: Bilder mächtiger als Wörter
Wieder einmal hat ein Politiker eine Naturkatastrophe mit Flüchtlingen verglichen. Das ist nicht neu. Oft bedienen sich Politiker – und auch Medien – bei Sprachbildern, um Themen greifbarer zu machen. Und das macht es nicht besser.
In der aktuellen Flüchtlingsdebatte spricht man häufig von Flüchtlingsflut, -strömen oder -wellen. Doch was vermittelt man mit solchen Sprachbildern? Angst. Schäuble provoziert mit solchen polemischen Äußerungen nicht nur, sondern er zeigt damit auch, dass er selbst Angst vor der Entwicklung hat. Ein Politiker sollte Menschen selbige jedoch nehmen und Ängste und Ressentiments nicht noch schüren. Bilder können eine stärkere Macht als Wörter besitzen, sie setzen sich fest in den Köpfen. Mehr Sensibilität für Sprache und Wirkung sollte nicht nur möglich, sondern zwingend sein.
> Uwe Lueb, SWR-Hauptstadt-Korrespondent: Daneben
Schäubles (CDU) Vergleich von Flüchtlingen mit einer Lawine ist daneben. Sicher, bildhafte Sprache ist gut. Aber man sollte darauf achten, was man wie sagt. An den Flüchtlingsstrom oder gar -ströme hat man sich fast schon gewöhnt. Gut ist die Wortwahl deswegen aber nicht.
Den unpassendsten Vergleich hat der Co-Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, beim Landesparteitag Baden-Württemberg gewählt. Die deutsche Flüchtlingspolitik sei ungefähr so, als wolle man mit Eimern einen „Tsunami“ stoppen. Schäubles „Lawine“ kommt gleich dahinter. Sein Vergleich bestärkt nur Vorurteile von Rechtspopulisten.
Bei einer Lawine haben die Schneeflocken und Eiskristalle nämlich keine Wahl. Sie müssen mit ins Tal. Eine Lawine reißt alles mit und verschüttet, was sich nicht in Sicherheit bringt. Das tun Flüchtlinge nicht. Und sie entscheiden selbst, ob sie sich auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Und sie sind es, die fliehen und nicht diejenigen, die andere in die Flucht schlagen.
> Badische Neueste Nachrichten: Nicht so dramatisch
Schäubles Lawinenvergleich ist sprachlich schlecht gewählt. Falsch ist er aus seiner persönlichen Sicht aber nicht und verboten schon gar nicht… Der eigentliche Aufreger ist also nicht, dass Schäuble Flüchtlinge mit einer Lawine vergleicht, sondern dass sich Teile der Regierung so fühlen, als stünden sie vor einer.“
Erste Aufgabe von Journalisten: Die Schneise schlagen in den Nachrichten-Dschungel – zwischen Tasse und Terror
Auch bei Redakteuren schleicht sich bisweilen das Gefühl ein, den Überblick zu verlieren – gerade in wilden Zeiten wie nach dem Terror in Paris: Nachrichten, meist mehr Gerüchte als klare Informationen, jagen sich – und der Alltag in meiner Stadt und meiner Region geht weiter:
in Dortmund wurde die Weihnachtsmarkt-Tasse 2015 vorgestellt, in Alsdorf bei Aachen nahm die Polizei sieben Terror-Verdächtige fest und ließ sie später wieder frei, in Brüssel ist das Fußballspiel zwischen Belgien und Spanien wegen Terrorgefahr abgesagt worden, in Hannover wollte Deutschland in einer Art „Trauerspiel“ auf die Niederlande treffen, aber auch dieses Spiel wurde gestern Abend abgesagt, in Syrien fallen weiter Bomben aus Frankreich vom Himmel, in Dortmund gibt es nicht nur die Tasse und den weltgrößten Weihnachtsbaum, sondern ganz neu auch einen Weihnachts-Elch „Siegi“ (kommt das von Siegen?) mit roter Mütze als Maskottchen … die Gleichzeitigkeit von Nachrichten kann überfordern. Zwischen Tasse und Terror ist es schwer, einen klaren Blick zu behalten. Das Leben geht weiter. Für die, die leben.
So beginnt heute der Newsletter von RN-Chefredakteur Wolfram Kiwit, der bei allem Jammer über die finstere Welt die Aufgabe von Journalisten klar macht: Wir müssen die Schneise schlagen, wir müssen die Welt so zeigen, dass sie die Menschen verstehen können und nicht verzweifeln – eben zwischen Tasse und Terror. Die Aufgabe war noch vor einigen Jahrzehnten einfacher: Da kamen die Nachrichten aus dem Ticker, so langsam, wie es die Technik zuließ; da schnitten Mitarbeiter die langen Agentur-Fahnen einmal in der Stunde zurecht, sortierten sie und brachten sie in die Ressorts; da schlug eine Glocke am Fernschreiber, wenn eine Nachricht der Priorität 1, die Eilmeldung, eintraf; da gab es wenige Hörfunk- und Fernsehsender und kein Internet für jedermann.
1949 schickte dpa täglich gerade mal 19.000 Wörter, das schaffen heute die Nachrichten-Portale im Netz in wenigen Minuten. Schon in den langsamen Ticker-Zeiten murrten die Redakteure: Die Agenturen überschütten uns mit Nachrichten, von denen wir nur einen Bruchteil drucken können.
Die Welt ist schneller geworden, aber nicht besser. Wer als Journalist meint, das Schneise-schlagen gekinge nicht angesichts apokalyptischer Verhältnisse, der solle lieber Dichter werden oder einer Selsbtfindungs-Gruppe beitreten.
**
Hinweis: Handbuch des Journalismus, Kapitel „Nachrichtenagenturen“
Medien-Professor kritisiert „Sensationalismus“: Zu viele Brennpunkte und Sonderseiten nach dem Terror in Paris
Medien berichten oft in einem Umfang und in einem Alarmton, wie ihn die Terroristen mittlerweile einberechnen. Insbesondere der IS verfolgt eine kühl kalkulierte Medienstrategie
So kritisiert Kai Hafez die Medien nach den Anschlägen in Paris; der 51-jährige ist Professor für vergleichende Analyse von Mediensystemen und Kommunikationskulturen in Erfurt. Hafez wirft in einem Interview mit Martin Debes (Thüringer Allgemeine) den Medien vor, die Kriegs-Rhetorik des Westens fahrlässig zu verstärken. Zudem werden die Medien Handlanger der Terroristen:
Die Medien sind mehr als nur ein Überbringer der Botschaft. Sie schaffen die Bedeutung solcher Anschläge aktiv mit, in dem sie sie in unsere kollektive Erinnerung einbrennen.
Nüchtern berichten – so empfiehlt der Medienwissenschaftler „und nicht mit so vielen Sondersendungen, Sonderseiten und Sonderausgaben“. Ohne großes mediales Echo verkümmere die Botschaft der Angst und werde zum Rohrkrepierer. „Wir alle müssen versuchen, dem Sensationalismus nicht nachzugeben und bei aller verständlichen Emotionalität den Ball flach zu halten.“
Ähnlich argumentiert der Politologe Herfried Münkler in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, glaubt aber, dass unsere Medienwelt mit den schnell wechselnden Themen auch schnell wieder vergessen könne: Wer erinnert sich noch an die Madrider Anschläge 2004, die mehr Todesopfer gefordert haben als die in Paris? Unsere Gesellschaften führten nach einer Weile ihr normales Leben weiter – „weil sich dabei herausstellt, wie schwach doch letzten Endes die angreifenden Akteure sind. Sie sind nur stark in dem Augenblick, in dem wir durch unsere Aufgeregtheit, unsere Nervosität, ja womöglich unsere Hysterie wie Schlagkraftverstärker wirken“.
**
Quellen: Thüringer Allgemeine und Süddeutsche Zeitung, beide 17. November 2015
Wie derbe darf ein Ministerpräsident sprechen? Luther hätte kein Problem mit dem „Dreckarsch“ (Friedhof der Wörter)
Der „Dreckarsch“ steht nicht im Duden, dafür die „Drecksau“, der „Drecksack“ und das „Drecknest“. Der Duden notiert, was die Deutschen so sprechen und schreiben, und distanziert sich auf seine Weise: „derb abwertend“ schreibt er in Klammern hinter solche Dreckswörter.
Im Wörterbuch der deutschen Umgangssprache hat der „Dreckarsch“, der männlichen Geschlechts ist, schon seinen Platz gefunden: „niederträchtiger Mensch“. Im Rheinischen Wörterbuch wird der „Dreckarsch“ als „schwere ehrenrührige Beleidung“ eingestuft.
Dennoch hat der „Dreckarsch“ eine Chance, in die nächste Ausgabe des Dudens aufgenommen zu werden. Immerhin hat der thüringische Ministerpräsident das Wort zwar nicht in den Mund genommen, aber per Twitter in die Welt gesandt: Berlusconi sei „ein Oberrassist und Dreckarsch“.
Berlusconi war etwas, was der Thüringer Bodo Ramelow gerne noch werden möchte: Viermal Ministerpräsident. Noch berühmter wurde Italiens Regierungschef jedoch durch seine „Bunga Bunga Partys“, auf denen auch Minderjährige mit den Herren gespielt haben sollen.
Reicht das, um ihn einen „Dreckarsch“ zu nennen? Die Bildzeitung ist nicht gerade das Zentralorgan der feinen deutschen Sprache, aber sie griff das derbe Ramelow-Wort auf und fragte: „Darf sich ein Regierungschef so äußern?“
Fragen wir Martin Luther um Rat, immerhin eine moralische Instanz seit einem halben Jahrtausend. Luther mochte es gerne derb und schätzte das, was wir streng wissenschaftlich „Fäkalsprache“ nennen: „Ich kann dem Teufel den Hintern zeigen und ihn mit einem einzigen Furz vertreiben.“
Über den Berlusconi seiner Zeit, den mächtigen Herzog Heinrich von Braunschweig, schrieb er: „Unsinniger, wütender Tyrann, der sich voll Teufel gefressen und gesoffen hat und stinkt wie ein Teufelsdreck.“
Als ich 2012 in der Festrede beim Neujahrs-Empfang der Stadt Eisenach das Zitat vorlas, erschrak das vornehme Publikum, so dass ich schnell anfügte: „Schreibt so heute ein Journalist über einen Oberbürgermeister, Minister oder Präsidenten, ruft der den Chefredakteur oder Verleger an, droht mit dem Presserat.“
So viel Scheiß war allerdings auch den Zeitgenossen Luthers schon zuwider. Johann Pistorius schrieb 1595 in den „Anatomia Lutheri“ nach der Lektüre einer Luther-Schrift: „Wie oft Luther das Wort Dreck braucht, ist nicht vonnöten nachzulesen.“ Doch ein halbes Jahrhundert später kann sich jeder Redakteur nicht nur auf Luther, sondern auch auf einen leibhaftigen Ministerpräsidenten berufen.
Noch mehr Dreck? Das Rheinische Wörterbuch listet allein 167 Drecks-Wörter auf. Eine Auswahl?
Dreckfresse, Dreckkriecher, Drecklümmel, Dreckmaul, Dreckwühler, Dreckwutz – und sogar Dreckmike, wobei die Westerwälder dabei bestimmt nicht an den Thüringer Oppositionsführer Mike Mohring gedacht haben.
**
Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“, 16. November 2015 (erweiterte Fassung)
Zündeln Redakteure, wenn sie über Gewalt in Flüchtlings-Unterkünften berichten?
Erst verfügte laut Gewerkschafts-Angaben der Innenminister in Thüringen, die Polizei solle nicht mehr über Einsätze in Flüchtlings-Unterkünften berichten, nun enthüllen auch die Kieler Nachrichten solch ein Schweigen der Polizei in Schleswig-Holstein. FDP-Chef Kubicki postet in Facebook:
Sollte es zutreffen, dass die Redaktion der „Kieler Nachrichten“ tatsächlich von der Landespolizei aufgefordert wurde, nicht über Fälle in der Flüchtlingsthematik zu berichten, die von der Landespolizei selbst als ‚relevante Ereignisse‘ eingestuft wurden, dann wäre das ein Skandal. Ressortleiter Michael Kluth berichtet dies in seinem Kommentar von heute.
Die Begründung für solch ein Vorgehen, die Presse ‚zündele‘, rechtfertigt in keinem Fall die Geheimhaltung offensichtlicher Tatbestände. Sie ist sogar doppelt skandalös. Denn erstens ist die Meinungs- und Pressefreiheit in unserem Grundgesetz festgeschrieben. Sie bildet damit einen der Grundpfeiler unserer Republik. Zweitens dürfen wir nicht jeden, der Kritik übt, ja nur kritische Fragen stellt, in den Senkel stellen und mit dem Vorwurf der Zündelei belegen.
Wenn die Verantwortlichen den Eindruck vermitteln, es würden wesentliche öffentlichkeitsrelevante Fakten verschleiert und die Debatte unehrlich geführt, sorgt dies für einen massiven Vertrauensverlust der Menschen in unsere demokratische Ordnung. Es verhindert nicht nur eine sachliche Auseinandersetzung, sondern macht die Menschen erst empfänglich für antidemokratische Kräfte.
Neonazis stellen Lokalredakteur unentwegt nach: Die ganze Geschichte
Dortmunder Neonazis brandmarken den Ruhr-Nachrichten-Redakteur Peter Bandermann im Netz als „Volksverräter“, stellen eine Todesanzeige mit seinem Namen ins Netz, werfen Farbbeutel auf sein Haus. Als Peter Bandermann ein Brötchen beim Bäcker kaufen will, wird er von statdtbekannten Neonazis umstellt, bedrängt und genötigt. Er zeigt sie an, doch die Staatsanwaltschaft sieht nur eine subjektive Belästigung und keine „schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung“. Sein Chefredakteur Kiwit veröffentlicht in seinem Newsletter den Brief der Staatsanwaltschaft und kommentiert: „Ein rechtsstaatliches Armutszeugnis und ein Freibrief für die Neonazis“.
Nachdem in diesem Blog der Fall dokumentiert worden war, gab es auch kritische Stimmen und den Vorwurf, unfair gegenüber der Staatsanwaltschaft zu sein: Was ist genau passiert? Was heißt „bedrängen und nötigen“? Hat die Staatsanwaltschaft nicht einfach „vorschriftsmäßig“ gehandelt?
Peter Bandermann selber schildert ausführlich die Anfeindungen der Neonazis in einer Mail an diesen Blog:
Bis dahin ertragene Anpöbeleien auf Demonstrationen oder Verunglimpfungen im Internet waren Vorläufer für eine Verschärfung der Repressionen. Ende November 2014 veröffentlichten Dortmunder Neonazis im Internet eine Liste mit 10 Dortmunder Namen, die als Volksverräter gebrandmarkt wurden. Vor ihren Privathäusern sollten Demonstrationen stattfinden. Über die Auswahl von drei „Nominierten“ sollte abgestimmt werden.
Die Wahl fiel auf den Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau, auf ein weiteres SPD-Mitglied und auf mich als Redakteur der Ruhr Nachrichten. Ich beobachte und berichte in Dortmund seit 15 Jahren.
Nach einem von der Polizei ausgesprochenen Verbot gegen den Demo-Anmelder, die Versammlung direkt vor meiner Haustür stattfinden zu lassen, gab es Aufrufe im Internet, mich dennoch zu „besuchen“. Zunächst wurden in meiner Nachbarschaft Flugblätter über mich verteilt. In der Nacht zum 2. Weihnachtstag 2014 kam es zu einem Farbanschlag auf das Haus, in dem ich zur Miete wohne. Die Täter wurden nicht ermittelt. Das Verfahren wurde sechs Wochen später eingestellt.
Im Februar 2015 wurden im Internet eine Todesanzeige mit meinem Namen und die Ankündigung meines bevorstehenden Todes veröffentlicht. Ein Ermittlungsergebnis gibt es bislang nicht.
Ende August 2015 veranstaltete das Zentrum für politische Schönheit in Berlin vor einem von mehreren Neonazis bewohnten Haus im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld ein Schauspiel. Dafür war ich als Reporter eingesetzt. Nach Beendigung dieser Kunstaktion war ich auf dem Weg zum versteckt abgestellten PKW. Neonazis erkannten, verfolgten und stellten mich überraschend in einem Ladenlokal und veröffentlichten die gefilmte Szene im Internet.
Wir erhalten anonyme Anrufe mit elektronisch verstellten Anrufen und erhalten Post, u. a. ein Infoblatt über das Gefängnis in Bautzen sowie Kataloge mit Nazi-Devotionalien. Hinzu kommen online veröffentlichte „Hinweise“ auf den Umgang mit Volkverrätern in früheren Zeiten.
In einer der Anzeigen ist umfangreich dargestellt worden, welche Methoden die Bedroher wählen.
Neonazis stellen Redakteur nach – Staatsanwalt zuckt mit den Schultern: „Nicht schwerwiegend“
Peter Bandermann schreibt in der Dortmunder Lokalredaktion der Ruhr-Nachrichten über Neonazis. Denen gefällt das nicht: Als er vor einigen Wochen beim Bäcker ein Brötchen kaufen wollte, umstellen ihn einige stadtbekannte Neonazis, bedrängten und nötigten ihn.
Peter Bandermann informierte die Staatsanwaltschaft, die keine Beeinträchtigung von Arbeit und Leben des Redakteurs sieht und nur mit den Schultern zuckt:
Nicht ausreichend ist, dass die Belästigungen subjektiv als nachteilig empfunden werden. Die von Ihnen geschilderten Beeinträchtigungen sind nicht als schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung anzusehen.
Wolfram Kiwit, RN-Chefredakteur, veröffentlicht in seinem Newsletter das Schreiben im Original und kommentiert: „Ein rechtsstaatliches Armutszeugnis und ein Freibrief für die Neonazis“.
Nico Fried tritt zurück: Der letzte „Spreebogen“ mit viel Geschwurbel
Als Kurt Kister seine Samstags-Kolumne in der SZ aufgab, um sich als Chefredakteur in vielen Konferenzen zu langweilen, da war ich sicher: Das ist der Tod der besten Politik-Kolumne unserer Republik. Wer konnte es wagen, sich mit Kisters feiner Ironie und seinem Wissen des Politik-Betriebs zu messen, mit Kisters eigenem Erzähl-Ton und einer Melancholie, die überdeckt, wie einer an dieser Demokratie und ihren Akteuren leidet.
 Nico Fried wagte es, ein Kister-Schüler, der in die meisten seiner „Spreebogen“-Kolumnen einen Satz einschob als Running-Gag: „Wenn man einen Chefredakteur hat, der früher mal mein Büroleiter war…“ Nico Fried, seit acht Jahren SZ-Chef in Berlin, hat nicht versucht, Kister zu kopieren; er hat seinen eigenen Ton gefunden, ein wenig milder, ein wenig liebevoller. Er selbst sah sich so in einem „Spreebogen“, als sein Kollege Hulverscheidt nach Amerika ging:
Nico Fried wagte es, ein Kister-Schüler, der in die meisten seiner „Spreebogen“-Kolumnen einen Satz einschob als Running-Gag: „Wenn man einen Chefredakteur hat, der früher mal mein Büroleiter war…“ Nico Fried, seit acht Jahren SZ-Chef in Berlin, hat nicht versucht, Kister zu kopieren; er hat seinen eigenen Ton gefunden, ein wenig milder, ein wenig liebevoller. Er selbst sah sich so in einem „Spreebogen“, als sein Kollege Hulverscheidt nach Amerika ging:
Gelegentlich haben Claus Hulverscheidt und ich auch gemeinsam Artikel geschrieben, besonders gerne über Wolfgang Schäuble. Hulverscheidt war für die Fakten zuständig, ich fürs Geschwurbel. Einmal kamen wir mit so einem Text unter die letzten ichweißnichtwievielten beim Henri-Nannen-Preis, einer renommierten Auszeichnung für Journalisten. Weil die Geschichte keine Reportage war, nahm uns die Jury in die Kategorie Essay. Das war ungefähr so, als würde man bei einem Kochwettbewerb einen Toast Hawaii mit Knäckebrot zulassen. Wir haben den Preis am Ende nicht gewonnen, uns aber gegenseitig fortan voller Ehrfurcht als Essayisten angesprochen.
Eines hat Fried mit Kister doch gemeinsam: Die Liebe zu unserem Land, zur Freiheit und zur Demokratie. Beide würden abstreiten, dass es Liebe ist, Kister noch mehr als Fried. Liebe wäre zu viel Gefühl, meinten sie, wahrscheinlich.
Nun hört auch Fried auf: Welch ein Verlust! Der Samstag hatte immer ein großes Versprechen parat: Den „Spreebogen“. Wer klug war unter den Lesern, überblätterte fünfzig Seiten und schaute zuerst auf den linken Rand im Gesellschaftsteil. In seinem letzten „Spreebogen“ spricht Fried über – Rücktritte; er erzählt von den Politikern, mit denen er über ihren Rücktritt gesprochen hat: Müntfering, Merkel, Seehofer. Und dann verkündet ein großer Kolumnist seinen Rücktritt, seinen eigenen:
Ich habe neulich ein ernstes Gespräch mit mir geführt. Ich habe nicht gesagt: Tritt zurück. Ich wollte nicht blöd dastehen, wenn ich geantwortet hätte: Nö. Stattdessen habe ich mich dazu gebracht, von selbst draufzukommen. Deshalb ist dieser Spreebogen der letzte. Sonst schreibt noch einer, es sei auch höchste Zeit gewesen.
Ich schreibe es nicht, ich weiß, mir wird etwas fehlen am Samstagmorgen.
Wer war Luther? Ein Urviech? Ein wortgieriger Mann? Mit Luther Wörter erfinden (Friedhof der Wörter)
Natürlich war der Mann ein Naturereignis, ein Sprachfex.
So beginnt die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff ihren Essay über Martin Luthers Wortgewalt – und scheitert gleich im ersten Satz. „Sprachfex“? Was bedeutet das Wort?
Der „Sprachfex“ schlummert am äußersten Rand unserer Sprache, er taucht nur selten auf. Selbst bei Goethe, der gern mit den Wörtern spielte, entdeckt man nur einmal einen Fexen – im „Faust“. Der Teufel spricht von „Hexenfexen“ und vergleicht sie mit „Gespenstgespinsten“ und „kielkröpfigen Zwergen“.
Schlauer ist man nicht: Ist der Sprachfex also ein Hexenmeister der Sprache? Einigen wir uns darauf: Ein Hexenmeister.
Nur – passt der zu Martin Luther, dessen 498. Reformations-Gedenken am kommenden Sonnabend ansteht? Kaum. Doch wer über Luther und die Sprache schreibt, will ihm folgen und kräftige Wörter erfinden.
Aber Vorsicht! Nicht jeder, auch nicht jeder, der schreiben kann, hat Luthers Format. Sibylle Lewitscharoff erfindet ein Synonym nach dem anderen für Luther:
Erst das Naturereignis, dann der Sprachfex, gefolgt vom großen Reformator, dem entlaufenen Mönch, dem sprachlichen Urviech, dem Judenhasser, dem außerordentlich begabten Mann, dem wortgierigen Mann, dem Unruhestifter, dem Prophet des Weltendes. So viele Wörter für einen Mann – wer will sie alle verstehen?
Und was hat Luther mit unserer Sprache getan?
Er hat mit seinen kräftigen Händen darin herumgerührt, sie mit einer nicht scheuen Zunge unter die Leute gebracht, ein enormes Sprachgewitter erzeugt, ein dunkeldrohendes Saftdeutsch mit hellen Aufflügen geschrieben und die Wörter am Zügel der Knappheit laufen lassen.
Genug der Bilder! Genug der Sprachgewalt! Es ist noch viel Platz auf dem Friedhof der Wörter.
**
Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 26. Oktober 2015
Sibylle Lewitscharoffs Essay „Von der Wortgewalt“ eröffnet den Sammelband „Denn wir haben Deutsch. Luthers Sprache aus dem Geist der Übersetzung“ (Matthes & Seitz-Verlag, 336 Seiten, 24.90 Euro)-
Investigativer Kampf: „‚Kann, soll, angeblich‘ kamen niemals in den großen Spiegel Storys vor“
Die beste Kontrolle der Medien sind die Medien selbst – erst recht wenn sie konkurrieren, neidisch sind und eifersüchtig auf den Erfolg der anderen. Ein Lehrstück ist zur Zeit die Spiegel-Enthüllung über die Korruption bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland: Reichen die Vermutungen? Gibt es Beweise oder nur Indizien? Stimmt wenig oder nichts?
Zwei Fronten haben sich formiert – und einer schaut zu: Der Spiegel auf der einen Seite, Bild auf der anderen Seite, die Süddeutsche abwartend und skeptisch. Hans Leyendecker (SZ), Deutschlands bester Investigativer, bleibt in einem Interview mit MDR Figaro in der Deckung, ihm sind die Vorwürfe des Spiegel nicht wasserdicht – und ein schwacher Moderator stellt ihm nur windelweiche und von wenig Kenntnis getrübte Fragen. Es scheint, als erwarte der Ex-Spiegel-Reporter Leyendecker einen Gesichts- oder gar Glaubwürdigkeits-Verlust seines alten Arbeitgebers, den er nicht fröhlich verlassen hatte.
Bild lässt Niersbach, den DFB-Chef, zurückschlagen – wie der Spiegel als Titelgeschichte, eine Woche danach. Franz-Josef Wagner macht sich in seiner Brief-Kolumne über die Profis vom Spiegel her:
Lieber Spiegel, Du hast Deinen Wortschatz erweitert. Lauter neue Spiegel-Wörter in der WM-Story:
Soll… angeblich… offenbar… mutmaßlich… anschaulich… möglicherweise.
Für mich sprach der Spiegel bisher immer eine direkte Sprache. Wörter wie „kann, soll, angeblich“ kamen niemals in den großen Storys vor. Sätze, die so anfangen, sind wie auf Sand geschrieben.
In der Tat liest sich der Spiegel-Aufmacher, als habe die Rechtsabteilung eifrig mitredigiert.
Aus der Konkurrenz der Medien ist ein Kampf der Medien geworden und ein Kampf um die Wahrheit. Investigativ gilt auch für die gegenseitige Kontrolle der Medien: Wer am besten recherchiert, ist vorn. Wer will da noch von Lügenpresse reden?
Rubriken
- Aktuelles
- Ausbildung
- B. Die Journalisten
- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen
- C 5 Internet-Revolution
- C Der Online-Journalismus
- D. Schreiben und Redigieren
- F. Wie Journalisten informiert werden
- Friedhof der Wörter
- G. Wie Journalisten informieren
- H. Unterhaltende Information
- I. Die Meinung
- Journalistische Fachausdrücke
- K. Wie man Leser gewinnt
- L. Die Redaktion
- Lexikon unbrauchbarer Wörter
- Lokaljournalismus
- M. Presserecht und Ethik
- O. Zukunft der Zeitung
- Online-Journalismus
- P. Ausbildung und Berufsbilder
- PR & Pressestellen
- Presserecht & Ethik
- R. Welche Zukunft hat der Journalismus
- Recherche
- Service & Links
- Vorbildlich (Best Practice)
Schlagworte
Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche
Letzte Kommentare
- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...
- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...
- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...
- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...
- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...
Meistgelesen (Monat)
Sorry. No data so far.
Meistgelesen (Gesamt)
- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre
- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ
- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)
- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)
- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?





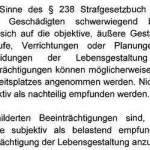


 Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von
Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von